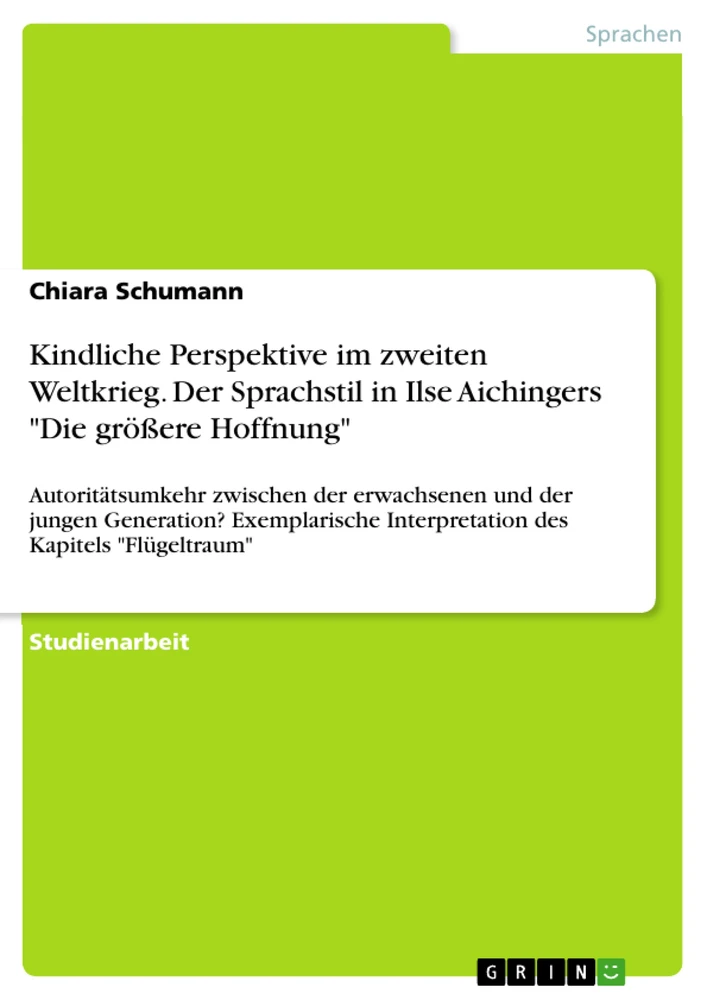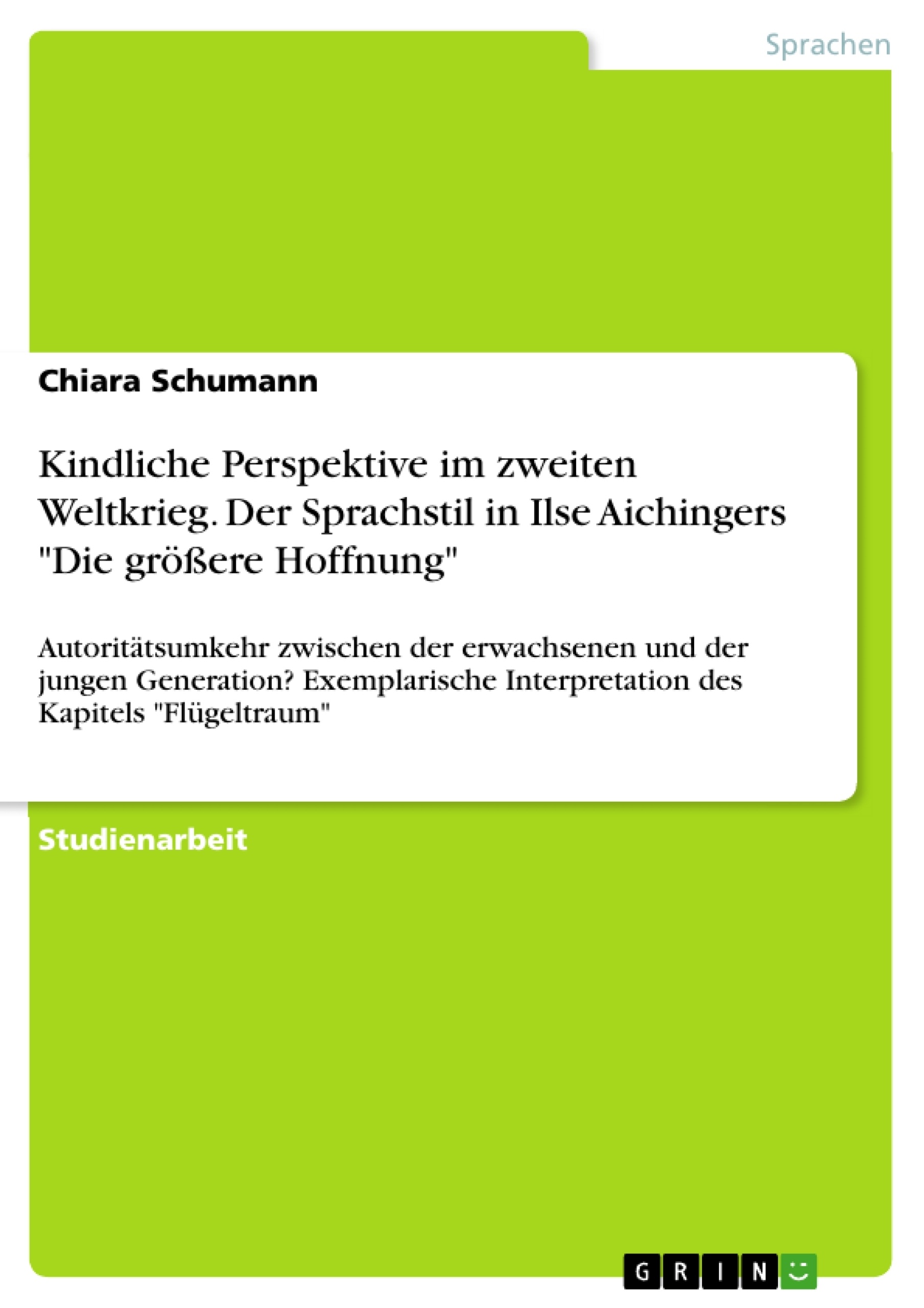Diese Arbeit setzt sich intensiv mit dem besonderen Sprachstil in Ilse Aichingers "Die größere Hoffnung" auseinander, das als poetologisches Meisterwerk zu wenig Beachtung fand. Ich möchte meinen kleinen Beitrag zur Forschungsliteratur rund um diesen Roman leisten und ihm meine Hochachtung entgegen bringen. Kein Autor verstand sich darauf die Schrecken des zweiten Weltkrieges mit einer solchen Eindringlichkeit aufzuzeigen wie Aichinger. Distanz und Nähe zum Geschehen verschwimmen bei Ihr durch die kindliche Perspektive und ermöglichen dadurch gerade erst die einzigartige Wirkung. Der Leser lernt eine zweite Welt hinter den Zeilen zu erkennen. Im Anschluss an die Darstellung der besonderen Entstehungssituation und -zeit folgt die spezifische Auseinandersetzung mit der Metaphorik im Buch und die Beurteilung des prägnanten Sprachstils auch anhand einer konkreten Kapitelanalyse. Das Schlusswort fasst die wesentlichen Studienerkenntnisse zusammen.
Unmittelbar nach Kriegsende wird 1948, in Amsterdam im Bermann-Fischer Verlag, ein exzeptionelles Werk publiziert, das die nationalsozialistischen Verbrechen Deutschlands schon verhandelt, bevor sie überhaupt für die Mehrheit dieser und anderer Nationen fassbar wurden.
Die psychischen Prägungen für den ersten und einzigen Roman „Die größere Hoffnung“ der Österreicherin Ilse Aichinger und nachfolgend wichtigen Repräsentantin der Nachkriegsliteratur begannen in ihrer späten Jugend unter dem Hitlerregime und verweisen auf autobiographische Bezüge des Inhalts. Als prominentes Mitglied der Gruppe 47, die in der Nachkriegszeit den „Nullpunkt“ des literarischen Schreibens kennzeichnet und einen radikal neuen Stil forderte, erfuhr die Autorin jedoch eine vergleichsweise schmale Resonanz und Würdigung. Die Ursachen dafür sollen im Haupttext nachgezeichnet werden. Eine der frühesten Auseinandersetzungen mit der Shoah verläuft hier in kindlicher Perspektive durch die Schilderung der Geschichte des jungen Mädchens Ellen, in zehn chronologisch angeordneten allegorischen Bildern oder Kapiteln. Das zu behandelnde Werk ist ein essenzieller Grundbaustein in der Klärung der zentralen Frage der Autoren nach dem Krieg, welche Darstellungsform der Erinnerung gegenüber dem nationalsozialistischen Terror überhaupt literarisch vertretbar sei.
Während dem mein Hauptaugenmerk im ersten Teil der anschließenden Abhandlung gelten wird und ich untersuchen möchte warum Aichingers Sprache, primär in "[der] größere[n] Hoffnung", eine Antwort [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. HAUPTTEIL
- 2.1 Allegorischer und lyrischer Sprachstil in Aichingers Roman
- 2.1.1 Allgemeine Informationen
- 2.1.2 Forschungsstand und Praxis
- 2.1.3 Ein Roman wie kein Zweiter?
- 2.1.4 Vier Ebenen der Wirklichkeit
- 2.2 „Flügeltraum“ – Eine Interpretation:
- 3. SCHLUSSBEMERKUNG
- 4. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung des Sprachstils in Ilse Aichingers „Die größere Hoffnung“ und die Analyse des Kapitels „Flügeltraum“ im Hinblick auf die Autoritätsbeziehung zwischen Erwachsenem und Kind.
- Kindliche Perspektive auf den Zweiten Weltkrieg
- Allegorischer und lyrischer Sprachstil in Aichingers Roman
- Die Rolle von Trauma und Erinnerung in der Nachkriegsliteratur
- Die Darstellung der Shoah aus der Sicht eines Kindes
- Autoritätsumkehr zwischen Erwachsenem und Kind
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Roman „Die größere Hoffnung“ als ein essenzielles Werk der Nachkriegsliteratur vor, das sich frühzeitig mit der Shoah auseinandersetzt. Sie beleuchtet die autobiographischen Bezüge und die literarische Relevanz des Romans im Kontext der Gruppe 47. Zudem wird die Frage der Darstellbarkeit von Kriegserlebnissen aus kindlicher Perspektive in den Mittelpunkt gestellt.
Der Hauptteil konzentriert sich zunächst auf den allegorischen und lyrischen Sprachstil von Aichingers Roman. Hierbei werden allgemeine Informationen zum Roman, der Forschungsstand und die spezifischen Merkmale ihres Stils beleuchtet. Im zweiten Teil wird das Kapitel „Flügeltraum“ interpretiert, wobei insbesondere die Umkehrung der Autoritätsbeziehung zwischen Erwachsenem und Kind untersucht wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselbegriffen Kindliche Perspektive, Nachkriegsliteratur, Sprachstil, Allegorie, Shoah, Autoritätsbeziehung, Erinnerung, Trauma und „Die größere Hoffnung“ von Ilse Aichinger.
- Citation du texte
- Chiara Schumann (Auteur), 2020, Kindliche Perspektive im zweiten Weltkrieg. Der Sprachstil in Ilse Aichingers "Die größere Hoffnung", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/978267