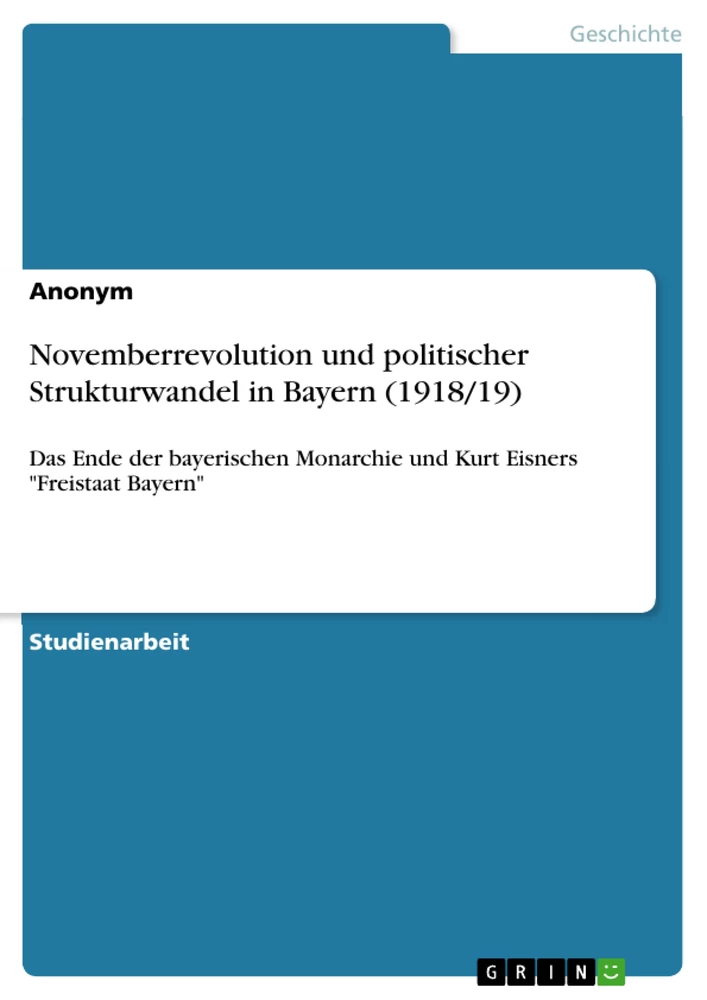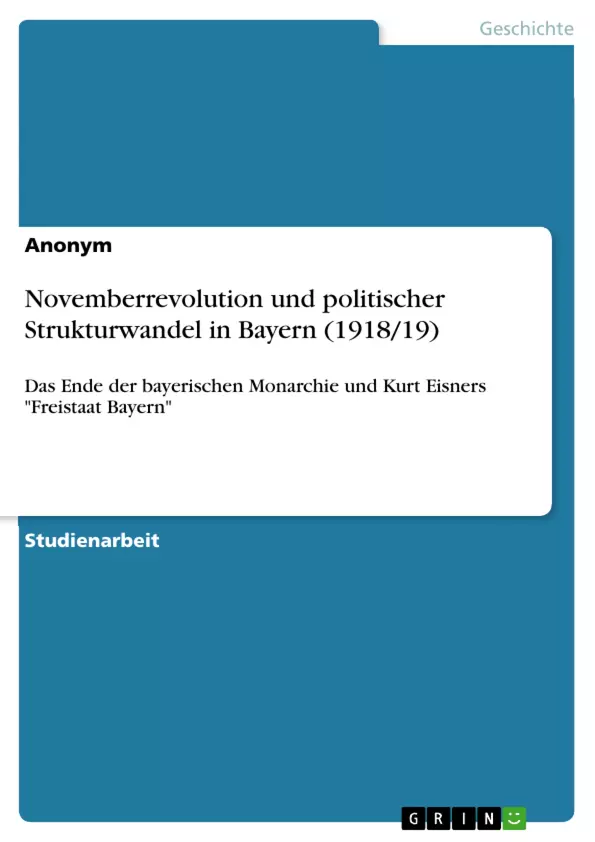Die Revolution vom 9. November 1918 in Berlin bedeutete das Ende der monarchischen Staatsform in Deutschland und resultierte in der Etablierung einer parlamentarischen Demokratie, der Weimarer Republik. Trotz dieses erfolgreichen Strukturwandels lässt sich eine „nahezu allseitige posthume Unbeliebtheit“ der Revolution im öffentlichen Bewusstsein feststellen. Sie geht bereits auf die Weimarer Republik zurück, in der vor allem rechte Kräfte zur Stigmatisierung und Diffamierung der Revolutionäre als politische Verbrecher oder psychisch Kranke und zur Entstehung der berühmten Dolchstoßlegende beitrugen. Eine solche negative Deutung wurde im Nationalsozialismus weiter fortgeführt, bis die Umwälzung schließlich nach dem Zweiten Weltkrieg in Vergessenheit geriet. Heute, 100 Jahre später, ist sie immer noch kaum Teil der deutschen Erinnerungskultur oder „gilt […] als die Revolution, die es nicht geschafft hat, die Nazis zu verhindern. Oder sie gar hervorgebracht hat“. Aufgrund dessen rief Frank-Walter Steinmeier zum Gedenktag am 9. November 2018 wiederholt dazu auf, stärker an „die Geburt der Republik in Deutschland“ zu erinnern.
Es darf allerdings nicht vergessen werden, dass der Revolution in Berlin der Staatsumsturz in München vorausging. Zwei Tage zuvor, am 7. November 1918, beendete Kurt Eisner die bayerische Monarchie und rief die erste demokratische Republik auf deutschem Boden aus. Die vorliegende Hausarbeit befasst sich deshalb zum 100. Jahrestag der Novemberrevolution mit den Geschehnissen in Bayern. Es wird die Frage gestellt, welcher politische Strukturwandel von den Beteiligten erreicht oder beabsichtigt wurde. Dabei soll die Residenzstadt München und die erste Phase der Revolution, die sog. „Erste Revolution“ von der Umwälzung bis zum gewaltsamen Ende der Amtszeit Eisners am 21. Februar 1919, im Fokus der Betrachtung stehen, da sie den Beginn für weitere Ereignisse im Land markierten.
Inhaltsverzeichnis
- Deutungen der Novemberrevolution im Wandel
- Novemberrevolution und politischer Strukturwandel in Bayern (1918/19)
- Das Ende der bayerischen Monarchie
- Erster Weltkrieg und Reformbestrebungen
- Revolution in München: Hintergrund, Ausbruch und Verlauf
- Kurt Eisners „Freistaat Bayern“
- Die revolutionäre Regierung und ihr Arbeitsprogramm
- Das Ende des Kabinetts Eisner
- Fazit und politischer Strukturwandel nach der Amtszeit Eisners
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht den politischen Strukturwandel in Bayern während der Novemberrevolution von 1918/19. Im Fokus steht die Residenzstadt München und die erste Phase der Revolution, die sogenannte „Erste Revolution“, von der Umwälzung bis zum gewaltsamen Ende der Amtszeit Kurt Eisners am 21. Februar 1919.
- Die Ursachen der Revolution in Bayern, insbesondere die Folgen des Ersten Weltkriegs und die bayerische Reformbewegung
- Die Rolle Kurt Eisners beim Sturz der bayerischen Monarchie und der Gründung des „Freistaats Bayern“
- Das Arbeitsprogramm der revolutionären Regierung und die Ziele des demokratischen Strukturwandels
- Die wichtigsten politischen Instanzen und Grundzüge der bayerischen Republik
- Das Ende des Kabinetts Eisner und die Folgen für den weiteren politischen Strukturwandel
Zusammenfassung der Kapitel
- Deutungen der Novemberrevolution im Wandel: Dieses Kapitel beleuchtet die unterschiedlichen Interpretationen der Novemberrevolution, von der anfänglichen Euphorie über die Etablierung der Weimarer Republik bis hin zu ihrer negativen Konnotation in der Zeit des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit.
- Das Ende der bayerischen Monarchie: Dieses Kapitel analysiert die vielschichtigen Ursachen für das Ende der Monarchie in Bayern, insbesondere die Folgen des Ersten Weltkriegs und die Reformbestrebungen, die zu einer wachsenden Autoritätskrise des Königtums führten.
- Erster Weltkrieg und Reformbestrebungen: Der Erste Weltkrieg und seine Folgen, wie Kriegstote, Kriegsinvalide, Nahrungsmittelknappheit und wirtschaftliche Probleme, verschärften die bereits bestehenden Probleme in Bayern und führten zu einer Vertiefung der Reformbestrebungen.
- Revolution in München: Hintergrund, Ausbruch und Verlauf: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Ausbruch der Revolution in München, die zum Sturz der bayerischen Monarchie führte, wobei der Fokus auf dem Hintergrund der Revolution und den beteiligten Akteuren liegt, nicht auf einer detaillierten Schilderung des Verlaufs.
- Kurt Eisners „Freistaat Bayern“: Dieses Kapitel beleuchtet die Gründung des „Freistaats Bayern“ durch Kurt Eisner und analysiert das Arbeitsprogramm der revolutionären Regierung, das den demokratischen Strukturwandel vorantreiben sollte.
- Die revolutionäre Regierung und ihr Arbeitsprogramm: Dieses Kapitel beschreibt die Kernelemente des Arbeitsprogramms der neuen Regierung, das auf eine sozialistische und demokratische Umgestaltung Bayerns zielte.
- Das Ende des Kabinetts Eisner: Dieses Kapitel schildert den Sturz des Kabinetts Eisner und analysiert die Gründe für dessen Ende.
- Fazit und politischer Strukturwandel nach der Amtszeit Eisners: Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und gibt einen kurzen Ausblick auf den politischen Strukturwandel in Bayern nach dem Sturz des Kabinetts Eisner.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Novemberrevolution in Bayern, einschließlich der Folgen des Ersten Weltkriegs, der bayerischen Reformbewegung, der Rolle Kurt Eisners, dem Sturz der bayerischen Monarchie, dem „Freistaat Bayern“, dem Arbeitsprogramm der revolutionären Regierung, dem demokratischen Strukturwandel und dem Ende des Kabinetts Eisner.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde in Bayern die Monarchie beendet?
Bereits am 7. November 1918, zwei Tage vor der Revolution in Berlin, rief Kurt Eisner in München die erste demokratische Republik auf deutschem Boden aus.
Wer war Kurt Eisner?
Kurt Eisner war der Anführer der bayerischen Revolution und der erste Ministerpräsident des „Freistaats Bayern“. Er wurde am 21. Februar 1919 gewaltsam aus dem Amt gerissen.
Was versteht man unter der „Ersten Revolution“ in Bayern?
Es bezeichnet die Phase vom Staatsumsturz im November 1918 bis zum Ende der Amtszeit des Kabinetts Eisner im Februar 1919, die den Beginn des demokratischen Strukturwandels markierte.
Warum gilt die Novemberrevolution oft als „Revolution, die es nicht geschafft hat“?
Im öffentlichen Bewusstsein wird sie oft negativ gedeutet, da sie den Aufstieg der Nationalsozialisten nicht verhindern konnte oder fälschlicherweise mit der „Dolchstoßlegende“ verknüpft wurde.
Welche Rolle spielte der Erste Weltkrieg für den Umsturz in Bayern?
Die wirtschaftliche Not, Nahrungsmittelknappheit und die vielen Kriegsopfer führten zu einer massiven Autoritätskrise des bayerischen Königtums und befeuerten die Reformbestrebungen.
Was war das Ziel von Eisners Arbeitsprogramm?
Das Programm zielte auf eine tiefgreifende sozialistische und demokratische Umgestaltung Bayerns ab, um die alte monarchische Ordnung endgültig zu überwinden.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2018, Novemberrevolution und politischer Strukturwandel in Bayern (1918/19), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/978280