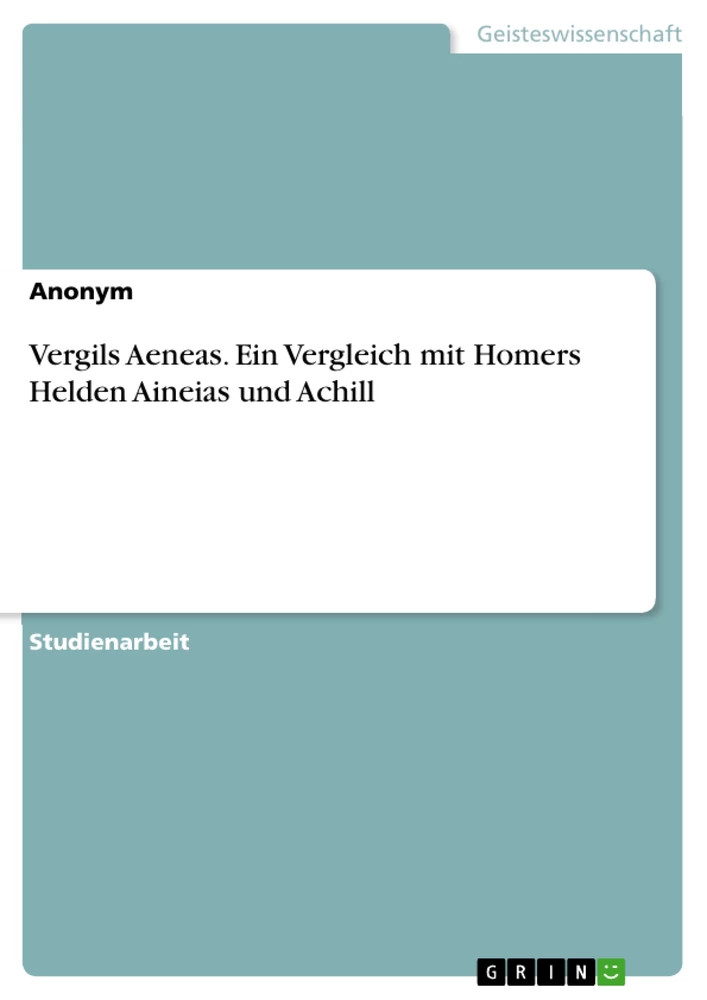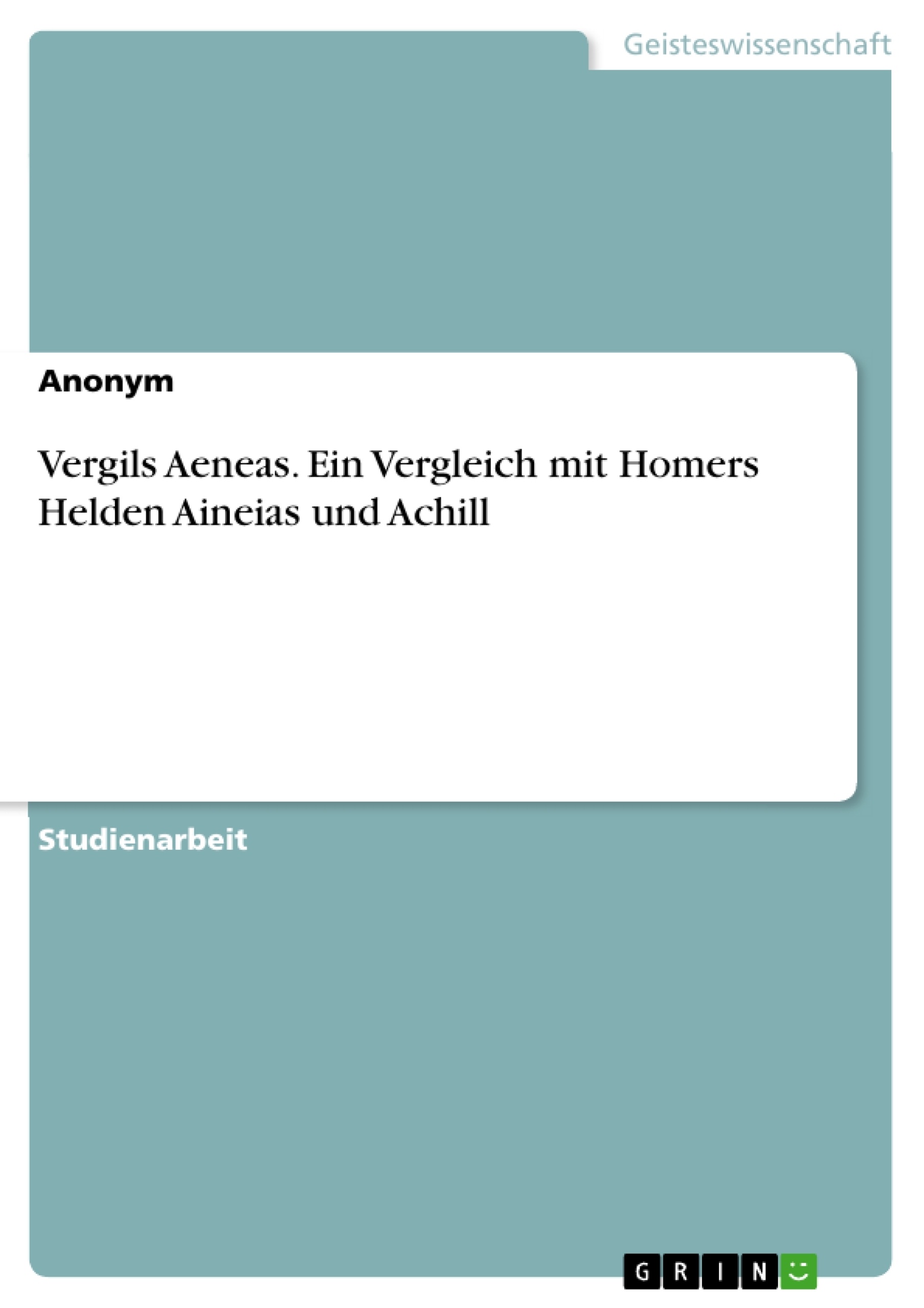In der vorliegenden Hausarbeit soll der Frage nachgegangen werden, welchen Einfluss Homer auf Vergil im Hinblick auf die Charakterbildung des Aeneas ausgeübt haben könnte. Dabei konzentriert sich die Arbeit auf die Ilias und auf zwei Helden aus diesem Epos: Aineias und Achill. Die Figurenwahl begründet sich darin, dass auf der einen Seite Aeneas und Aineias "historisch" betrachtet identische Personen darstellen. Daher könnte man gewisse Bezüge zur homerischen Vorlage annehmen. Auf der anderen Seite haben bereits die Überschneidungen zwischen den Epen eine zumindest strukturelle Entsprechung zu Achill angekündigt. Ziel der Arbeit ist es allerdings nicht, eine vollständige Charakterisierung des Aeneas zu erarbeiten, sondern anhand von exemplarischen Textstellen wesentliche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den genannten Helden der Ilias aufzuzeigen. Aeneas wird also stets im Kontext zu Aineias oder Achill charakterisiert. Dabei steht auch nicht im Vordergrund, wieso Vergil intertextuelle Bezüge zu Homer hergestellt hat. Es geht demzufolge vielmehr um die Frage: Welche Eigenschaften sind gleich und welche wurden von Vergil verändert?
Die Auseinandersetzung römischer Autoren mit der griechischen Literatur lässt sich durch die Begriffe imitatio (Nachahmung) und aemulatio (Wetteifer) näher bestimmen. Während zunächst griechische Texte ins Lateinische (frei) übersetzt und Gattungen dementsprechend übertragen wurden (interpretatio und translatio), entwickelte sich dieses Vorgehen mit der Zeit zu einer Nachahmung literarischer Vorgänger, die gleichzeitig durch Veränderungen der Vorlage ein Übertreffen eben dieses Prätextes anstrebte. Dies wird seit den 60er Jahren ebenfalls als "Intertextualität" bezeichnet, worunter man nicht nur die vom Autor intendierten, sondern auch die impliziten Bezüge versteht.
Inhaltsverzeichnis
- Homer als literarische Vorlage für Vergils Aeneis.
- Vergleich der Aeneas-Figur mit den homerischen Helden Aineias und Achill
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede Aeneas - Aineias
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede Aeneas - Achill
- Fazit: Aeneas, ein römischer Held
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss Homers auf Vergils Charakterbildung des Aeneas in der Aeneis. Der Fokus liegt dabei auf einem Vergleich des Aeneas mit den homerischen Helden Aineias und Achill.
- Die Untersuchung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Aeneas und Aineias in der Ilias.
- Die Analyse von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Aeneas und Achill, insbesondere in Bezug auf Abwesenheit vom Kampfgeschehen und das Zornmotiv.
- Die Erforschung von Vergils Abwandlungen homerischer Figuren und ihrer Bedeutungen im Kontext der Aeneis.
- Die Analyse der Rolle von Schicksal und Göttlicher Vorbestimmung in der Aeneis.
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel untersucht die literarische Vorlage von Vergils Aeneis, insbesondere die Rolle Homers und die Beziehung zwischen Vergils Epos und den homerischen Epen Ilias und Odyssee.
- Das zweite Kapitel vergleicht die Figur des Aeneas mit den homerischen Helden Aineias und Achill. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf ihre Charakterzüge, ihre Rolle im Kampfgeschehen und ihre Beziehung zu den Göttern aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Aeneis, Vergil, Homer, Ilias, Aineias, Achill, Charakterisierung, Vergleich, Gemeinsamkeiten, Unterschiede, Intertextualität, Schicksal, Göttliche Vorbestimmung, Helden, römische Literatur, griechische Literatur.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte Homer auf Vergils "Aeneis"?
Homer diente als literarische Vorlage. Vergil nutzte Techniken der Imitatio und Aemulatio, um die Charaktere seiner Helden in Anlehnung an homerische Vorbilder zu formen und zu übertreffen.
Wie unterscheiden sich der homerische Aineias und der vergilische Aeneas?
Obwohl sie historisch dieselbe Person darstellen, passt Vergil den Charakter an römische Tugenden und das Konzept des Schicksals (fatum) an.
Welche Parallelen gibt es zwischen Aeneas und Achill?
Die Arbeit untersucht strukturelle Entsprechungen, insbesondere das Motiv des Zorns und die Abwesenheit vom Kampfgeschehen.
Was bedeuten die Begriffe "Imitatio" und "Aemulatio"?
Imitatio bezeichnet die Nachahmung literarischer Vorbilder, während Aemulatio das Ziel beschreibt, diese Vorbilder durch gezielte Veränderungen zu übertreffen.
Welche Rolle spielt die göttliche Vorbestimmung in der Arbeit?
Sie ist ein zentraler Aspekt der Analyse, da das Handeln des Aeneas stark durch sein Schicksal als Gründer Roms bestimmt wird.
- Citation du texte
- Anonym (Auteur), 2016, Vergils Aeneas. Ein Vergleich mit Homers Helden Aineias und Achill, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/978286