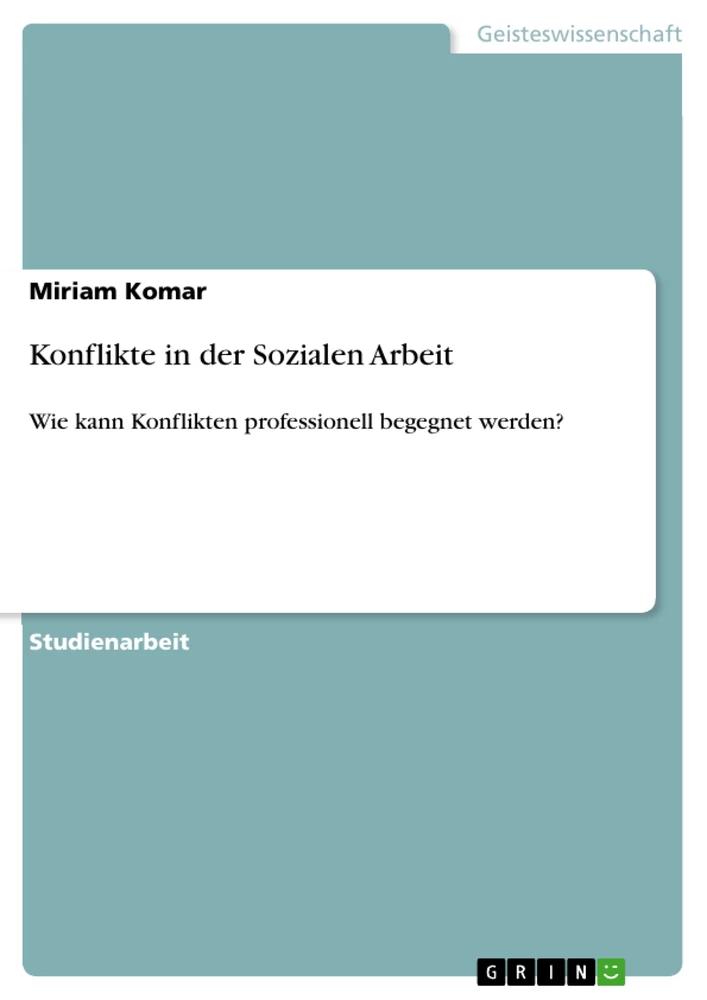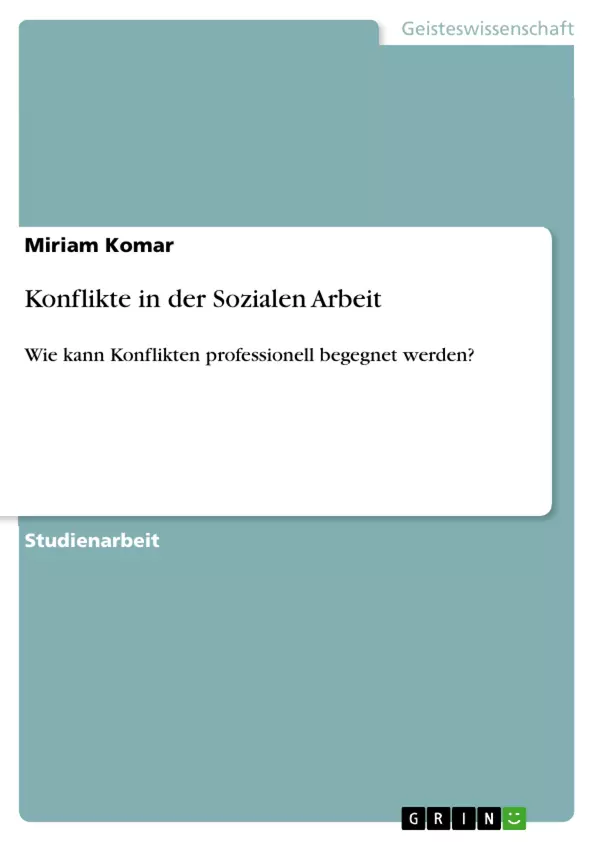Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Forschungsfrage, wie Konflikten in der Sozialen Arbeit professionell begegnet werden kann. Dazu werden im ersten Kapitel des Hauptteils Definitionen des Begriffs „Konflikt“ erörtert und dargestellt, wie es zu Eskalationen von Konflikten kommen kann. Im zweiten Kapitel des Hauptteils wird dann darauf eingegangen, wie man Konflikte mittels des Mediationsverfahrens bearbeiten kann. Abschließend werden die Ergebnisse dieser Hausarbeit in einer Abschlussdiskussion zusammengefasst und diese in einem letzten Schritt reflektierend betrachtet.
Bei der Reflexion werde ich mich vor allem auch mit der Frage beschäftigen, was die Auseinandersetzung mit Konflikt und Mediation für mich in meinem zukünftigen Alltag als Sozialarbeiterin bedeutet. Konflikte sind in unserem Leben allgegenwärtig, in jedem Bereich unseres Lebens und in dem Leben unserer Adressat*innen. In jeder Lebenslage können Probleme auftreten, sei es im Berufsleben oder im privaten Alltag. Doch Konflikte sind nicht immer ausschließlich negativ zu bewerten. Sie sind „eine unvermeidbare und für den sozialen Wandel notwendige Begleiterscheinung des Zusammenlebens in allen Gesellschaften". Der Soziale Wandel geht fast immer mit Konflikten einher, deswegen würde eine systematische Vermeidung von Konflikten sich eher kontraproduktiv auswirken, da sie gesellschaftliche Veränderungsprozesse verhindern würde.
Das Ziel im Alltag der Professionellen der Sozialen Arbeit ist es, dass Konflikte gewaltfrei und möglichst konstruktiv ausgetragen werden können, damit von ihnen produktive Lern- und Veränderungsimpulse für alle Konfliktparteien ausgehen. Im beruflichen Alltag eines Sozialarbeiters/einer Sozialarbeiterin ist es wichtig, Konfliktsituationen rechtzeitig zu erkennen und diese mit den Adressat*innen bzw. mit den Konfliktparteien zu erörtern. Denn werden die betroffenen Parteien sich nicht rechtzeitig eines entstehenden Konflikts bewusst oder reagieren auf die ersten Anzeichen unangemessen, droht eine Eskalation des Konflikts. Dies gilt es zu vermeiden. Die Adressat*innen bzw. die betroffenen Konfliktparteien könnten den Konflikt zunächst verdrängen, sich in eine Abwehrhaltung begeben oder mit einem verbalen Angriff und Schuldzuweisungen beginnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konflikte in der Sozialen Arbeit
- Was ist ein Konflikt?
- Entstehung und Eskalation von Konflikten
- Das Handlungskonzept „Mediation“
- Definition und Prinzipien der Mediation
- Der Ablauf des Mediationsverfahrens
- Chancen und Grenzen der Mediation
- Der Zusammenhang von Mediation und Sozialer Arbeit
- Reflexion
- Abschlussdiskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht, wie Konflikte in der Sozialen Arbeit professionell bewältigt werden können. Im Mittelpunkt steht die Analyse des Begriffs "Konflikt" und die Darstellung der Eskalation von Konflikten. Des Weiteren wird das Mediationsverfahren als Instrument der Konfliktbearbeitung betrachtet. Die Arbeit reflektiert zudem die Bedeutung des Themas Konflikt und Mediation für die zukünftige Praxis der Sozialen Arbeit.
- Definition und verschiedene Arten von Konflikten
- Eskalation von Konflikten und deren Phasen
- Das Handlungskonzept Mediation und dessen Prinzipien
- Der Zusammenhang von Mediation und Sozialer Arbeit
- Reflexion und Bedeutung des Themas für die zukünftige Praxis der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage der Hausarbeit vor: Wie können Konflikte in der Sozialen Arbeit professionell begegnet werden? Sie betont die Allgegenwärtigkeit von Konflikten in allen Lebensbereichen und die Bedeutung einer konstruktiven Konfliktbewältigung in der Sozialen Arbeit.
Konflikte in der Sozialen Arbeit
Dieses Kapitel befasst sich mit der Definition des Begriffs "Konflikt" und unterscheidet zwischen sozialen Konflikten, inneren Konflikten und strukturellen Konfliktpotenzialen. Es werden verschiedene Definitionsansätze vorgestellt und die Bedeutung einer multiperspektivischen Betrachtungsweise betont.
Das Handlungskonzept „Mediation“
Dieses Kapitel definiert Mediation als ein Verfahren zur Konfliktlösung und beschreibt seine Prinzipien und den Ablauf. Es beleuchtet Chancen und Grenzen der Mediation in der Sozialen Arbeit.
Der Zusammenhang von Mediation und Sozialer Arbeit
Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen Mediation und Sozialer Arbeit und betrachtet die Anwendung des Mediationsverfahrens in verschiedenen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die zentralen Themen Konflikt, Mediation, Soziale Arbeit, Eskalation, Konfliktlösung, Handlungskonzept, professionelle Praxis, Reflexion, zukünftige Praxis der Sozialen Arbeit.
- Arbeit zitieren
- Miriam Komar (Autor:in), 2020, Konflikte in der Sozialen Arbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/978830