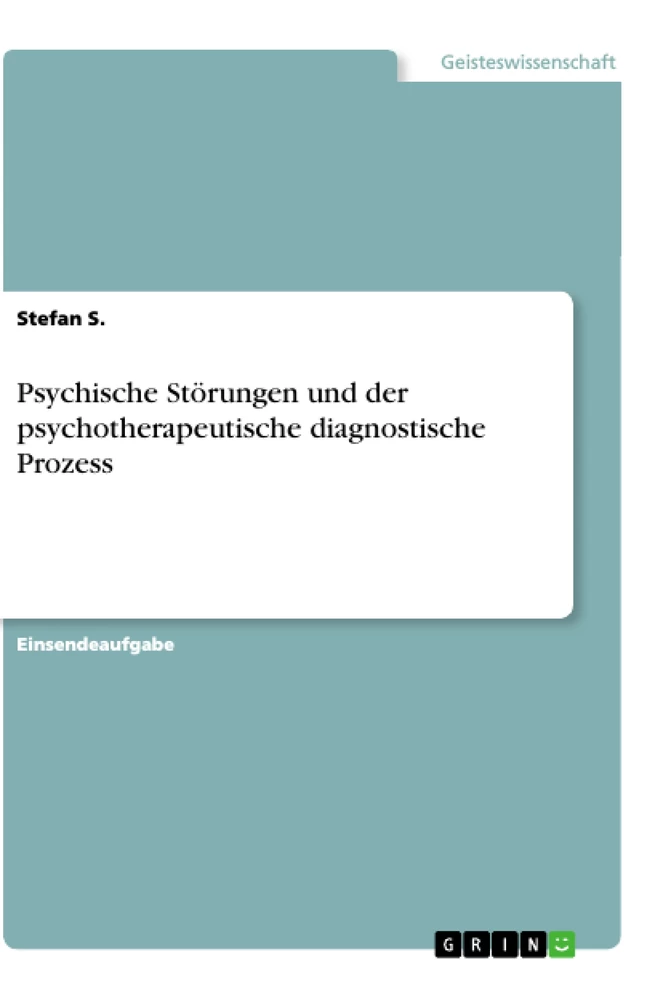Im ersten Kapitel soll unter Bezugnahme von empirischen Ergebnissen die Bedeutung von Risiko- und Schutzfaktoren für die Entstehung von psychischen Störungen erläutert werden.
Im zweiten Kapitel wird, ergänzend zu den vorherigen Ausführungen zur Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen, anhand von theoretischen Modellen und empirischen Ergebnissen, der Einfluss von sozialer Unterstützung und von dysfunktionalen Kognitionen auf die psychische Entwicklung einer Person thematisiert.
Im dritten Kapitel werden die einzelnen Phasen der Diagnostik von der ersten klinischen Begutachtung bis hin zur abschließenden Diagnose am Bespiel der posttraumatischen Belastungsstörung erläutert. Es soll auf die wichtigsten Komponenten innerhalb jeder Phase eingegangen werden, wobei sich hier stets am Beispiel orientiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Teilaufgabe 1: Risiko- und Schutzfaktoren
- 1.1 Risikofaktoren für die Entstehung von psychischen Störungen
- 1.1.1 Interne Risikofaktoren
- 1.1.2 Externe Risikofaktoren
- 1.2 Schutzfaktoren gegen psychische Störungen
- Teilaufgabe 2: Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen
- 2.1 Der Einfluss sozialer Unterstützung
- 2.2 Die Bedeutung dysfunktionaler Kognitionen
- Teilaufgabe 3: Diagnostik im Prozess der Psychotherapie
- 3.1 Einführung in die Diagnostik
- 3.2 Therapiebeginn – Indikationsorientierte Diagnostik
- 3.3 Therapieverlauf – Prozess- und Verlaufsdiagnostik
- 3.4 Therapieende - Evaluationsdiagnostik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit Risiko- und Schutzfaktoren für die Entstehung psychischer Störungen, deren Entstehung und Aufrechterhaltung sowie der diagnostischen Prozesse in der Psychotherapie. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen individuellen Faktoren, Umwelteinflüssen und dem Verlauf psychischer Erkrankungen zu vermitteln.
- Risikofaktoren (intern und extern) für psychische Störungen
- Schutzfaktoren gegen die Entwicklung psychischer Störungen
- Einfluss sozialer Unterstützung auf die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen
- Rolle dysfunktionaler Kognitionen bei psychischen Störungen
- Diagnostische Verfahren im psychotherapeutischen Prozess
Zusammenfassung der Kapitel
Teilaufgabe 1: Risiko- und Schutzfaktoren: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung von Risiko- und Schutzfaktoren bei der Entstehung psychischer Störungen. Es werden interne Faktoren wie Temperament, Intelligenz und genetische Disposition sowie externe Faktoren wie soziale Umwelt und prägende Lebensereignisse differenziert betrachtet. Empirische Studien werden herangezogen, um den Einfluss dieser Faktoren auf die Entwicklung psychischer Erkrankungen zu belegen und die komplexen Wechselwirkungen zwischen biologischen und psychosozialen Faktoren aufzuzeigen. Das Kapitel unterstreicht, dass die Wahrscheinlichkeit der Entstehung einer psychischen Störung durch das Zusammenspiel verschiedener Risikofaktoren erhöht, aber gleichzeitig durch Schutzfaktoren gemindert werden kann.
1.1 Risikofaktoren für die Entstehung von psychischen Störungen: Dieser Abschnitt konzentriert sich auf verschiedene Bedingungen, die die Wahrscheinlichkeit der Entwicklung einer psychischen Störung erhöhen. Es wird zwischen internen (personenbezogenen) und externen (umweltbezogenen) Risikofaktoren unterschieden. Die Diskussion umfasst biologische Faktoren wie genetische Disposition und organische Erkrankungen sowie psychosoziale Faktoren wie schwieriges Temperament, prägende Lebensereignisse und Drogenkonsum. Empirische Studien werden zitiert, um die Bedeutung und den kumulativen Effekt dieser Risikofaktoren zu veranschaulichen, wobei der Fokus auf dem komplexen Zusammenspiel dieser Faktoren und ihrem Einfluss auf den Entwicklungsverlauf liegt.
1.1.1 Interne Risikofaktoren: Dieser Abschnitt detailliert interne, biologische Risikofaktoren wie schwieriges Temperament, geringe Intelligenz, genetische Disposition und organische Erkrankungen. Das Temperament wird im Detail betrachtet, unter Bezugnahme auf das Modell von Thomas und Chess, welches verschiedene Temperamentstypen und deren Zusammenhang mit der Entwicklung psychischer Störungen beschreibt. Die Rolle genetischer Faktoren wird ebenfalls diskutiert, wobei betont wird, dass diese nicht allein verantwortlich für die Entstehung psychischer Störungen sind. Studien werden zitiert, die den Zusammenhang zwischen Temperament, genetischer Veranlagung und der späteren Entwicklung von psychischen Störungen aufzeigen.
Schlüsselwörter
Psychische Störungen, Risiko- und Schutzfaktoren, interne und externe Faktoren, Temperament, genetische Disposition, soziale Unterstützung, dysfunktionale Kognitionen, Diagnostik, Psychotherapie, Indikationsdiagnostik, Prozessdiagnostik, Evaluationsdiagnostik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Risiko- und Schutzfaktoren psychischer Störungen
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet einen umfassenden Überblick über Risiko- und Schutzfaktoren psychischer Störungen, deren Entstehung und Aufrechterhaltung sowie die diagnostischen Prozesse in der Psychotherapie. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter.
Welche Teilaufgaben werden behandelt?
Das Dokument gliedert sich in drei Teilaufgaben: 1. Risiko- und Schutzfaktoren, 2. Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen und 3. Diagnostik im Prozess der Psychotherapie.
Welche Risikofaktoren für psychische Störungen werden behandelt?
Es werden sowohl interne (z.B. Temperament, Intelligenz, genetische Disposition, organische Erkrankungen) als auch externe Risikofaktoren (z.B. soziale Umwelt, prägende Lebensereignisse, Drogenkonsum) untersucht. Der Fokus liegt auf dem komplexen Zusammenspiel dieser Faktoren.
Welche Schutzfaktoren werden betrachtet?
Das Dokument beleuchtet Schutzfaktoren, die die Wahrscheinlichkeit der Entstehung psychischer Störungen mindern können. Die genauen Schutzfaktoren werden jedoch nicht explizit aufgezählt.
Welche Rolle spielt soziale Unterstützung?
Die Bedeutung sozialer Unterstützung für die Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen wird als wichtiger Faktor untersucht.
Wie werden dysfunktionale Kognitionen behandelt?
Die Rolle dysfunktionaler Kognitionen bei der Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen wird analysiert.
Welche diagnostischen Verfahren werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt verschiedene diagnostische Verfahren im psychotherapeutischen Prozess, einschließlich Indikations-, Prozess- und Evaluationsdiagnostik. Der Therapiebeginn, -verlauf und -abschluss werden im Hinblick auf die Diagnostik betrachtet.
Welche Kapitelzusammenfassungen sind enthalten?
Es gibt Zusammenfassungen zu den Teilaufgaben 1 (Risiko- und Schutzfaktoren) und dem Unterkapitel 1.1 (Risikofaktoren für die Entstehung psychischer Störungen) sowie 1.1.1 (Interne Risikofaktoren). Diese Zusammenfassungen geben einen detaillierten Überblick über die behandelten Themen und die verwendeten Methoden.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter umfassen: Psychische Störungen, Risiko- und Schutzfaktoren, interne und externe Faktoren, Temperament, genetische Disposition, soziale Unterstützung, dysfunktionale Kognitionen, Diagnostik, Psychotherapie, Indikationsdiagnostik, Prozessdiagnostik, Evaluationsdiagnostik.
Welches ist das übergeordnete Ziel des Dokuments?
Ziel des Dokuments ist es, ein umfassendes Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen individuellen Faktoren, Umwelteinflüssen und dem Verlauf psychischer Erkrankungen zu vermitteln.
- Quote paper
- Stefan S. (Author), 2020, Psychische Störungen und der psychotherapeutische diagnostische Prozess, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/979388