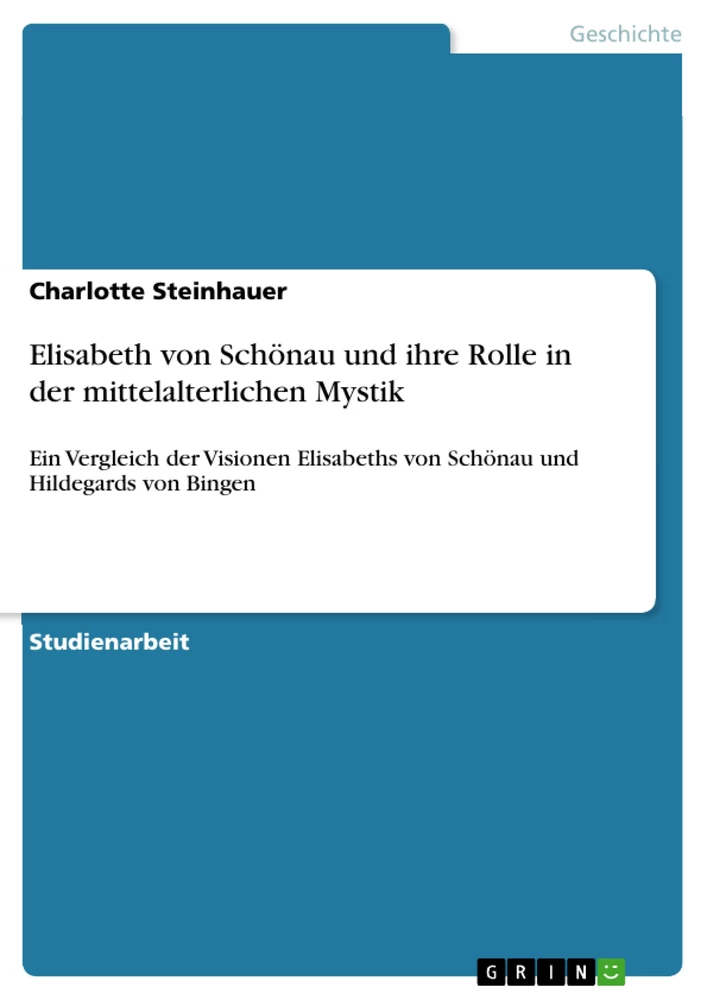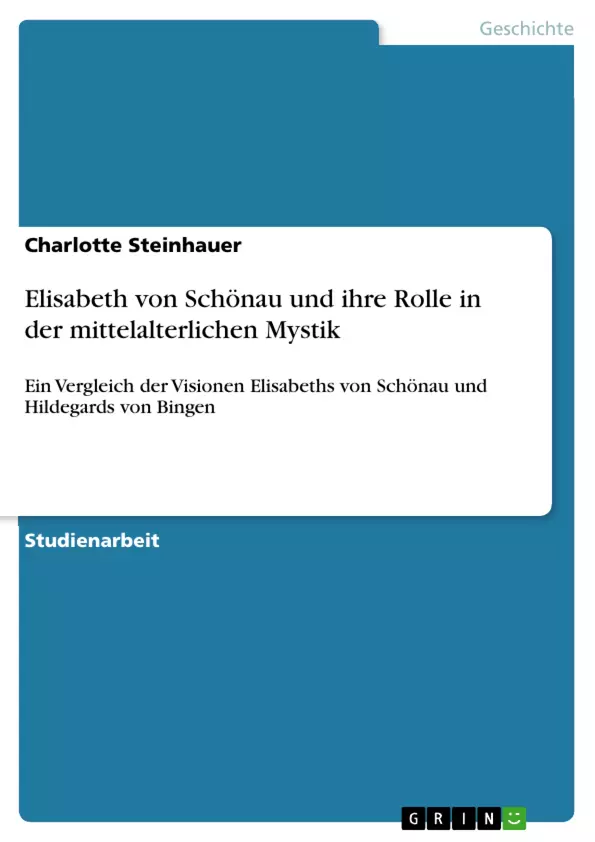Thema dieses Seminars, das in der vorliegenden Arbeit einen Abschluss finden soll, waren die Visionen der Benediktinernonne Elisabeth von Schönau. Sie kann wohl als eine der bedeutendsten Visionärinnen des Mittelalters gelten. Mit ihren in Ekstase erfahrenen Visionen und Erlebnissen der Glossalolie sowie der Auditionen gehört sie zu den Charismatikerinnen der mittelalterlichen Frauenmystik. Mittels dieser göttlichen Offenbarungen, die ihr ab ihrem dreiundzwanzigsten Lebensjahr zuteilwurden und deren Niederschrift durch ihren Bruder Ekbert, wurde sie zur Vermittlerin zwischen Mensch und Gott. Dabei half sie ebenso bei der Klärung theologischer Fragen, wie dabei, Lücken der Geschichtsschreibung zu füllen. Blieb sie zu ihren Lebzeiten eher im Bereich ihrer Diözese bekannt, scheint ihre Nachwirkung im Hoch- und Spätmittelalter umso bedeutender. Dies ist nicht zuletzt an der hohen Zahl der verbreiteten Handschriften und Übersetzungen zu erkennen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- ELISABETH VON SCHÖNAU
- HILDEGARD VON BINGEN
- VERGLEICHENDE BETRACHTUNG
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit den Visionen der Benediktinernonne Elisabeth von Schönau und deren Vergleich mit den Visionen Hildegards von Bingen. Die Untersuchung zielt darauf ab, das Phänomen der Vision im Mittelalter zu beleuchten, indem sie die individuellen Erfahrungen der beiden Visionärinnen analysiert und in den Kontext ihrer Zeit stellt.
- Die Besonderheiten der Visionen Elisabeths von Schönau
- Der Vergleich zwischen den Visionen Elisabeths und Hildegards
- Die Rolle von Ekbert als Schreiber und Einfluss auf die Visionen Elisabeths
- Die Bedeutung der Visionen im Kontext der mittelalterlichen Frauenmystik
- Die Definition von Visionen und deren Abgrenzung zu anderen Phänomenen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt Elisabeth von Schönau und Hildegard von Bingen als zentrale Figuren der Untersuchung vor und beleuchtet die Bedeutung der Visionen im mittelalterlichen Kontext. Sie führt zudem die Forschungsdiskussion und den Fokus der Arbeit ein.
- Elisabeth von Schönau: Dieses Kapitel analysiert die Visionen Elisabeths von Schönau im Detail. Es untersucht die Art der Visionen, die Rolle des ekstatischen Zustands, die Inhalte der Visionen und die Frage nach eventueller Beeinflussung durch Dritte.
- Hildegard von Bingen: Dieses Kapitel widmet sich den Visionen Hildegards von Bingen und untersucht diese im Hinblick auf Parallelen und Unterschiede zu Elisabeths Visionen. Die Analyse bezieht sich auf die gleichen Kriterien wie im vorherigen Kapitel, um einen vergleichenden Blick auf die beiden Visionärinnen zu ermöglichen.
- Vergleichende Betrachtung: Dieses Kapitel vergleicht die Visionen von Elisabeth von Schönau und Hildegard von Bingen in ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Es untersucht die unterschiedlichen Manifestationen der Visionen im Kontext der jeweiligen Lebenswelten und der damaligen Theologie.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die zentralen Themen Visionen, Mystik, Frauenmystik, Mittelalter, Elisabeth von Schönau, Hildegard von Bingen, Ekbert von Schönau, Vergleich, Visionsliteratur, Theologie, Geschichte, Quellenkritik, Genderforschung.
- Quote paper
- Charlotte Steinhauer (Author), 2016, Elisabeth von Schönau und ihre Rolle in der mittelalterlichen Mystik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/979792