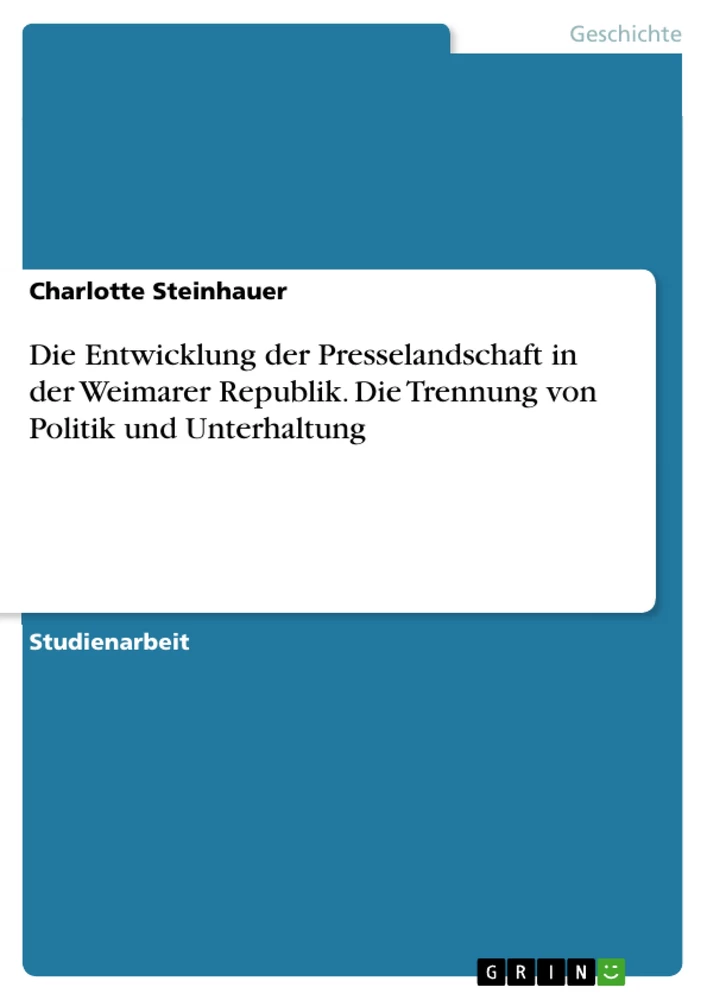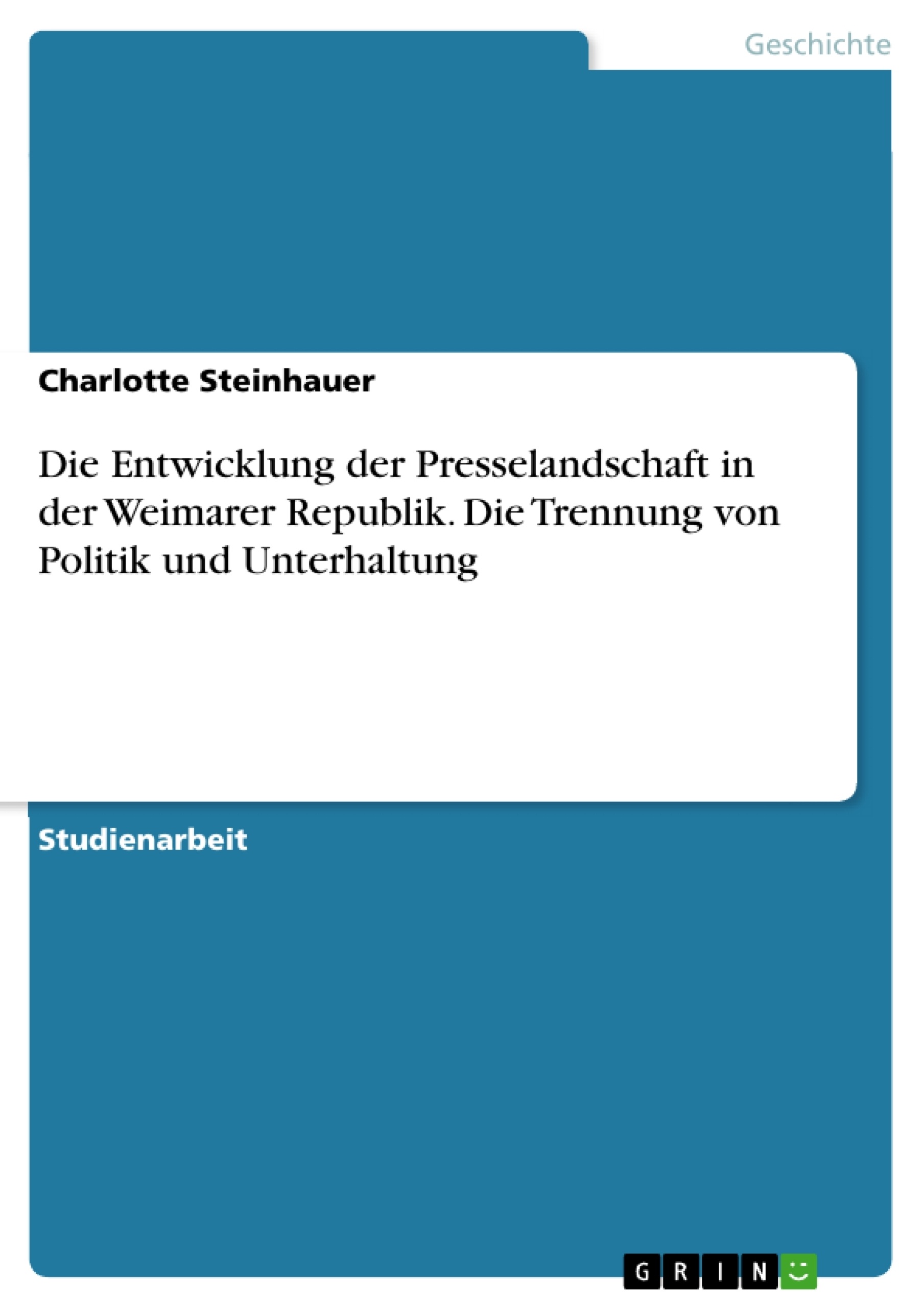Die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg war nicht nur eine Zeit ökonomischer wie auch gesellschaftlicher Veränderungen in Deutschland, auch das Zeitungswesen erfuhr während der sich anschließenden Weimarer Republik einen tiefgreifenden Wandel. So wie sich die Gesellschaft, besonders in der wachsenden Metropole Berlin, zu einer starken Konsumorientierung hin entwickelte, durchlief auch die Tagespresse eine Kommerzialisierung. In dieser Zeit wurde die Zeitung zum Massenmedium und diente nicht mehr der reinen politischen Information eines begrenzten Leserpublikums, sondern der Unterhaltung eines breiten Publikums.
Zwei Tendenzen werden bei der näheren Betrachtung der Tagespresse in der Weimarer Republik deutlich. Zum einen ein steigendes Bedürfnis nach der stets aktuellsten Information sowie nach Ablenkung und Unterhaltung. Dies äußerte sich in der Entstehung neuer Arten von Tageszeitungen, bereits zu Beginn des Jahrhunderts und deren zunehmende Popularität während der folgenden Jahrzehnte. Der Generalanzeiger und das Boulevardblatt setzten sich als dominante Vertreter der täglich erscheinenden Printmedien durch, während es zu einem Rückgang der Auflagen von parteipolitischer Presse kam. Zum anderen zeigt sich jedoch eine steigende Politisierung der auf den ersten Blick damit als unpolitisch erscheinenden Tagespresse.
Die vorgestellten Charakteristika der Presselandschaft zur Zeit der Weimarer Republik leiten auch zu deren Problemstellung. Die zeitgenössische Tagespresse befand sich in einem Spannungsverhältnis zwischen Politik und Unterhaltung. Dieses Verhältnis soll in der hier eingeleiteten Arbeit näher beleuchtet werden. Während die bereits vorliegende Forschung dieses Themenbereichs meist eine einseitige Konzentration, entweder auf die politische Wirkung der Presse oder auf deren unpolitisches Moment, aufweist, soll in dieser Seminararbeit der Frage nachgegangen werden, inwieweit eine solche klare Trennung von Politik und Unterhaltung in der damaligen Tagespresse zu finden ist.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DARSTELLUNG DER PRESSELANDSCHAFT, NÄHER DER TAGESPRESSE IN DER WEIMARER REPUBLIK
- ALLGEMEINE ENTWICKLUNGSTENDENZEN DER TAGESPRESSE ZU BEGINN DES 20. JAHRHUNDERTS UND DEREN AUSFORMUNG IN DER WEIMARER REPUBLIK
- DIE ENTWICKLUNG DES GENERALANZEIGERS ZUM DOMINANTEN ZEITUNGSMEDIUM
- DAS BOULEVARDBLATT ALS JÜNGSTE FORM DER MASSENZEITUNG
- KRISE DER PARTEIPOLITISCHEN PRESSE
- ,,UNPOLITISCHE“ PRESSE VS. „POLITISCHE“ PRESSE?
- VERSCHIEBUNGEN DER MACHTSTRUKTUREN AUF DEM ZEITUNGSMARKT
- ZUNEHMENDE POLITISCHE INSTRUMENTALISIERUNG DER TAGESPRESSE
- SUCHE NACH NEUEN VERMITTLUNGSFORMEN: TENDENZEN DER KOMMERZIALISIERUNG DER PARTEIPOLITISCHEN PRESSE
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und den Besonderheiten der Tagespresse in der Weimarer Republik. Sie untersucht die Spannung zwischen dem wachsenden Bedürfnis nach Unterhaltung und der politischen Instrumentalisierung der Zeitungen.
- Kommerzialisierung der Tagespresse
- Entwicklung neuer Zeitungstypen (Generalanzeiger und Boulevardblatt)
- Rolle der parteipolitischen Presse
- Politische Instrumentalisierung der Medien
- Spannungsverhältnis zwischen Politik und Unterhaltung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Entstehung der Tagespresse als Massenmedium in der Weimarer Republik. Die technischen Neuerungen und die zunehmende Alphabetisierung der Bevölkerung führten zu einer breiten Verbreitung von Zeitungen.
Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die beiden dominanten Zeitungstypen: den Generalanzeiger und das Boulevardblatt. Während der Generalanzeiger als seriöses Nachrichtenmedium etabliert war, zeichnete sich das Boulevardblatt durch seinen fokus auf Sensationsnachrichten und Unterhaltung aus.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Entwicklung der parteipolitischen Presse in der Weimarer Republik. Die politische Instrumentalisierung der Tagespresse durch private Investoren und die Suche nach neuen Vermittlungsformen im Angesicht der zunehmenden Kommerzialisierung stehen im Mittelpunkt.
Schlüsselwörter
Tagespresse, Weimarer Republik, Kommerzialisierung, Generalanzeiger, Boulevardblatt, politische Instrumentalisierung, Unterhaltung, Massenmedium, Marktentwicklung.
- Quote paper
- Charlotte Steinhauer (Author), 2016, Die Entwicklung der Presselandschaft in der Weimarer Republik. Die Trennung von Politik und Unterhaltung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/979834