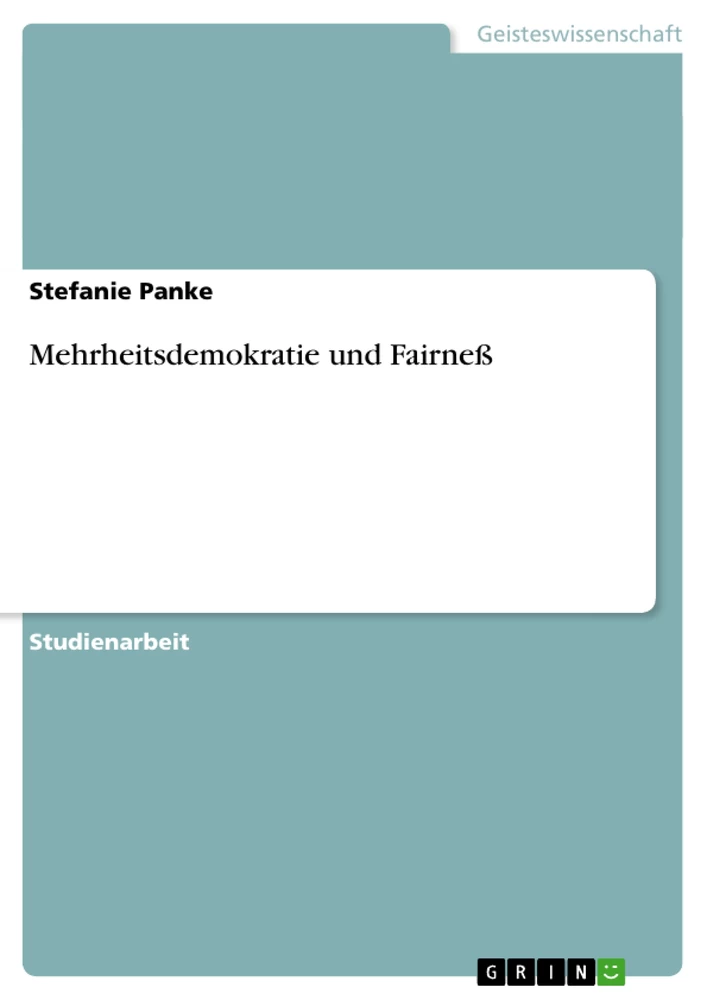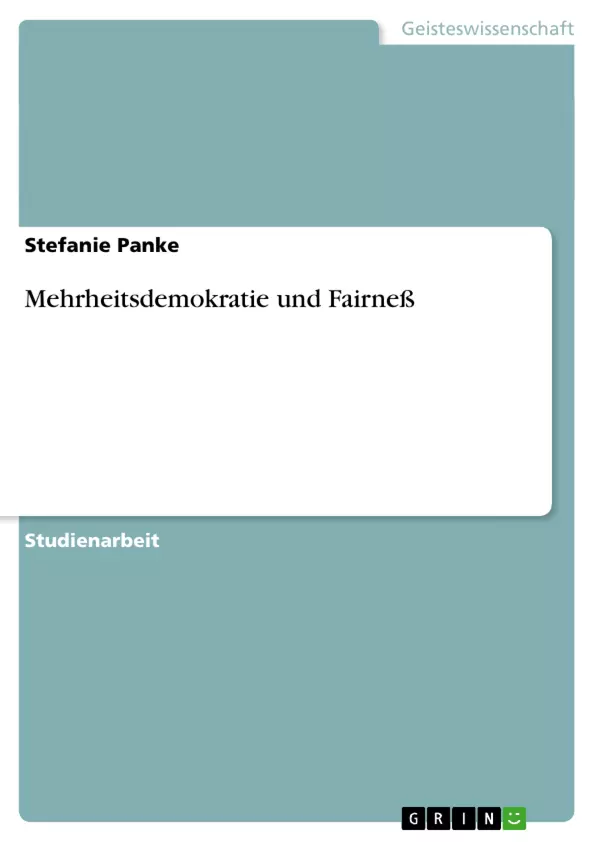Mehrheitsdemokratie und Fairneß
1. Demokratietheorie
1.1 Richtungen der Demokratietheorie
Es gibt zwei Möglichkeiten Demokratietheorie zu betreiben1:
Die empirische und die normative Sichtweise,2 wobei erstere einen deskriptiven Weg einschlägt, der sich am Ist-Zustand, dem faktisch Vorhandenen orientiert, während die normativen Demokratietheorien sich auf das Ideal beziehen, welches in der in der etymologischen Wortbedeutung des Begriffs „Demokratie“ ausgedrückt ist: Demos: das Volk und kratheion: herrschen.3
Wer Demokratie als wahrhaftige Volksherrschaft versteht, ist gezwungen, festzustellen, daß die Realität nicht jetzt und nicht in Zukunft dem Ideal entspricht und entsprechen kann.4
Hierin muß aber kein Beweggrund liegen, sich von einer normativen Betrachtungsweise abzuwenden: Ein kritischer Abstand zum Gegebenen kann durchaus wünschenswert und fruchtbar sein, statt in resignierter Abwendung zu münden.
Gleichzeitig sollte man aber das tatsächlich Vorhandene nicht gänzlich außer Acht lassen, da man sonst Gefahr läuft, normative Grundsätze zu entwickeln, die nichts mit den Faktoren, die in einem demokratischen Staat bestimmend und für seine Gestaltung notwendig sind, gemein haben.
Die empirische Herangehensweise hat Schwächen, die in genau gegenteiliger Richtung zu denen der normativen liegen:
Verfällt man ins Extrem, kann eine schlichte Rechtfertigungstheorie des Bestehenden die Folge sein. Nicht umsonst wird der Gegensatz von Normativität und Deskription, oft als die klassische Demokratietheorie, welche eine möglichst hohe Partizipation fordert, gegenüber der Konkurrenztheorie5, die nach Möcklin letztlich die Elitenherrschaft proklamiert, verstanden.
Die empirische Demokratietheorie bezieht ihre Daten aus Untersuchungen des Wählerverhaltens, der Partizipation oder der Parteien.
Berücksichtigen sollte man, daß empirische Demokratietheorie (oder auch normative Demokratietheorie mit empirischen Elementen) sich auf die Situation und das Selbstverständnis der Kernländer der Demokratie, d.h. „die westlichen Länder“ beziehen. Auch hier unterscheiden sich die Ausrichtungen:
Das Volk, welches zumindest theoretisch, gemäß dem Grundsatz der Volkssouveränität,6 als Träger der Staatsgewalt angesehen wird, teilt seinen Willen in Mehrheitsentscheidungen mit. Dies geschieht entweder unmittelbar und wird als direkte Demokratie bezeichnet, wie z.B. in einigen schweizerischen Kantonen praktiziert, oder mittelbar, durch die Wahl von Abgeordneten zur Volksvertretung, was eine repräsentative Demokratie ergibt.7
Die erste Variante entspricht zwar mehr dem demokratischen Ideal, wie es im 5/4 Jh. v. Chr.
In Athen gelebt wurde, die letztere Variante ist aber die heute gebräuchlichste, u.a. aus Gründen der Output-Effizienz, der die Systeme auf Grund ihrer Größe bedürfen.
1.2 Demokratiekritik: Partizipatorische Demokratietheorie versus Elitenherrschaft
Die Kritik an der Demokratie in ihrer heutigen Form läßt sich auf zwei Grundströmungen reduzieren8: Die eine Richtung konstatiert einen Mangel an Demokratie und fordert eine Öffnung des Demokratischen Raums, d.h. eine Demokratisierung größerer Gesellschaftsbereiche, sowie eine stärkere Beteiligung der „breiten Masse“ an politischen Themen, während die entgegengesetzte Strömung eine Beschränkung der Entscheidungsgewalt der Bevölkerung und die Konzentration von Macht auf eine fähige, spezialisierte Elite propagiert. Beide Theorien beruhen auf einer Infragestellung des demokratischen Jetzt-Zustands, also auf der Annahme, daß die derzeitigen Formen von Demokratie nicht zukunftsfähig sind, oder beziehungsweise bereits heute die gestellten Aufgaben nicht in befriedigendem Maße erfüllen können.
Die hier vorgestellten Überlegungen werden auch für die Auseinandersetzung mit der Zukünftigkeit heutiger politischer Entscheidungen und dem Interessenskonflikt gegenüber kommenden Generationen von Bedeutung sein (Abschnitt 3.2), da als eine Form der Elitenherrschaft die „Ökodiktatur“ anzusehen ist. Diese wird immer dann als unumgänglich dargestellt, wenn eine Sensibilisierung der Gesellschaft für ökologische Themenbereiche mißlingt, da z. B. Themen wie Arbeitslosigkeit oder stagnierender Wohlstand höher gewertet werden und/oder jegliches Interesse fehlt, weil beispielsweise die Medienpräsenz zu gering oder die Thematik zu komplex ist.
Wie das angeführte Beispiel und das folgende Schaubild verdeutlichen, geht es letztlich um die Frage, ob unter den heutigen Umständen die Partizipation möglichst vieler Bürger weiterhin ein tragender Bestandteil des demokratischen Systems sein kann.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das„Nicht-Funktionieren“von Demokratie läßt sich aus unterschiedlichen Quellen belegen. Zu nennen sind Phänomene wie Politikverdrossenheit, insbesondere die Wahlmüdigkeit vieler Bürger, sowie ein allgemeines tendenzielles Mißtrauen gegen die Integrität und Befähigung von Politikern. In der grundlegendsten Form ist es der Zweifel, ob die Politik, speziell im Zuge der Globalisierung, welche eine Entmachtung der Nationalstaaten zur Folge hat, in der Lage ist, anstehende Probleme zu lösen. Oft wird die Problembeseitigung, etwa der Arbeitslosigkeit höher bewertet als das Recht und die Möglichkeiten der Partizipation und Gewaltenkontrolle im demokratischen Staat. All dies scheinen Indikatoren für den Verfall der Demokratie in ihren Kernländern, also Europa und Nordamerika, zu sein.
Eine echte Demokratie ist, im Gegensatz zu Scheindemokratien und wie auch immer gearteten Diktaturen, ein offenes System und sollte durch Wandel auf veränderte Bedingungen reagieren können. Besonders die empirische Demokratietheorie sieht in den genannten Beobachtungen zum Umgang der Bevölkerung mit ihren Möglichkeiten des politischen Engagements und der Mindestpartizipation durch Wahlbeteiligung Gründe anzunehmen, daßbei der Mehrheit kein Interesse an Politik vorhanden ist. Als Konsequenz wird dann zumeist„Demokratische Elitenherrschaft“propagiert. Ein sehr starkes Argument hierfür ist, daßman erstens niemandem durch Zwang für Demokratie gewinnen kann9, und zweitens jeder das Recht hat sein Privatleben oder andere Eigeninteressen höher zu bewerten,10 zumal sich dies für die betreffende Person höchstwahrscheinlich stärker lohnen wird. Politische Partizipation ist keinesfalls der Königsweg zur aktiven Gestaltung, bzw. Verbesserung, konkreter Lebensbedingungen im Hinblick auf die konkurrierenden Gestaltungsmöglichkeiten in Beruf, Familie oder Freizeit. Die partizipatorische Demokratietheorie, welche sogar den Kreis der Stimmberechtigten vergrößern11 und die Beteiligung der Bürger im Hinblick auf Aussprache, Willensbildung und Entscheidungüberöffentliche Angelegenheiten intensivieren und erweitern will, scheint angesichts dieser Tatsachen zu scheitern.
Ebenfalls zugunsten einer Elitenherrschaft angeführt wird eine gewisse Ineffizienz des demokratischen Systems, d.h. die Dauer von Entscheidungen, die natürlich um so höher ist, je mehr Personen beteiligt sind. So erfordert eine Volksabstimmung einen immensen bürokratischen Aufwand, während eine Expertenkommission schnell und ohne lange Verwaltungswege und somit unter Verursachung geringerer Kosten Beschlüsse fassen kann.
Hinzu kommt, daßdem Urteil letzterer oft größere Kompetenz zugestanden wird, ob sie nun demokratisch legitimiert ist oder nicht.
Warum sollte es ein Staat also auf sich nehmen, längere Entscheidungswege, höhere Kosten und ein unter Umständen weniger qualifiziertes Ergebnis in Kauf zu nehmen, wenn noch nicht einmal von Seiten der Bürger ein intensives Interesse an ihrem Mitbestimmungsrecht besteht? Demokratische Elitenherrschaft macht sich diese Argumente zu eigen.
Ebensogut jedoch läßt sich so die Kritik an zuwenig Demokratie begründen:
Desinteresse an der Politik kann auch durch geringe Einflußmöglichkeiten hervorgerufen werden, ebenso wie durch Korruption, Mißwirtschaft und die Kluft zwischen Regierenden und Regierten.
An dieser Stelle möchte ich zwei Begriffe einführen, welche meiner Meinung nach gut geeignet sind, um die Bedingungen, unter denen die oben beschriebenen Mißstände vermieden werden können, zu charakterisieren: Zum einen das„vertikale Vertrauen“, welches zwischen Bürgern und Politikern bestehen sollte, zum anderen das„horizontale Vertrauen“, was unter den Mitgliedern der Gesellschaft herrschen sollte. Ein Beispiel für die Notwendigkeit des zweiten Vertrauens ist unter anderem, daßkrasse soziale Unterschiede sich immer wieder zu Belastungsproben für die Demokratie entwickeln. Beides hängt eng mit der Anwendung der Mehrheitsregel zusammen, welche ich im Abschnitt 2 näher behandeln werde.
Das gegenseitige Vertrauen unter den Mitgliedern einer Gesellschaft und damit auch sozialer Ausgleich ist nur dann möglich, wenn die Eigeninteressen des Einzelnen zu einem gewissen Grad zurückgestellt werden.
Dies mußnicht die Verfolgung eines Gemeinwohls in Rousseaus Sinn bedeuten, sondern kann einfach ein gesteigertes Interesse am Anderen in der Gesellschaft sein. Elitenherrschaft läuft leicht Gefahr Schwächere zu vernachlässigen, da ihre Chancen und Interessen in größeren Zusammenhängen oft nicht ins Gewicht fallen, zum Beispiel sind sie auf Grund mangelnder Kaufkraft kein Wirtschaftsfaktor, oder wegen mangelnder politischer Organisation scheinbar keine Bedrohung für das Gesamtsystem. Jedoch besteht die gleiche Gefahr, wenn nicht sogar in noch stärkerem Maße, für direktere Demokratie, bzw. ergibt sie sich zwangsläufig aus der Anwendung der Mehrheitsregel. Die Gefahr, daßrücksichtslose Entscheidungen getroffen werden, wächst mit der Ignoranz der Bürger gegenüber den Lebensumständen anderer. Ein höheres Maßan Partizipationschancen kann dem entgegenwirken, da die Möglichkeit Entscheidungen zu treffen auch ein Anreiz ist sichüber eventuelle Mißstände, die einer Neuregelung bedürfen, zu informieren. Ein Beispiel für eine vorstellbare Art der Einbindung möglichst vieler in politische Entscheidungsprozesse ist das Engagement in Bürgerinitiativen. Da die Thematik eingeschränkt ist und unmittelbare Betroffenheit besteht, fällt den meisten Bürgern der Schritt zur politischen Aktivität hier relativ leicht, im Gegensatz zum Beitritt in eine Partei. Die reine Repräsentativdemokratie ist demzufolge, wenn man eine möglichst hohe Partizipation als Input-Legitimation des Systems für wünschenswert hält, allein keine befriedigende Demokratieform. Man kann zwar dem demokratischen Ideal, daß„alleüber alles entscheiden“nicht entsprechen, aber dort, wo Interesse besteht, z. B. auf kommunaler Ebene, die Mitbestimmung durch Verfahren der direkten Demokratie (Volksabstimmungen, Bürgerbefragungen) erleichtern, bzw. erhöhen. Ein weiterer wichtiger Grund, reine Elitenherrschaft abzulehnen, ist die Möglichkeit der Manipulation einer schlechter informierten und politisch unter Umständen wenig orientierten Masse. Schränkt man beispielsweise die Anzahl der Wahlen oder Abstimmungen ein, um der regierenden Partei eine konsistente Politik zu ermöglichen, begünstigt man die Entstehung von Filz, d.h. die Verquickung von Sonderinteressen und politischen Entscheidungen, sowie zu einer zunehmenden„Politikverdrossenheit“bei der Mehrheit der Bürger, welche sich dann wiederum in einer sinkenden Wahlbeteiligung spiegelt.
Dieser Prozeßführt zu einer zunehmenden Entdemokratisierung12, ohne eine fairere, kompetentere Politik zu gewährleisten.
In der Komplexen Demokratietheorie sieht Scharpf13 die Möglichkeit trotz der Tatsache, daß die politische Beteiligung aller Bürger am Entscheidungsprozeß kein praktikables Prinzip ist, der Bedeutung des Partizipationspostulats für die normative Demokratietheorie gerecht zu werden. Hierzu sieht Scharpf drei Ebenen an möglichen Anwendungsbereichen:
1. Da die politische Beteiligung der großen Mehrheit kaum über die Teilnahme an allgemeinen Wahlen hinausgeht, besteht eine mögliche Maßnahme darin, das Gewicht der Wahlentscheidungen zu erhöhen.
2. Die Wege zur aktiven Gestaltung im politischen System, die über die bloße Wahlbeteiligung hinausgehen, sollten offengehalten bzw. erleichtert werden. Die Möglichkeiten zur aktiven Partizipation sollte jeder der fähig und bereit ist, mit gleichen Chancen nutzen können.
3. Solche Bereiche der Gesellschaft in denen der Partizipationsgedanke sinnvoll erscheint, sollten der Demokratisierung unterworfen werden.
1.3 Die Bedeutung von Demokratie
Der Artikel 20 Absatz 1 des Grundgesetzes lautet: „Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.“
Der Artikel 1 Absatz 1 der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 6. April 1949 lautet: „Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern. Sie ist die politische Organisation der Werktätigen in Stadt und Land unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei.“ Die beiden Auszüge aus den Verfassungen der Bundesrepublik Deutschland und der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik nehmen für sich in Anspruch, Demokratien zu sein, obwohl ihre zugrundeliegenden Konzeptionen völlig unterschiedlich sind. Hierin zeigt sich das Problem der formalen Demokratisierung, bzw. der durch formal-demokratische Wahlen legitimierten Politik (Scheindemokratien). Es existieren kaum Länder, die offen aussagen, ihre Haltung sei antidemokratisch.
Machthaber nutzen die Demokratie und damit das Mehrheitsprinzip als mächtiges Legitimationsinstrument von Regierungen und deren Entscheidungen ohne beispielsweise die Pluralität von Eliten zuzulassen, ohne den Bürgern Rechtssicherheit zu bieten in Form von rechtsstaatlichen Institutionen und Grundfreiheiten und ohne liberales Gedankengut (im weiteren Sinne) zu vertreten, oder auch überhaupt nur zuzulassen.
Die Aufgabe einer Definition von Demokratie sollte es also sein, Kriterien zu enthalten, die demokratische und undemokratische Systeme klar voneinander trennen.
Wobei: Auch ein im Ganzen gesehen demokratisches System kann teilweise undemokratische Züge haben. Diese sollten durch die Definition des Begriffs ebenfalls aufgezeigt werden. Die Beurteilung solcher Elemente eines Staatsgebildes orientiert sich daran, ob es demokratiefeindliche Strukturen sind, die in krassem Widerspruch zu den Grundgedanken der Demokratie stehen, wie sie durch die Lincolnsche Formel14 „Regierung des Volkes durch das Volk für das Volk“, oder ob sie einfach in den Schwierigkeiten und Hindernissen der praktischen Umsetzung der demokratischen Idee zu sehen sind.
Hinweise darauf, ob ersteres oder letzteres zutrifft, kann nur die empirische Demokratietheorie liefern.
Vor dem Hintergrund dieser Darstellung von Erwartungen, die an eine Definition von Demokratie zu stellen sind, untersuche ich im Folgenden Definitionsversuche und bemühe mich letztlich eine eigene Position zu finden.
1.4 Bobbios Minimaldefinition von Demokratie
Bobbio15 bemüht sich, Demokratie weitgehend wertfrei als eine Methode der Entscheidungsfindung und -legitimation zu definieren. Hierzu stellt er zwei hinreichende und eine notwendige Bedingung auf, sowie eine Vorab-Voraussetzung.
Bei der Betrachtung demokratischer Systeme16 stellen sich demgemäß zunächst drei Fragen:
1) Wer entscheidet?
Wer ist zur Teilnahme an den kollektiven Entscheidungen berechtigt ?
2) Nach welchen Regeln?
Mit welchem Verfahren wird die Entscheidung gefällt?
3) Welche Wahl hat man?
Stehen die zur Entscheidung Aufgerufenen vor realen Alternativen ?
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
In einer Demokratie würde die Beantwortung dieser drei Fragen wie folgt aussehen:
Möglichst Viele (1) entscheiden nach dem Mehrheitsprinzip (2) und haben dabei verschiedene Entscheidunsalternativen (3) und die Chance der freien Meinungsbildung. Punkt drei soll vermutlich dem Ausschluß von Scheindemokratien dienen. An das dritte Kriterium schließt sich die Vorab-Voraussetzung der Rechtsstaatlichkeit17 an: „Damit nun die Bedingung verwirklicht werden kann, müssen den zur Entscheidung Berufenen die sogenannten Freiheitsrechte garantiert sein: Meinungs- und Ausdrucksfreiheit, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit.“18
Bobbios Kriterien definieren Demokratie als graduell abstufbar. Ob dies möglich ist, scheint eine prinzipielle Frage zu sein, die wieder auf den Unterschied zwischen empirischer und normativer Demokratietheorie zurückverweist.
Ich tendiere eher dahingehend zu sagen, daß entweder ein Staat demokratisch organisiert ist, oder eben nicht. Die Abstufungen, die zwischen den verschiedenen Staaten, die sich als demokratisch begreifen, bestehen, liegen in einer anderen Umsetzung der demokratischen Idee in ein reales System begründet.
Wenn von mehr oder weniger demokratischer Organisation gesprochen wird, handelt es sich meist um die Länge der Legitimationsketten, die gemeint ist. Direkte Demokratie auf kommunaler Ebene erscheint uns im allgemeinen „demokratischer“ als die Ernennung einer EU-Komission.
Dieses „mehr oder weniger“ an Demokratie ist aber in keiner Weise mit dem zu vergleichen, was Bobbio mit seiner Minimaldefinition aussagt.
Ungeachtet dessen hat Bobbios Definition den Vorteil kurz und knapp Auskunft über den Einund Ausschluß von Phänomenen zu geben.
Besonders das letzte Kriterium ist, verbunden mit der Vorab-Bedingung eines Rechtsstaats, der jedem Bürger die Grundfreiheiten zusichert, gut dazu geeignet, um zu prüfen, ob die Wahl der zur Entscheidung Berufenen tatsächlich frei ist.
Manipulation durch Propaganda in den Medien könnte durch dieses Kriterium ebenso aufgegriffen werden wie ein „unsauberer“ Wahlkampf, da beide dem Bürger vorgaukeln, daß keine Alternativen zu der vorgegebenen Linie bestehen.
Die Anwendung der Mehrheitsregel - das zweite Kriterium - scheint ein Grundbestandteil von Demokratie zu sein. Ob und warum dies so ist, sowie welche Probleme damit verknüpft sind, behandele ich ausführlicher in Abschnitt 2.
An dieser Stelle möchte ich nur darauf hinweisen, daß eine Anwendung des Mehrheitsprinzips, ohne Minderheitenschutz vorzusehen, die demokratischen Spielregeln entschieden verletzen würde und in einer Tyrannei der Mehrheit19 enden könnte. Bobbios erstes Kriterium zur Definition von Demokratie, welches besagt, daß der Kreis der mit Entscheidungsmacht Ausgestatteten möglichst groß sein sollte, ist gleichsam sein schlechtestes. Die Behauptung ,„daßeine Gesellschaft, in der alle männlichen Erwachsenen stimmberechtigt sind, demokratischer ist als eine Gesellschaft in der nur die Eigentümer das Stimmrecht besitzen, und weniger demokratisch als eine Gesellschaft, in der auch Frauen stimmberechtigt sind“ erscheint mir nicht haltbar, da es dem egalitären Charakter von Demokratie widerspricht. Heute wird Demokratie oft in Bezug zu der Einhaltung der Menschenrechte gesehen. Ein Staat, der die Menschenrechte mit Füßen tritt, kann intuitiv nicht als Demokratie gelten. Nicht wählen zu dürfen, bedeutet nicht als mündige Person anerkannt zu werden. Geschieht diese Benachteiligung auf Grund von „Rasse, Religion, Herkunft oder Geschlecht“ ist es ein Verstoß gegen diese Rechte.
Es ist zwar durchaus klar, daß Volkssouveränität ein theoretischer Begriff und juristische Fiktion ist, aber trotzdem ist vom „Volk“ die Rede nicht von Schichten oder Teilen des Volkes, von ethnischen oder religiösen Gruppen oder einem bestimmten Geschlecht.
Da es das Volk als homogene Einheit, als polis aus der Zeit der ersten „Demokratie“20 in Athen nicht mehr gibt, muß der Begriff Volk als Masse von mit gleichen, unveräußerlichen Rechten ausgestatteten Personen verstanden werden.
Die Beteiligung an Wahlen und der Zugang zu den zur Entscheidungsfindung nötigen Informationen muß jedem ebenso offenstehen, wie auch die Chance für öffentliche Ämter zu kandidieren oder auf anderen Wegen zu versuchen die eigenen politischen Vorstellungen bekannt zu machen um für diese zu werben, z.B. in Bürgerinitiativen. Das Demokratiekriterium der politischen Gleichheit aller Bürger bedeutet für das Wahlrecht, daß es gerechterweise jedem zusteht der willens ist es zu nutzen und vom Gesetz als voll verantwortlich für seine Entscheidungen angesehen wird, d.h. volljährig und geistig gesund ist.
Außerdem muß er von den Konsequenzen seiner Entscheidung auch betroffen sein, was Durchreisende ausschließt. (Kongruenzprinzip)
Ebenfalls ausgeschlossen vom Recht auf Partizipation durch Wahlbeteiligung ist derjenige, dem seine Zugehörigkeit zur Gesellschaft auf Grund groben Fehlverhaltens zeitweilig entzogen wurde: Kriminelle haben kein Wahlrecht.
Diese Bedingungen für das Recht Wählen zu dürfen sind keineswegs willkürlich, sondern folgen rationalen Überlegungen. Somit ist Bobbios Argument, auch in einer idealen Demokratie habe nicht jeder das Wahlrecht, daher könne das allgemeine Wahlrecht kein Kriterium für Demokratie sein, entkräftet.
Eine eigenständige Arbeitsdefinition des Demokratiebegriffs könnte, als Zusammenfassung meiner vorhergehenden Überlegungen, folgendermaßen lauten:
Demokratie ist die Anwendung der Mehrheitsregel bei freien, gleichen und geheimen Wahlen, die nach gründlicher Erörterung der zur Entscheidung stehenden Problematik in der Öffentlichkeit stattfinden und deren Ergebnis kollektiv verbindliche Entscheidungen, sofern diese mit dem Schutz der Minderheit und dem Fortbestand des Rechtsstaats in Einklang stehen, legitimiert.
Was hier vorgestellt wird, ist ebenfalls eher eine Minimaldefinition, da die Wahl allein eine Mindestform der Partizipation durch die Bürger ist.
Ob es sich um eine Wahl von Alternativen oder Repräsentanten handelt, ist in der Definition nicht festgelegt. Damit sind direkte und repräsentative Demokratie gleichberechtigt. Eingeschränkt wurde der Geltungsbereich des Mehrheitsprinzips so, daß er dem in Abschnitt 2.3 beschriebenen Grundwertkonsens entspricht.
Eine nicht nur gründliche, sondern auch sachliche Erörterung der Wahlthemen in der Öffentlichkeit wäre dem Ideal von Demokratie eher entsprechend, läuft aber den Realitäten eines Wahlkampfes völlig zuwider und wäre dementsprechend ein ausschließlich normativer Grundsatz.
2. Das Mehrheitsprinzip
2.1 Legitimationsprobleme
Kaum etwas ist mit dem Begriff der Demokratie so eng verknüpft, wie das Prinzip der Mehrheitsentscheidung. Es kann heute als der zentrale Entscheidungsmodus innerhalb der demokratischen Willensbildung angesehen werden.
Das gesamte System der Demokratie kann jedoch nicht auf eine Verfahrensregel reduziert werden, wie ich im vorangegangenen Abschnitt zur Demokratiedefinition gezeigt zu haben hoffe. Trotzdem besitzt das Mehrheitsprinzip weitreichende Bedeutung für die demokratische Gesellschaft und birgt, auch wenn es zunächst als unmittelbar einleuchtende Möglichkeit der Entscheidungsfindung und Dissensüberwindung erscheint, zahlreiche Ansätze für Probleme, u.a. auch der Legitimation.
Eine Definition von Mehrheit Mehrheit ist eine eindeutige Verhältnisbestimmung zwischen Zahlengruppen, wobei der jeweils wenigstens um eins den Rest eines Zahlenganzenübertreffende Teil die Mehrheit ist.21
In der Legitimation von Mehrheitsentscheidungen ergeben sich mehrere Probleme.
Das erste liegt schon in der Definition von Mehrheit begründet: Wie kann man in und vor einem demokratischen System die Möglichkeit rechtfertigen, daß eine wichtige Entscheidung zugunsten einer Mehrheit, die mit nur einer Stimme gegenüber der Minderheit überlegen ist, gefällt wird?
Aus diesem Grund gibt es mehrere Arten von Mehrheit (insgesamt vier)22:
a) Die relative Mehrheit
Diese stellt die geringsten Anforderungen: Diejenige von mehreren Alternativen gilt als gewählt, die vergleichsweise die meisten Stimmen erhalten hat, unabhängig von dem Prozentsatz der gewonnenen Stimmen im Verhältnis zur Gesamtheit der Abstimmenden.
b) Die einfache Mehrheit
Sie zeichnet sich dadurch aus, daß ausschließlich Ja- und Nein-Stimmen zur Ermittlung der Entscheidungsmehrheit herangezogen werden. Der Beschluß kommt zustande, sobald die Anzahl der Ja-Stimmen die der Nein-Stimmen um eins übersteigt, wobei Enthaltungen nicht gezählt werden.
c) Die absolute Mehrheit
Sie läßt sich bei zwei oder mehr Alternativen folgendermaßen ermitteln: Die Anzahl der für eine Alternative abgegebenen Stimmen muß mindestens um eins höher sein als die Hälfte der zugrundeliegenden Zahlenganzheit, gleichgültig welche Art der Zahlenganzheit im voraus festgesetzt wird.
d) Die qualifizierte Mehrheit
Da sie die höchste Anforderung stellt, wird sie bei wichtigen Entscheidungen, wie Verfassungsänderungen, in Form einer Zweidrittelmehrheit angewandt.
Durch die qualifizierte Mehrheit wird das Mehrheitserfordernis näher an die Einstimmigkeit gerückt, was die Erhaltung des status quo begünstigt und somit Minderheiten schützt.
Je wichtiger eine Entscheidung ist, d.h. je grundlegender die Fragestellung ist und je weitreichender die Konsequenzen sind, desto höher fallen die Anforderungen für eine Mehrheitsentscheidung aus.
So wird versucht, die Willkürlichkeit aus der Abstimmung zu nehmen, indem bei wichtigen Entscheidungen die Hürden für jede Partei bzw. Alternative möglichst groß sind, ohne Stagnation hervorzurufen. Das Mehrheitsprinzip hat gegenüber der Einmütigkeitsregel den Vorzug, daß Blockierungen vermieden und trotzdem große Kollektive beteiligt werden können. Denn: Auch keine Entscheidung kann eine Entscheidung bedeuten. Es gibt aber Bereiche des gesellschaftlichen Lebens, die zum „Unentscheidbaren“ erklärt sind, wie die in allen liberalen Verfassungen formulierten Grund- und Menschenrechte. Ihre Unantastbarkeit wird durch keinen Mehrheitsbescheid in Frage gestellt.23 Ein weiteres Legitimationsproblem bei der Anwendung des Majoritätsprinzips liegt darin, daß es, als technisches Verfahren, keine Möglichkeit hat, die Intensität von Entscheidungen in Betracht zu ziehen. Es gilt Stimmgleichheit: „one man, one vote“. So kann eine hochmotivierte politische Minderheit, einer größtenteils gleichgültigen, an dem Thema desinteressierten Mehrheit unterliegen. Anders formuliert: Die Mehrheitsregel ist ein rein quantitativ operierender Mechanismus zur Entscheidungsfindung und -Legitimation und somit qualitativen Unterschieden gegenüber unsensibel.
In diesem Zusammenhang steht eine weitere Schwierigkeit: Oft wird die demokratische Legitimität einer Entscheidung durch das Mehrheitsprinzip an eine vorangegangene öffentliche Diskussion geknüpft. Was ist mit Entscheidungen, die nicht getroffen werden, weil ihre zugrundeliegende Problematik keiner breiten Öffentlichkeit bekannt ist? Die durch die Medien zugänglichen Informationen zeigen nur einen verzerrten Ausschnitt aus der Wirklichkeit und sind trotzdem die Grundlage der öffentlichen Meinung. Ein Beleg für diese Tatsache ist das zum Teil verzweifelte Bemühen ethnischer oder politischer Minderheiten, wie der türkischen Kurden, Aufmerksamkeit für ihre Situation zu gewinnen - und die Aussichtslosigkeit dieser Bemühungen sind, wenn andere Themen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit beschäftigen.
Die Rolle der neuen Medien, wie des Internets, bei der politischen Meinungsbildung ist ein zweischneidiges Schwert: Den fast unbegrenzten Möglichkeiten der individuellen Informationsbeschaffung stehen viele unseriöse, da unkontrolliert mit Fehlinformationen propagandistisch arbeitenden, Quellen gegenüber.
Die Mehrheit und der Mehrheitswille ist also fehlbar und verführbar24. Dieser klassische Kritikpunkt ist ein Relikt aus den Zeiten, als Volksherrschaft noch unpopulär war ( und eher im Sinne der aristotelischen Pöbelherrschaft aufgefaßt wurde).
So urteilt Goethe abfällig: „Nichts ist widerwärtiger als die Majorität; denn sie besteht aus wenigen kräftigen Vorgängern, aus Schelmen, die sich akkomodieren, aus Schwachen, die sich assimilieren, und der Masse, die nachtrollt, ohne nur im mindesten zu wissen, was sie will.“25
Darüber hinaus ist der Wille der Mehrheit kein verfälschungsfrei zu ermittelnder Wert, da nicht nur Zeitpunkt, sondern auch Art und Weise der Abstimmung einen nicht unerheblichen Anteil am Ergebnis haben:
2.2 Paradoxien des Mehrheitsprinzips
26 1) Das Condorcet-Paradox
Das Condorcet- Paradoxon beschreibt den Fall der sogenannten wandernden oder zyklischen Mehrheiten, die durch die Auswahl der Abstimmungsalternativen entstehen können. Bsp.: Die Gesamtheit der Wähler umfaßt drei gleichstarke Interessensgruppen, die als Wählergruppe 1, 2 und 3 bezeichnet werden. Diese entscheiden über die alternativen politischen Programme A, B und C.
Die Wählergruppen haben folgende Präferenzen27: Gruppe 1: A>B>C
Gruppe 2: B>C>A Gruppe 3: C>A>B
Welche der drei Varianten A, B, und C die Mehrheit erringt, richtet sich danach, welche Paare einander zur Auswahl gegenübergestellt werden:
Im Fall einer Abstimmung A gegen B erhält A eine Zweidrittelmehrheit. Wird über die Alternativen B und C abgestimmt, gewinnt B ebenfalls 2:1. Bei den Varianten C gegen A, erzielt C die (qualifizierte) Mehrheit.
Was in einem solchen Fall der „Volkswille“ ist, bleibt aus folgendem Grund unerkennbar: Würden alle Varianten zur Wahl gestellt, herrschte Stimmgleichheit, eine Situation die nicht durch das Mehrheitsprinzip gelöst werden kann. Diese Funktion kann nur der gesellschaftliche Diskurs erfüllen.
2) Das Ostrogorski-Paradox (nach Offe)28
Im Fall des Ostrogorski Paradoxons - benannt nach dem Parteienforscher Morsei Ostrogorski (1854-1891) - entscheidet die Abstimmungsweise über Sieg oder Niederlage. Je nachdem, ob über alle Streitfragen gleichzeitig abgestimmt wird, oder ob man über die strittigen Themen getrennt abstimmen läßt, und die Ergebnisse dann summiert, siegt die eine oder andere Partei.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Im in der Tabelle dargestellten Beispiel gewinnt bei der Abstimmung nach einzelnen Streitpunkten immer die Partei X und erringt somit, wenn die Ergebnisse summiert werden, den Wahlsieg. Wird jedoch über die Streitpunkte 1, 2 und 3 gleichzeitig entschieden, halten die jeweils 20% starken Wählergruppen A, B und C die Partei Y in, je nach Gruppierung unterschiedlichen, zwei von drei Streitpunkten für überlegen.
Die Gruppe D, welche 40% der gesamten Wählerschaft ausmacht, stimmt immer für X, egal um welches Thema es geht. Sie (bzw. ihre präferierte Partei) unterliegt bei einer nicht Issueorientierten Abstimmung somit mit 40% zu 60% der Stimmen.
Wessen Sieg ist gerecht und spiegelt den Volkswillen wieder? Diese Frage ist kaum zu beantworten, es sei denn, man erklärt, vom Standpunkt der Wiedergabe von Interessen aus gesehen, einen Wahlsieg der Partei X für wünschenswert:
Denn gewänne Y, wäre die Wählergruppe D überhaupt nicht repräsentiert, während A, B und C ja in jeweils einem der drei Streitpunkte der Partei X zugestimmt haben.
2.3 Bedingungen des Majoritätsprinzips
Was spricht für die Entscheidung gemäß dem Majoritätsprinzip?
Zum einen seine hohe Legitimationskraft: Es ist ähnlich unangreifbar, wie das Prinzip der Volkssouveränität gegenüber Ideen wie dem Gottesgnadentum, oder dem Machtanspruch auf Grund ethnischer/sozialer Zugehörigkeit, da es die Fiktion der (politischen) Gleichberechtigung Aller aufrechterhält.
Gegenüber ihren Alternativen, wie Befehl, Los29, Orakel, Expertenvoten ist die Mehrheitsregel auf der Input Seite zu favorisieren, weil sie den Aspekt der staatsbürgerlichen Gleichheit betont und auf der Output Seite die Vorteile hat, zuverlässig jederzeit allgemein akzeptierte Entscheidungen produzieren zu können bei relativ geringen Kosten.
Das Majoritätsprinzip ist also eine funktionierende Strategie der friedlichen Konfliktlösung als Ausgleich der vielen divergierenden Interessen in der Gesellschaft, allerdings nur sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind:30
1) Homogenität
a) kulturelle Homogenität
Mehrheit kann immer nur als Teil eines ganzen aufgefaßt werden und bedarf daher dem Vorhandensein einer gemeinsamen öffentlichen Kultur. Diese Rolle spielte bisher der Nationalstaat.31
b) soziale Homogenität
Um die Mehrheitsregel sinnvoll anwenden zu können, darf keine feste Zweiklassengesellschaft bestehen. Soziale Mobilität muß in wenigstens minimaler Form möglich sein. Klafft die Schere zwischen Arm und Reich zu weit auseinander und ist ein Aufstieg innerhalb der Gesellschaft unmöglich, hätten die sozial Benachteiligten keinen Grund, die Beschlüsse der Mehrheit als bindend anzuerkennen.
2) Grundkonsens
Der Grundkonsens verankert nicht nur das Mehrheitsprinzip als verbindliches Verfahren zur kollektiven Entscheidungsfindung, er schafft auch seine Bindung an und Begrenzung durch Werte wie die Grundrechte des Einzelnen und garantiert, daß diese nicht durch Mehrheitsbeschluß außer Kraft gesetzt werden können.
Somit ist der Grundkonsens die Basis für das horizontale Vertrauen zwischen den Bürgern, da unterliegende Minderheit davon ausgehen kann, daß die Mehrheit ihre Macht nicht ausnutzt um beispielsweise Legislaturperioden zu verlängern oder die Opposition zu verbieten. So wird eine „Tyrannei der Mehrheit“ verhindert.
3) Wechselnde Minderheiten
Die Mehrheiten sind idealerweise eher „Gelegenheitsmehrheiten“ d.h. inhomogen in ihren Zielen und instabil was ihr Fortbestehen angeht so, daß Minderheiten die Chance sehen, beim nächsten Mal zur Mehrheit zu gehören.
Mit dem Prinzip der wechselnden Minderheiten, welches der jeweiligen unterliegenden Gruppe eine zumindest formelle Chance bietet, dank „der selbstständigen Urteilskraft der Wähler selbst einmal zur Mehrheit zu werden“32 hängt eine weitergehende Legitimationsproblematik zusammen:
Ein gravierendes Problem der Mehrheitsdemokratie ist die zum Teil sehr stark unterschiedliche Betroffenheit durch Entscheidungen.
Die Kosten - Nutzen Analyse kann sich in zwei Richtungen ungleichgewichtig entwickeln:
a) Ein negatives Verhältnis von Kosten und Nutzen
b) Ein regional ungleichgewichtiges Verhältnis von Kosten und Nutzen
Beispiele für den letzteren Fall ergeben sich immer dann, wenn das Kongruenzprinzip, welches besagt, daß der Kreis der Betroffenen mit dem der Entscheidenden deckungsgleich sein sollte, nicht gewahrt ist, z. B. beim Bau von Autobahnen, Sondermülldeponien oder forensische Kliniken können die Lebensqualität einer ganzen Region erheblich herabsetzen. Meist formieren sich dann demokratisch nicht legitimierte Bürgerinitiativen und kämpfen gegen Beschlüsse einer von der Mehrheit gewählten Regierung. Trotzdem erscheinen die Anliegen der Initiativen durchaus legitim, da sie unmittelbar die negativen Konsequenzen tragen müssen. Sind die „Kosten“ der Region am Ende gar höher als der „Nutzen“, welcher sich für alle ergibt, erweist sich die Entscheidung als schwer tragbar.
Ein rein negatives Verhältnis von Kosten und Nutzen, wie a), stellt sich vor allem ein, wenn man Entscheidungen auf ihre Auswirkungen für die Zukunft hin prüft.
Wenn davon ausgegangen werden kann, daß die Entscheidung der Mehrheit für einen jetzigen Nutzen einen in der Zukunft untragbaren Schaden hervorrufen wird, ist sie dann noch legitim? Oder wird die Mehrheit im Hinblick auf die Anzahl der zukünftig negativ Betroffenen automatisch zu einer Minderheit schrumpfen?
Hiermit beschäftige ich mich in folgenden, letzten Teil meiner Arbeit:
3. Intergenerationale Gerechtigkeit
3.1. Einleitung: Future Generations
Entscheidungen, die unser heutiges Leben prägen, sind zu einem nicht geringen Teil zu einer Zeit getroffen worden, als wir keine Möglichkeit der Einflußnahme hatten. In zwanzig oder fünfzig Jahren wird das Leben entscheidend davon beeinflußt werden, welche Wahl heute getroffen wird. Doch die am meisten Betroffenen sind nicht stimmberechtigt und können es nicht sein, da sie noch nicht geboren sind. Ihr Lebensstandard wird höchstwahrscheinlich niedriger sein als der jetzige. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden die fossilen Brennstoffe aufgebraucht sein, vielleicht ohne Ersatz. Der teilweise hochgiftige Abfall, den wir in nicht mehr überschaubaren Mengen produzieren, wird uns selbst um lange Zeit überleben, und es ist nicht unwahrscheinlich, daß wir lebenswichtige Ressourcen, wie Trinkwasser und Luft ebenfalls vernichten. Die Kosten stehen in keinem Verhältnis zu dem Nutzen, den wir - noch - genießen. Trotzdem sind die meisten Beschlüsse zugunsten der Erhaltung und Schonung dieser Ressourcen in den seltensten Fällen mehrheitsfähig. Wie aus dem vorangegangen Abschnitt 2.1 hervorgeht:
Das Recht der Mehrheit bedeutet nicht, daßdie Mehrheit auch recht hätte.
Diese Problematik der Demokratie und den aus ihr eventuell resultierenden Mangel an Gerechtigkeit werde ich im folgenden erörtern.
3.2 John Rawls und der Schleier des Nichtwissene
In seinem Hauptwerk „A theory of justice“ versucht John Rawls Prinzipien für gerechte ökonomische Verteilung und gerechte soziale Chancengleichheit aufzustellen und zu begründen, indem er auf die Vertragslehren der neuzeitlichen politischen Philosophie zurückgreift.33
Den Rawlsschen Gesellschaftsvertrag schließen die Vertragsparteien in einem fiktiven Zustand ab, dessen Hauptmerkmal ist, daß die Personen hinter einem „Schleier des Nichtwissens“ agieren. Auf Grund dessen sind sie bar jedes Wissens, wo ihr Platz in der Gesellschaft nach dem Vertragsabschluß sein wird, und da jeder aus egoistischen Einzelinteressen heraus handelt (weder Altruisten noch Spieler sind an der Runde beteiligt), einigt man sich auf Grundsätze, die jedem einzelnen Mitglied der Gesellschaft, auch dem Schwächsten, ein Höchstmaß an Lebensqualität zukommen lassen. Ungleichheit wird nur insoweit zugelassen, wie sie von Vorteil für alle ist.
Was wäre, wenn im fiktiven Zustand des Vertragsabschlusses die Parteien nicht wüßten, wann sie geboren würden?
Sie würden sich vermutlich auf nachhaltige Entwicklung einigen und nicht zulassen, daß eine Generation auf Kosten der anderen profitiert. Zudem würden sie aus eben diesen Gründen ein gewisses Mißtrauen gegen Mehrheitsentscheide hegen, die ja nur von der jeweils einen, lebenden Generation getroffen werden.
Auf Demokratie zugunsten einer „Ökodiktatur“ verzichten wäre trotzdem keine Alternative, da auch Institutionen Generationen überdauern (können), würden zwar die Ressourcen geschont, aber ein, vom Standpunkt der Gerechtigkeit, schlechtes politisches System weitergegeben. Vor allem wäre keiner bereit, zugunsten des Glücks einer zukünftigen Generation, das Risiko einzugehen in einer Diktatur zu leben. Das System der Demokratie bedarf also nur einigen Modifikationen, um Gerechtigkeit gegenüber zukünftigen Generationen zu üben.
Vermutlich würde von den Vertragspartnern der Bereich des Unabstimmbaren ausgedehnt und Entscheidungen deren Folgen irreversibel oder doch sehr langfristig sind, möglichst erschwert.
Inwieweit aber sollten die Generationen gleich behandelt werden? Welche Prinzipien sollten sinnvollerweise gelten?
Mit dieser Fragestellung beschäftige ich mich im nächsten Abschnitt:
3.3 Unsere Verpflichtung gegenüber zukünftigen Generationen
Als Resultat einer gesteigerten Beschäftigung mit Umweltrisiken wird der Frage nach intergenerationaler Gerechtigkeit wachsende Aufmerksamkeit zuteil.
Die Befürchtung, daß wir begrenzte Ressourcen, Trinkwasser, saubere Luft und Artenvielfalt eingeschlossen, aufbrauchen könnten, so daß zukünftige Generationen zu einem niedrigeren Lebensstandard verurteilt wären, ist mit Prinzipien der intergenerationalen Gleichberechtigung verknüpft, welche, im Gegensatz zu dem Gleichheitsgedanken innerhalb einer Gesellschaft, ein neueres Thema sind.34 Beckerman setzt sich in seinem Aufsatz „Sustainable Developement and our Obligations to Future Generations“ mit zwei Wegen auseinander, mit den oben genannten Befürchtungen umzugehen:
Sowohl nachhaltige Entwicklung als auch das eben beschriebene Konzept des intergenerationalen Egalitarismus werden von Beckermann abgelehnt. Im folgenden bemühe ich mich seine Argumentation nachzuvollziehen, welche ich in Bezug auf den ersten Punkt für falsch halte.
Beckerman widerlegt die Anwendung egalitaristischer Argumente auf das Problem der intergenerationalen Gerechtigkeit, indem er weitverbreitete Argumente des Egalitarismus aufgreift und zeigt, daß sie nicht sinnvoll auf zukünftige Generationen angewendet werden können.
Ein solches Argument ist beispielsweise, daß ein gewisses Maß an Gleichheit von Einkommen, Status oder allgemeiner Chancen, den sozialen Frieden sichert und die Produktivität und damit den Wohlstand aller fördert.
Dieses ist gemäß Beckerman nicht übertragbar, da keinesfalls aufgezeigt werden kann, wie eine intergenerationale Gleichheit z. B. der Einkommen „intergenerationale Harmonie“ fördern sollte. Auf ähnliche Weise wird die Gefahr einer, durch starke soziale Ungleichheit gespaltenen Gesellschaft, als nicht sinnvoll für die Debatte um einen gerechten Ausgleich zwischen den Generationen dargestellt. Was Beckerman übersieht, ist, daß Generationen nebeneinander existieren, nicht nacheinander. Die Gesellschaft ist ein System der Kooperation von Generationen. Bei Generationen innerhalb einer Gesellschaft ist es durchaus von Vorteil (und auch im Sinne des Homogenitätsprinzps, als einer Bedingung der Anwendung der Mehrheitsregel und damit der Demokratie), wenn keine Besitzstandssicherung zu Ungunsten der jüngeren Generation betrieben wird, was anhand der aktuellen Problematik um Generationenvertrag und Rentenversicherung deutlich wird. Ein weiteres Argument gegen Egalitarismus als Leitprinzip für den Umgang mit unseren Verpflichtungen den „Future Generations“ gegenüber, übernimmt Beckerman von Harry G: Frankfurt: „ Inequality is a purely formal relationship, from which nothing whatever follows as to the desirability or value of any of the unequal terms.The egalitarian condemnation of inequality as inherently bad loses much of its force, I believe, when we recognize that those who are doing considerably worse than others may nonetheless be doing rather well. Surely what is of genuine moral concern is whether people have good lives, and not how their lives compare with the lives of others.“35 - was, wie auch Beckermann bemerkt, ein Argument ist das zu jedem Zeitpunkt gegen den Egalitarismusgedanken spricht.
Auch die nachhaltige Entwicklung, welche eine so große Rolle in Umweltdenken und -politik spielt, ist nach Beckerman kein geeignetes Instrument, um der Verpflichtung gegenüber der Zukunft gerecht zu werden, da nicht gesagt ist, daß der durchschnittliche Wohlstand bei einer positiven Entwicklung höher sein muß, als bei einer negativen, wie in Abbildung 3.2.1. deutlich wird36:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Time
w1 und w2 sind unterschiedliche Szenarien über mögliche Lebenswege; w* ist die jeweilige Summe der Auswirkungen von w1 und w2 auf die nachfolgenden Generationen W1 und W2. Im Falle von w1 ist w* positiv so, daß die Kurve von W1 sogar noch mehr steigt als die der Parentalgeneration. Bei dem Lebensweg der Elterngeneration w2 ist dagegen w* negativ und die Wohlstandskurve fällt, noch schneller als die des vorangegangenen Lebensweges. Beckerman argumentiert folgendermaßen:
Da die Filialgeneration W1 ein durchschnittlich niedrigeres Wohlstandsniveau hat als W2, obwohl w* im ersten Fall positiv ist, d.h. durch nachhaltige Entwicklung, beispielsweise Ressourcen geschont wurden, wird W1 höchstwahrscheinlich nicht dankbar sein für die Entwicklung, welche von der vorangegangenen Generation angestrebt wurde. Der einzige Grund für diese den Lebensweg w1 mit einem positiven Effekt w* für die Zukunft gegenüber dem Lebensweg w2 zu präferieren, ist daher ein rein egoistischer, nämlich, daß es befriedigender ist, etwas zu hinterlassen, das das Leben der kommenden Generation, besonders der eigenen Kinder zu einem besseren macht. Stolz und Erfüllung, die die Eltern hieraus ziehen könnten, sind aber keinesfalls moralische Werte, die als Rechtfertigung für nachhaltige Entwicklung dienen könnten.37
Somit ist nachhaltige Entwicklung aus Gründen der intergenerationalen Gerechtigkeit schwer zu begründen.
Vor diesem Hintergrund entscheidet sich Beckerman für den Humanismus als Leitfaden für den Umgang mit dem Problem der „Future Generations“.
Weitverbreitete institutionalisierte Härten und Verletzungen von grundlegenden Menschenrechten in der Welt heute sind unbestreitbare Tatsachen, nicht Ergebnisse von Spekulationen über die Zukunft, daher fordert Beckerman eine bessere Durchsetzung von Menschenrechten und, in Bezug auf Margalit, das Hinterlassen einer „decent society“, deren Hauptcharakteristik ist, daß ihre Institutionen für Menschen nicht demütigend sind.
Beckerman weist zurecht darauf hin, daß diese decent society auch eine just society nach Rawls wäre, weil eine der Bedingungen für Rawls gerechte Gesellschaft ist, daß eine gerechte Verteilung der Primärgüter stattfindet, von denen das wichtigste Selbstachtung ist.38 Auch stimmt es, daß bessere Verhältnisse jetzt mit relativer Sicherheit automatisch einen positiven Effekt für die Zukunft mit sich bringen würden.
Ebenso gilt aber umgekehrt: Nachhaltige Entwicklung ist immer auch eine Verbesserung der Lebensverhältnisse eines großen Teils der heute lebenden Bevölkerung.39 Im folgenden werde ich mich daher näher mit nachhaltiger Entwicklung auseinandersetzen:
3.4 Nachhaltige Entwicklung
Eine Politik der nachhaltigen Entwicklung zu betreiben kann im wesentlichen aus vier voneinander abzugrenzenden Motivationen heraus geschehen:
a) Intergenerationale Gerechtigkeit
b) Intragenerationale Gerechtigkeit
c) Moralische Werte
d) Verantwortung gegenüber anderen Spezies und Umwelt
Auf die ersten beiden Punkte bin ich bereits im vorangegangen Abschnitt eingegangen und habe entgegen Beckermann festgestellt, daß nachhaltige Entwicklung als Konzept, welches sich, von Mehrheitsentscheiden unantastbar, in einer Verfassung verankern ließe, sowohl dazu dienen könnte, Punkt a), als auch Punkt b) zu fördern.
Auf die in c) genannten moralischen Werte, z.B. der Schutz, bzw. die Bewahrung der Natur aus religiösen Gründen, werde ich nicht näher eingehen, dagegen komme ich auf den letzten Punkt, die Verantwortung gegenüber Entitäten, die nicht zur menschlichen Spezies gehören, noch zurück.
Zunächst möchte ich mich bemühen, den Begriff nachhaltige Entwicklung inhaltlich zu füllen, und stelle zu diesem Zweck einen Definitionsversuch vor:
„The core concept of sustainability is, ...,that there is some X whose value should be maintained, in as far as it lies within our power to do so, into the indefinite future.“40
Zu diskutieren ist, von welcher Form dieses X ist, das an unsere Nachfolger weitergegeben werden soll.
Barry schlägt zunächst „Nutzen“ vor, verstanden, gemäß der orthodoxen Ökonomie, als Befriedigung von Bedürfnissen oder Präferenzen.
Der offensichtliche Einwand gegen dieses Kriterium ist, daß Wünsche und Vorlieben davon abhängig sind, was erreichbar ist, oder als erreichbar angesehen werden kann. Vielleicht könnten Menschen in der Zukunft völlig künstliche Landschaften befriedigend finden. Das „Bedürfnis-Kriterium“ liefert keine Argumente, um zu formulieren, was an einer solchen Welt falsch wäre. Im Gegenteil: Es kann zu der Einstellung führen, daß wie auch immer geartete Schädigungen der Umwelt durch den zu erwartenden technischen Fortschritt problemlos ausgeglichen werden können.
Als Reaktion darauf könnte man vom Konzept der Nachhaltigkeit verlangen, daß zukünftige Generationen dieselben Lebensbedingungen haben sollten, wie wir heute. Diese Position ist insofern problematisch als, daß auch innerhalb der heutigen Gesellschaft kein Konsens darüber besteht, wie gute Lebensumstände auszusehen haben, und man daher erst recht nicht erwarten kann, daß unsere Vorstellungen mit denen zukünftiger Generationen deckungsgleich sein könnten.
Daher schlägt Barry folgende Definition von Nachhaltigkeit vor:
Das Konzept von Nachhaltigkeit bedeutet, daß für unbegrenzte Zukunft von Generation zu Generation gleiche Möglichkeiten der Wahl zwischen alternativen Lebensentwürfen (= X) erhalten bleiben.
D.h. selbst, wenn es in Zukunft Menschen vielleicht sogar vorziehen in rein virtuellen Landschaften zu leben, sollte man dennoch die Existenz unserer Naturschätze bewahren, um ihnen die Möglichkeit zu geben, zwischen beidem zu wählen.
Ein Konzept von nachhaltiger Entwicklung, das aus der Motivation d) Verantwortung für andere Spezies und Umwelt erfolgt, würde diese Definition als zu sehr auf den Menschen fixiert ablehnen und stattdessen die Bewahrung der Umwelt, aus dem Grund proklamieren, daß diese einen Wert an sich darstellt, der unabhängig von menschlichen Bedürfnissen besteht.
Festzuhalten bleibt: Die Definition der Entität X, die für die Zukunft erhalten werden soll, ist unausweichlich an die jeweilige Konzeption des Einzelnen, der Gruppe, der Gesellschaft dessen, was wichtig ist, geknüpft.
Wie eine Gesellschaft mit ihrer Verpflichtung gegenüber der Zukunft umgeht, ist in einer Demokratie eine Frage, die im öffentlichen Diskurs entschieden werden muß.
Die Bedingungen dafür müssen in der Politik geschaffen werden.
Um meine Überlegungen hier zu einem Abschluß zu führen, möchte ich noch einmal auf die in Abschnitt 1.4 vorgestellte Arbeitsdefinition von Demokratie zurückkommen:
Demokratie ist die Anwendung der Mehrheitsregel bei freien, gleichen und geheimen Wahlen, die nach gründlicher Erörterung der zur Entscheidung stehenden Problematik in der Öffentlichkeit stattfinden und deren Ergebnis kollektiv verbindliche Entscheidungen, sofern diese mit dem Schutz der Minderheit und dem Fortbestand des Rechtsstaats in Einklang stehen, legitimiert.
Um Demokratie als zukunftstragendes System bezeichnen zu können, müssen dieser Definition bestimmte Wertmaßstäbe hinzugefügt werden, die über den Schutz von Minderheiten hinausgehen.
Besonderem Schutz und besserer Präsenz in Medien und Politik sollten diejenigen unterstellt werden, die die Kosten unserer Entscheidungen tragen müssen. Das bedeutet zum einen Umweltschutz und bessere Lebensbedingungen, unter anderem eine Bekämpfung der Armut, also ein Konzept der nachhaltigen Entwicklung als Bestandteil in die Verfassung zu integrieren, zum anderen die Wahlbevölkerung gezielter über die Kosten von politischen Entscheidungen, oder das Nicht-Treffen derselben, die entweder zukünftige Generationen, oder bereits heute die Entwicklungsländer, aber auch bestimmte Regionen innerhalb des Kreises der Stimmberechtigten, tragen müssen, zu informieren.
Schlußbetrachtung
An dieser Stelle möchte ich versuchen, möglichst strukturiert meine Ergebnisse aus den einzelnen Teilen der Hausarbeit zusammenzufassen. Im Verlauf des Textes habe ich eine Entwicklung von grundsätzlichen, theoretischen Fragestellungen hin zu eher speziellen Problemen betrieben, um letztlich mit einer Teilproblematik des Mehrheitsprinzips, nämlich den nicht stimmberechtigten zukünftigen Generationen, zu enden.
In Teil 1.1 bin ich zu dem Ergebnis gekommen, daß weder die empirische noch die normative Sicht auf Demokratie für sich allein genommen geeignet sind eine adäquate Beschreibung des Bestehenden mit inhaltlicher Substanz, verstanden als Wertvorstellungen, die den Demokratiebegriff ausmachen, zu verknüpfen. Diese Feststellung hat dazu geführt, daß ich im Folgenden versucht habe, Probleme sowohl vom normativen Standpunkt, also gemessen am Ideal von Demokratie, als auch in Hinblick auf die bestehenden Verhältnisse zu beleuchten.
Daher trenne ich mich im Abschnitt 1.2, nach einer Auseinandersetzung mit der unterschiedlich motivierten Kritik an Demokratie, von dem Ideal der „politischen Beteiligung aller Bürger am Entscheidungsprozeß“ (S.6), ohne das Partizipationspostulat deswegen völlig aufzugeben. Stattdessen versuche ich unter bezug auf die komplexe Demokratietheorie (insbesondere Scharpf) Wege aufzuzeigen, die praktisch umsetzbar sind. Dieses Ergebnis ist mir besonders wichtig gewesen, da zu meinem Grundverständnis von Demokratie Chancengleichheit bei der Beteiligung an Entscheidungen gehört. Daher rührt auch meine Ablehnung von Bobbios Minimaldefinition von Demokratie im Abschnitt 1.3. Durch die Auseinandersetzung mit Bobbios Position (1.3 und 1.4) ist mir allerdings die zentrale Rolle der Mehrheit im demokratischen System deutlich geworden. Die ersten zwei Abschnitte des folgenden Teils über das Mehrheitsprinzip lassen sich im Grunde zu der Erkenntnis zusammenfassen: Das Mehrheitsprinzip ist schlecht, aber leider weiß niemand etwas besseres, das ebenso zuverlässig Entscheidungen produzieren kann. Erst bei der Darstellung der Bedingungen unter denen das Majoritätsprinzip sinnvoll angewendet werden kann (2.3) wurde mir klar, daß die Kongruenz zwischen denen die die Entscheidung treffen und denjenigen die von der Entscheidung betroffen sind, ausschlaggebend dafür ist, ob diese Entscheidung als legitim empfunden wird. Auf dieses Ergebnis aufbauend erfolgt dann die Diskussion verschiedener Positionen zum gerechten Umgang mit zukünftigen Generationen in Teil 3.
Der Abschnitt 3.1 dient hierbei nur zur Einführung in die Thematik. Wichtiger ist dagegen die Fragestellung im Abschnitt 3.2, nämlich: Wie kann man überhaupt wissen, was gegenüber zukünftigen Generationen gerecht sein soll. Meine Antwort hierauf lautet, daß Auskunft darüber in einer Rawls entlehnten Vertragstheorie zu finden ist.
Ein weiterer Argumentationsstrang in diesem Abschnitt ist die Auseinandersetzung mit Forderungen nach einer „Ökodiktatur“, welche ich bereits im Abschnitt 1.2, als eine Form von Elitenherrschaft genannt hatte, und die ich nun noch einmal, mit einer anders gelagerten Begründung, als nicht akzeptable Alternative kennzeichne.
In den Abschnitten 3.3 und 3.4 setze ich mich mit Lösungskonzepten auseinander und komme entgegen Beckerman und mit Barry zu dem Schluß das nachhaltige Entwicklung ein vertretbares politisches Ziel darstellt. Offen bleibt die Frage wie und ob man für eine solche Politik Mehrheiten finden kann und wird.
[...]
1 Wobei auch zwischen statisch vs. dynamisch oder Input- bzw. Output-Orientierung unterschieden werden kann, aus Übersichtsgründen werden diese Unterscheidungen aber nur am Rand behandelt.
2 Möcklin, Emanuel: Demokratietheorie. Eine vergleichende Analyse verschiedener Demokratietheorien. S.5-9
3 Nicht mit einbezogen sind Demokratietheorien marxistischer Prägung, da sie für die folgende Argumentation bedeutungslos sind.
4 Vgl.: Bobbio, Norberto: Die Zukunft der Demokratie. Berlin, 1988 Bobbio formuliert drei Hindernisse, die einer idealen Verwirklichung der Demokratie entgegenstehen, diese sind: a) Die Technokratie: Es ist nicht möglich, daß alle über alles entscheiden können, da nur wenige über das benötigte Expertenwissen verfügen. b) Das Wachstum des Apparats: Demokratisierung geht automatisch mit Bürokratisierung einher, da der Staat, je mehr Gruppen er vertritt, auch um so mehr Leistungen erbringen muß. c) Die geringe Leistungsfähigkeit: Immer mehr Forderungen werden immer schneller von der Zivilgesellschaft an das demokratische System gestellt, welches sich seinerseits durch eine gewisse Schwerfälligkeit auszeichnet, die in den komplexen Entscheidungsverfahren des parlamentarischen Systems begründet ist. Die hieraus resultierende Überlastung zwingt das politische System eine mitunter drastische Auswahl zu treffen.
5 Die liberale Konkurrenztheorie, die vor allem vom angelsächsischen Denken und von der politischen Philosophie John Lockes beeinflußt und geprägt wurde, geht von der prinzipiellen Berechtigung der Existenz verschiedener Interessen (Pluralismus) aus und lehnt die Annahme eines vorgegebenen und erkennbaren Gemeinwohls ab. Die Konkurrenztheorie glaubt, im Wettstreit konkurrierender Interessen sei ein sozialer Ausgleich unter den Gruppen möglich, da keine Gruppe erwarten kann, daß sie ihre Interessen ganz und ungeteilt durchzusetzen vermag.
6 Volkssouveränität: Dieser Begriff, der ausdrücken soll, daß das Volk sein eigener Herrscher (Souverän) ist, ist natürlich nur ein rechtstheoretisches Ideal, aber als Legitimationsinstrument natürlich wesentlich überzeugender als das Gottesgnadentum oder der Hobbessche Gesellschaftsvertrag zur Schaffung eines Leviathans.
7 Repräsentative Demokratien unterscheiden sich wiederum dahingehend, ob das Mandat (des Repräsentanten) frei oder gebunden ist. Das gebundene Mandat entspricht eher dem rousseauschen Ideal der Identität von Regierenden und Regierten, das freie Mandat ist jedoch das heute gebräuchliche.
8 Nauer, Moritz: Beitrag zu einer modernen Demokratiekritik. S.2
9 So besteht zum Beispiel, außer in Belgien, in keinem (europäischen) Land eine Wahlpflicht.
10 Siehe hierzu: Scharpf, Fritz: Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung. Demokratie als Partizipation. Konstanz 1970. S.58. Scharpf weist darauf hin, daß geringe Partizipation nicht allein durch Klassenschranken erklärt werden kann, da die Partizipationsschwellen ebenfalls für Angehörige der Oberschicht gelten. Will man sich nicht auf psychologische Faktoren zurückziehen, gibt es zwei Gründe, die gegen politisches Engagement sprechen: 1)Das beinahe schon antiproportionale Verhältnis von Anzahl und Komplexität politischer Entscheidungen einerseits und den Fähigkeiten der Informationsaufnahme und-verarbeitung des Bürgers andererseits. 2)Die Konkurrenz des politischen Interesses mit anderen relevanten Individualinteressen, unter Berücksichtigung des begrenzten Zeitbudgets des Einzelnen.
11 Die niedrige Wahlbeteiligung bei den jüngsten Kommunalwahlen in Sachsen und Nordrhein-Westfalen scheint in der Tat gegen dieses Anliegen zu sprechen: Erstmals durften bereits Jugendliche ab 16 Jahren wählen, die Beteiligung lag aber bei nur gut 50%:
12 Nauer, Moritz: Beitrag zu einer modernen Demokratiekritik, S.20
13 Scharpf, Fritz: Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung. Konstanz 1970. Seite 66-67
14 Vgl: Sartori, Giovanni: Demokratietheorie. Kapitel 2.5. Die Lincolnsche Formel, S.44-45 Sartori verweist auf die Dehnbarkeit der Ausdrücke „des Volkes“, „durch das Volk“ und „für das Volk“. Unter „Regierung des Volkes“ kann man aufgrund des unklaren Bezugs des Genitivs Grundverschiedenes verstehen: Selbstregierung des Volkes, also direkte Demokratie b) der umgekehrte Fall - das Volk wird regiert. Hier ergeben sich wiederum zwei Unterlesarten: c) die Regierung leitet ihre Legitimität aus der Zustimmung des Volkes her d) die Regierung wird vom Volk gewählt; sowie eine Mischform aus a) und b): e) die Regierung wird vom Volk gelenkt. Die Formulierung „durch das Volk“ ist dagegen derart unklar, daß man nichts mit ihr verbinden kann. „Regierung für das Volk“ scheint eindeutig zu sein und „im Interesse des Volkes, für sein Wohl“ zu bedeuten. Dieses zu verfolgen behaupten aber auch Diktaturen. So kommt Sartori zu dem Schluß, daß, die Lincolns Formel Demokratie aus dem Grund kennzeichnet, weil sie von einem Demokraten ausgesprochen wurde und somit als Definition nicht ausreicht.
15 Bobbio, Norberto: Die Zukunft der Demokratie. Berlin 1988
16 Bobbio spricht allgemeiner von „Gruppen“, die als Kollektiv Entscheidungen benötigen, welche aber, der Natur der Sache gemäß, nur von Individuen getroffen werden können. Diese Behauptung steht im Gegensatz zu den Konsenstheorien von Demokratie, welche eine Entscheidung nach der Mehrheitsregel, zumindest teilweise, ablehnen und demgegenüber das Finden eines Kompromisses, dem letztlich alle Mitglieder zustimmen können, favorisieren.
17 Nach Bobbio bedingen sich Rechtsstaat und demokratisches System wechselseitig: Der Rechtsstaat ist, gemäß Bobbios drittem Kriterium, eine Voraussetzung für Demokratie, Demokratie ist ihrerseits wiederum der Garant für den Fortbestand des Rechtsstaats. Läßt sich der erste Teil der wechselseitigen Abhängigkeit noch ansatzweise theoretisch begründen, so ist der Fortbestand des Rechtsstaats auf keinen Fall zwingend mit der Existenz einer demokratischen Regierung verknüpft. Dies ließe sich höchstens historisch belegen, aber der „historische Beweis“ (die Zukunft der Demokratie, S.11) wird von Bobbio nur genannt, nicht geführt.
18 Bobbio, Norberto: Die Zukunft der Demokratie. Berlin 1988. S.10
19 Vgl: Sartori, Giovanni: Demokratietheorie. Darmstadt 1997. Kapitel 6. Vertikale Demokratie. S. 139 Sartori sieht grundsätzlich drei Felder in denen man von Mehrheiten und Minderheiten sprechen kann: a) in Zusammenhang mit einer Verfassung; b) in Zusammenhang mit Wahlen; c) in Zusammenhang mit der Gesellschaft. Nur in Bezug auf den ersten Bedeutungskomplex kann man von einer „Tyrannei der Mehrheit“ sprechen und zwar dann, wenn das Recht der Minderheit(en) auf Opposition nicht gewährt wird.
20 Welche keine Demokratie war, da Sklaverei dem Grundwertkonsens, der als Bedingung für Demokratie in Abschnitt 2.3 behandelt wird, widerspricht.
21 Kraut, Stefan: Das Mehrheitsprinzip. Der Kern des politischen Entscheidungsprozesses im demokratischen Staat. 1997. Einleitung, S. 2
22 Kraut, Stefan: Das Mehrheitsprinzip. Abschnitt 8.4. Arten der Mehrheit. S.18
23 Ein Beispiel ist in Deutschland die, in die Diskussion um Volksentscheide häufig eingebrachte, knappe Mehrheit gegen die Todesstrafe, welche nach einem Gewaltverbrechen mit hoher Medienpräsenz sofort kippt.
24 Hobbes, Thomas: Leviathan S. 149
25 Goethe, J. W. von: Maximen und Reflexionen. Aus Wilhelm Meisters Wanderjahren. 1829. S.604
26 Hiermit beziehe ich mich auf die Kritische Theorie der Demokratie, z.B. Offe 1984; entnommen aus: Demokratietheorie. Eine Einführung.
28 Guggenberger, B.; Offe, Claus (Hg.): An den Grenzen der Mehrheitsdemokratie. 1984. S.163
29 Siehe hierzu: Nelson, William N.: On justifying democracy. International library of philosophy 1980. Majority rule and fairness. S.18 Nelson weist darauf hin, daß vom Standpunkt der Gerechtigkeit aus der „Wurf einer Münze“ befriedigender sein kann, als ein Mehrheitsentscheid.
30 Kraut, Stefan: Das Mehrheitsprinzip. Der Kern des politischen Entscheidungsprozesses im demokratischen Staat. 1997. S12, sowie: v.Beyme, Klaus: Die politischen Theorien der Gegenwart. Eine Einführung. 7. Auflage. Opladen, 1992. S.161-162
31 Aus dieser Bedingung für die Anwendung der Mehrheitsregel lassen sich die Legitimationsprobleme in der Europäischen Union erklären: Durch das Fehlen einer kollektiven europäischen Identität, einer gemeinsamen europäischen Öffentlichkeit, welche sich zum Beispiel in der Abwesenheit nationalstaatenübergreifender Parteien zeigt, erscheint die Politik der EU nicht ausreichend demokratisch legitimiert. Unter anderem nachzulesen bei: Goodman, James. Die Europäische Union: Neue Demokratieformen jenseits des Nationalstaats. Entnommen aus: Beck, Ulrich (Hg.): Politik der Globalisierung. Frankfurt a. M. 1998
32 Offe, Claus: Politische Legitimation durch Mehrheitsentscheidung. Oopladen 1984. S.164
33 Rawls, John: A Theory of Justice. Harvard, 1971. Dt. Eine Theorie der Gerechtigkeit. Übers. von Hermann Vetter. 9.Aufl. Frankfurt a. M. 1995
34 Beckerman, Wilfred: Sustainable Developement and our Obligations to Future Generations. Entnommen aus: Dobson, Andrew (Hg.): Fairness and Futurity. Essays on Environmental Sustainability and Social Justice. Oxford, 1999. Seite 71-92
35 Frankfurt, Harry G.: Equality and Respect. Social Research. Nr. 64. 1997. Seite 3-16
36 Beckerman, Wilfred: Sustainable Developement and our Obligations to Future Generations. Kap. 3: The Unjustified Significance of Rising Welfare.Seite76
37 Auf längere Sicht erscheint mir Beckermans Argument als falsch: Wenn man die zweite Filialgeneration, d.h. die „Enkel“ von w1 und w2 in die Überlegungen miteinbezieht, ist es wahrscheinlich, daß w* sich nicht ändert, der negative Effekt bei der fallenden Kurve also verstärkt würde und daher ein steigender Wohlstand doch vorzuziehen ist.
38 Beckerman, Wilfred: Sustainable Developement and our Obligations to Future Generations. Kap.6: Priorities in our Obligation to Future Generations. Seite 86
39 „Poor people live in poor environments“; Dobson, Andrew: Fairness and Futurity. Introduction. Seite 3
Häufig gestellte Fragen zu Mehrheitsdemokratie und Fairneß
Was sind die zwei Hauptrichtungen der Demokratietheorie?
Die Demokratietheorie wird hauptsächlich in zwei Richtungen betrieben: empirisch und normativ. Die empirische Sichtweise beschreibt den Ist-Zustand, während die normative sich auf das Ideal der Volksherrschaft konzentriert.
Was ist das Problem mit der empirischen Demokratietheorie?
Im Extremfall kann die empirische Demokratietheorie zu einer schlichten Rechtfertigung des Bestehenden führen, indem sie normative Ideale außer Acht lässt.
Was kritisiert die partizipatorische Demokratietheorie an der Demokratie?
Die partizipatorische Demokratietheorie kritisiert einen Mangel an Demokratie und fordert eine stärkere Beteiligung der Bürger an politischen Themen und eine Demokratisierung größerer Gesellschaftsbereiche.
Was ist die Kritik der Elitenherrschaft an der Demokratie?
Die Elitenherrschaft propagiert eine Beschränkung der Entscheidungsgewalt der Bevölkerung und die Konzentration von Macht auf eine fähige, spezialisierte Elite.
Was versteht man unter "vertikalem Vertrauen" und "horizontalem Vertrauen" im Kontext der Demokratie?
"Vertikales Vertrauen" bezeichnet das Vertrauen zwischen Bürgern und Politikern, während "horizontales Vertrauen" das Vertrauen unter den Mitgliedern der Gesellschaft beschreibt. Beide sind wichtig, um Missstände in der Demokratie zu vermeiden.
Was ist Bobbios Minimaldefinition von Demokratie?
Bobbio definiert Demokratie als eine Methode der Entscheidungsfindung und -legitimation. Seine Kriterien umfassen: Wer entscheidet? Nach welchen Regeln? Welche Wahl hat man? Zudem ist ein Rechtsstaat Vorab-Voraussetzung.
Was ist die Arbeitsdefinition von Demokratie, die in diesem Text vorgestellt wird?
Die Arbeitsdefinition von Demokratie lautet: Demokratie ist die Anwendung der Mehrheitsregel bei freien, gleichen und geheimen Wahlen, die nach gründlicher Erörterung der zur Entscheidung stehenden Problematik in der Öffentlichkeit stattfinden und deren Ergebnis kollektiv verbindliche Entscheidungen, sofern diese mit dem Schutz der Minderheit und dem Fortbestand des Rechtsstaats in Einklang stehen, legitimiert.
Welche Arten von Mehrheit werden unterschieden?
Es gibt vier Arten von Mehrheit: relative, einfache, absolute und qualifizierte Mehrheit.
Was ist das Condorcet-Paradox?
Das Condorcet-Paradoxon beschreibt den Fall der sogenannten wandernden oder zyklischen Mehrheiten, die durch die Auswahl der Abstimmungsalternativen entstehen können.
Was ist das Ostrogorski-Paradox?
Das Ostrogorski-Paradoxon (nach Offe) beschreibt den Fall, dass die Abstimmungsweise über Sieg oder Niederlage entscheidet, je nachdem, ob über alle Streitfragen gleichzeitig oder getrennt abgestimmt wird.
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit das Majoritätsprinzip sinnvoll angewendet werden kann?
Die Bedingungen sind: kulturelle und soziale Homogenität, ein Grundkonsens und wechselnde Minderheiten.
Was ist das Kongruenzprinzip?
Das Kongruenzprinzip besagt, dass der Kreis der Betroffenen mit dem der Entscheidenden deckungsgleich sein sollte.
Was ist intergenerationale Gerechtigkeit?
Intergenerationale Gerechtigkeit bezieht sich auf die Frage, wie Entscheidungen, die heutiges Leben prägen, zukünftige Generationen beeinflussen und welche Verpflichtungen wir diesen gegenüber haben.
Was ist John Rawls' "Schleier des Nichtwissens"?
Im fiktiven Zustand des Vertragsabschlusses nach Rawls sind die Parteien bar jedes Wissens, wo ihr Platz in der Gesellschaft nach dem Vertragsabschluß sein wird, einigt man sich auf Grundsätze, die jedem einzelnen Mitglied der Gesellschaft, auch dem Schwächsten, ein Höchstmaß an Lebensqualität zukommen lassen. Ungleichheit wird nur insoweit zugelassen, wie sie von Vorteil für alle ist.
Warum ist eine "Ökodiktatur" keine Alternative zur Demokratie?
Obwohl sie Ressourcen schonen kann, besteht die Gefahr, dass ein schlechtes politisches System weitergegeben wird und keiner bereit ist, zugunsten des Glücks einer zukünftigen Generation das Risiko einzugehen in einer Diktatur zu leben.
Was ist nachhaltige Entwicklung?
Nachhaltige Entwicklung ist die Balance zwischen ökonomischem Fortschritt, sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Integrität, um die Lebensgrundlagen für zukünftige Generationen zu erhalten.
Welche Motivationen gibt es, um eine Politik der nachhaltigen Entwicklung zu betreiben?
Die Motivationen sind intergenerationale Gerechtigkeit, intragenerationale Gerechtigkeit, moralische Werte und Verantwortung gegenüber anderen Spezies und Umwelt.
Was bedeutet der Begriff von Nachhaltigkeit, das in diesem Text definiert wird?
Das Konzept von Nachhaltigkeit bedeutet, daß für unbegrenzte Zukunft von Generation zu Generation gleiche Möglichkeiten der Wahl zwischen alternativen Lebensentwürfen (= X) erhalten bleiben.
- Citar trabajo
- Stefanie Panke (Autor), 1999, Mehrheitsdemokratie und Fairneß, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98059