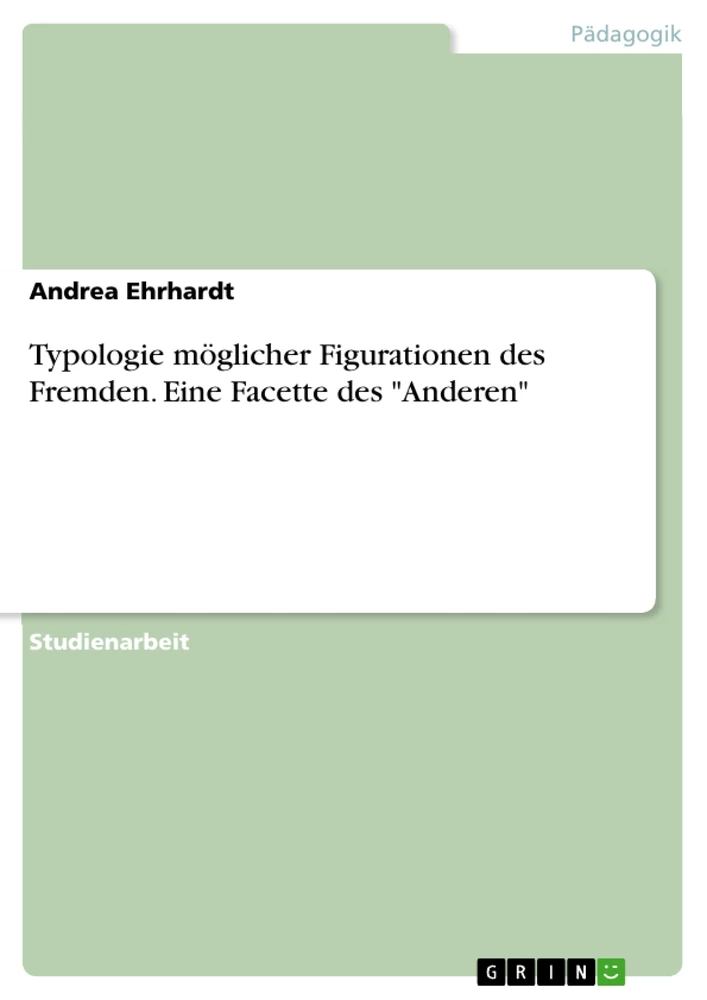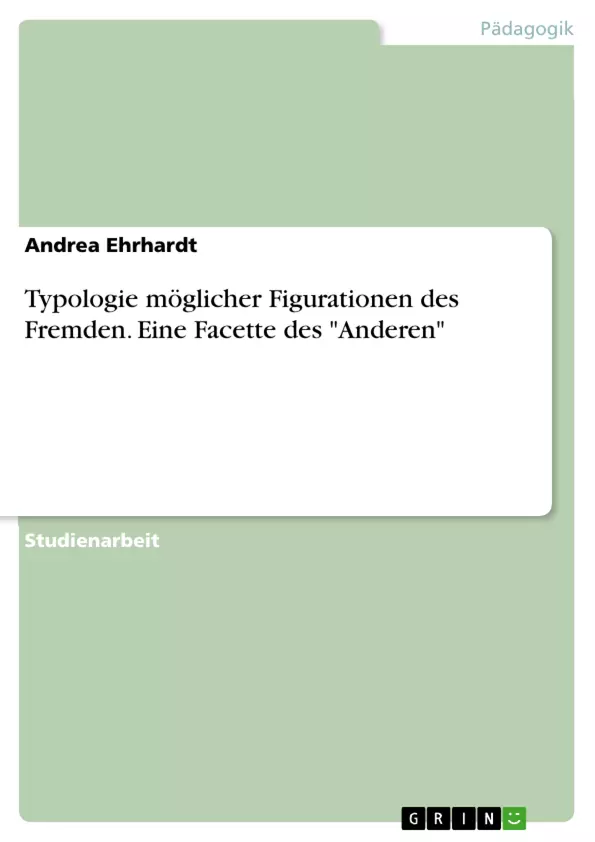Diese Arbeit behandelt das Erscheinungsbild des "Fremden" aus einer anthropologischen Sichtweise heraus und deckt verschiedene Erscheinungsformen des Selben in der Gesellschaft.
Was kann man unter dem Begriff "Mensch" verstehen? Ein Versuch, sich dieser Frage zu nähern, ist die Wissenschaft der Anthropologie. Diese bietet auf der Suche nach Antworten komplexe und teilweise miteinander verschränkte Erklärungsansätze, jedoch keine allgemeingültigen Lösungen, was sich durch den Themenfokus bedingt.
Ein Ansatz der Beantwortung der Frage nach dem Menschen an sich, ist die Betrachtung des den Anderen umfassenden Spektrums. Auch wenn die Frage nach dem Anderen, als dem uns Fremden, nicht vordergründig zu sein scheint, so ist sie doch von nicht zu unterschätzender Bedeutung.
Rein formal betrachtet existieren zwei, voneinander abhängige, zentrale Kategorien des Anderen. Diese Formen lassen sich als das Ich und der Andere als das, uns meist fremderscheinende, Gegenüber fassen. Ebenso ist das internalisierte Andere, in Form negierter Aspekte der eigenen Persönlichkeit, diesen beiden Kategorien zu zuordnen.
Das Ich kann es nur im Zusammenhang mit dem Anderen geben, da es durch dieses Gegenüber existent ist und dementsprechend betrachtet werden kann. Ebenso verhält es sich komplementär. Ohne ein Gegenüber kann es kein Selbst, aber auch kein Anderes geben. Das Ich und der Andere befinden sich in einer symbiotischen Beziehung zueinander.
Jeder Mensch hat diese beiden existentiellen Positionen des Daseins inne. Für einen selbst ist man das Ich, ein bestimmtes Individuum, und für sein Gegenüber ist man der Andere. Aus eben dieser Perspektive heraus geschieht die Wahrnehmung des Menschen. Somit stellt der Andere die Basis für soziale Beziehungen und den gesellschaftlichen Bezugspunkt für einen selbst dar.
Alles, was nicht von einem selbst kommt oder was man nicht selbst ist, steht unter dem Zeichen des Anderen.
Doch wie genau nehmen wir den Anderen war? Wie werden dessen Facetten betrachtet und wie wird die Existenz des Anderen gewertet? Meist wird der Andere als etwas nicht Eigenes, also Fremdes wahrgenommen. Das ständig präsente Fremde kann als ubiquitärer Begriff verstanden werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Andere als das Fremde.
- Figurationen des Fremden
- Der Fremde als der Feind.
- Der Fremde als das Böse - Das andere Geschlecht
- Das Fremde als das Geheimnisvolle
- Der Fremde als sozialer Typus – Etablierte und Außenseiter..
- Der Fremde als Teil des Selbst – Der Spiegel des Selbst..
- Der Umgang mit dem Fremden...........
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage des Anderen und dem Fremden. Der Fokus liegt auf der Untersuchung verschiedener Typologien, die die Begegnung mit dem Fremden beschreiben und kategorisieren. Die Arbeit analysiert, wie der Andere als das Fremde wahrgenommen wird und wie diese Wahrnehmung den Umgang mit dem Anderen prägt.
- Der Andere als das Fremde und die Herausforderungen der Kategorisierung
- Verschiedene Figurationen des Fremden: Feind, Böses, Geheimnisvolles, Sozialer Typus, Spiegel des Selbst
- Die Bedeutung der eigenen Kulturalität und des Weltbildes für die Wahrnehmung des Anderen
- Die Grenzen des Verstehens und die Notwendigkeit, den Fremden in seiner Komplexität zu betrachten
- Der Umgang mit dem Anderen und die Bedeutung der interkulturellen Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die grundlegende Frage nach dem Wesen des Menschen und führt die Anthropologie als Wissenschaft ein, die verschiedene Erklärungsansätze bietet. Die Bedeutung des Anderen als Gegenüber und als Teil des Selbst wird hervorgehoben.
- Der Andere als das Fremde: In diesem Kapitel wird untersucht, warum der Andere häufig als Fremd empfunden wird. Es wird erläutert, dass die eigene Kulturalität und das eigene Weltbild als Filter bei der Wahrnehmung des Anderen wirken und ihn so in die Position des Fremden rücken können.
- Figurationen des Fremden: Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Typologien, die das Fremde in unterschiedlichen Ausprägungen beschreiben. Beispiele sind der Fremde als Feind, der Fremde als das Böse, der Fremde als das Geheimnisvolle, der Fremde als sozialer Typus und der Fremde als Spiegel des Selbst.
Schlüsselwörter
Anthropologie der Erziehung, Anderer, Fremder, Figurationen des Fremden, Kulturalität, Weltbild, Verstehen, Interkulturelle Kommunikation, Selbstbild, Spiegel des Selbst, sozialer Typus, Feindbild.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert die Anthropologie den Begriff des „Fremden“?
Das Fremde wird als alles wahrgenommen, was nicht vom eigenen Selbst kommt oder nicht Teil der eigenen Identität (des Ichs) ist.
Welche Figurationen des Fremden werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit unterscheidet Typologien wie den Fremden als Feind, als das Böse (das andere Geschlecht), als das Geheimnisvolle oder als sozialen Außenseiter.
Was bedeutet „Der Fremde als Spiegel des Selbst“?
Dieser Ansatz besagt, dass wir im Fremden oft negierte Aspekte unserer eigenen Persönlichkeit (das internalisierte Andere) wiedererkennen oder projizieren.
Wie beeinflusst die eigene Kulturalität die Wahrnehmung?
Das eigene Weltbild wirkt wie ein Filter, der bestimmt, was als „normal“ oder „fremd“ gewertet wird, und prägt so den Umgang mit dem Anderen.
Gibt es ein Ich ohne den Anderen?
Nein, Ich und der Andere befinden sich in einer symbiotischen Beziehung; das Selbst existiert erst durch die Abgrenzung zum Gegenüber.
- Quote paper
- Dr. phil. Andrea Ehrhardt (Author), 2004, Typologie möglicher Figurationen des Fremden. Eine Facette des "Anderen", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/980766