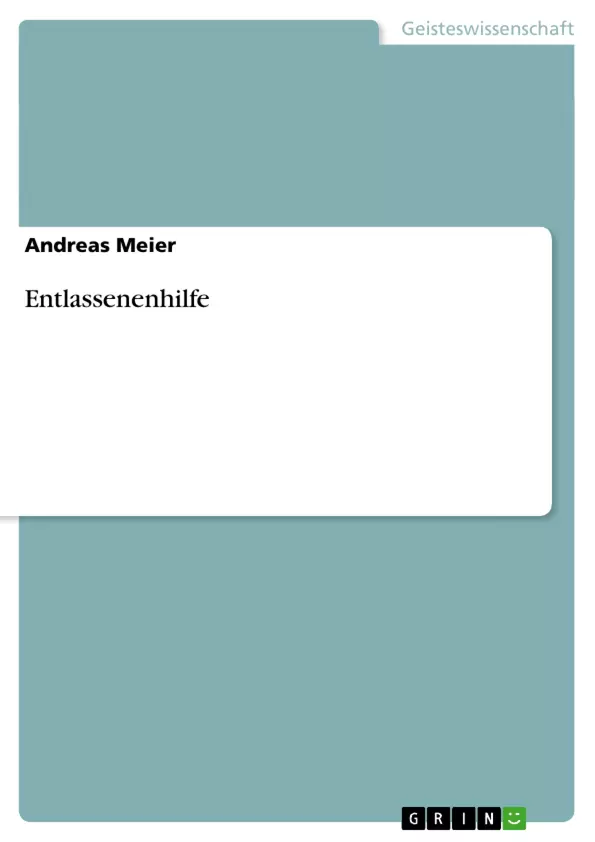1. Geschichte der Entlassenenhilfe
Die Geschichte der Entlassenenhilfe ist die Geschichte privater Initiativen und freier Träger. Bei der Wiedereingliederung Straffälliger in die Gesellschaft hält sich der Staat traditionell zurück.
Mitte des 19. Jhds. wurden von Geistlichen und Privatleuten in ganz Deutschland sog. „Gefängnisvereine“ gegründet, die sich die Betreuung von Strafgefangenen zur Aufgabe machten. U.a. beschafften diese Vereine Entlassenen Unterkunft und Arbeit. 1925: Gründung des „Deutschen Reichsverband für Gerichtshilfe, Gefangenen- und Entlassenenfürsorge“ als Dachverband für die Gefängnisvereine
1927: Entwurf eines Strafvollzugsgesetzes (trat allerdings nie in Kraft), das in manchen Bereichen sogar weiter ging als das StVollzG von 1976.
1933 - 45: Stillstand der Diskussion um Entlassenenhilfe, Eingliederung des Reichsverbandes in die NS-Volkswohlfahrt
Ab den 50er Jahren läßt sich ein Differenzierungs- und Professionalisierungsprozeß in der Entlassenenhilfe feststellen. Der Staat richtete in den 50er Jahren die Bewährungshilfe als Sozialen Dienst der Justiz ein.
In den 70er Jahren setzte sich der Begriff der „Resozialisierung“ auch innerhalb der Kriminalpolitik durch, was u.a. auch zum StVollzG von 1976 führte.
In den 80er Jahren entstanden - zunächst im Jugendbereich - verschiedene Diversionsmodelle. Ein Ausgleich zwischen Täter und Opfer wurde als neuer Umgang mit Delinquenz propagiert. Ende der 90er Jahre wurde die Kriminalpolitik zunehmend restriktiver. Ein vermeintlicher Anstieg der Kriminalität führte zur konsequenten Bestrafung von Bagatelldelikten und abweichendem Verhalten.
2. Die Situation Haftentlassener
2.1. Gesellschaftliche Entwicklungen
Bei den gesellschaftlichen Veränderungen der letzten Zeit spricht man von der sog. Risikogesellschaft. Dies bedeutet für den Einzelnen die Freiheit und den Zwang, das eigene Leben bei einer Vielzahl von Möglichkeiten selbst zu gestalten (Individualisierung / Pluralisiserung), wobei auch vielfältige Möglichkeiten des Scheiterns bestehen. Das Risiko des Scheiterns ist groß und muß vom Einzelnen getragen werden. Die Risikogesellschaft „produziert“ Verlierer, die von objektiver Armut und gesellschaftlicher Ausgrenzung betroffen sind. Eine Reaktionsmöglichkeit darauf ist abweichendes Verhalten bzw. Delinquenz.
Die Klienten der Entlassenenhilfe sind in großem Maße Verlierer der Risikogesellschaft (Sozialhilfeempfänger, Wohnungslose, Langzeitarbeitslose, Drogensüchtige, Schuldner etc.), d.h. Menschen, die bereits vor der Haft in kritischen Verhältnissen gelebt haben und für die die (oft schlecht vorbereitete) Entlassung aus der Haft eine zusätzliche Krise darstellt.
2.2. Sozialisationsprozesse in der Haft
Die totale Institution JVA ist charakterisiert durch extrem polare Rollenzuweisung (Vollzugsbeamte - Gefangene). Die Regelung trivialster Alltagsangelegenheiten von den Beamten für die Gefangene ist in besonderem Maße geeignet, diese zu entsubjektivieren. Bei Haftinsassen werden folgende Verhaltensmuster begünstigt: (Wagner, 1984)
- Passivität (Warten, Dösen, Erinnern, Langeweile)
- Kompensatorische Gewöhnung an das hier und jetzt · Narzißmus (Kraftsport, Tätowieren, Onanie)
- Hinwendung zu oraler Befriedigung (Kaffee, Tabak, Essen)
Während der Haftzeit werden Verhaltensweisen gefördert, die für ein straffreies Leben nach der Haft nicht tauglich sind.
2.3. Stigmatisierung und soziale Ächtung
Ein Großteil der Bevölkerung hat eine negative Einstellung gegenüber Strafentlassenen, wobei dies in erster Linie am „Gesessen-haben“ und weniger an der Straftat anknüpft. Entlassene sehen sich von daher hauptsächlich durch den Vollzug stigmatisiert. Die Einstellung der Bevölkerung zu Vollzug und Strafgefangenen ist durch ein hohes Maß an Unkenntnis und Halbwissen gekennzeichnet. (Maelicke, 1979)
Gesellschaftliche Stigmatisierung kann in Richtung eines Zwangs zur Identifizierung mit einer abweichenden Subkultur wirken und erneute Delinquenz (Rückfall) im Sinne einer „Self-fulfilling prophecy“ produzieren (vgl. „Labeling Approach“).
2.3.1. Die Sündenbocktheorie
Tiefenpsychologischer Ansatz: Projektion latent vorhandener eigener Wünsche zur Regelübertretung auf einen „Sündenbock“. Funktion der Projektion ist die Abreaktion innerer Spannungen, Entlastung von eigener Schuld. Nach dieser Theorie büßt der Verbrecher stellvertretend für die Gesellschaft, delinquiert auch stellvertretend für sie, übernimmt die Rolle des Sündenbocks.
Nach dieser Theorie hat die Gesellschaft kein wirkliches Interesse an Resozialisierung, da sie dadurch den Sündenbock als Projektionsventil verliert. (Maelicke, 1979)
2.4. Materielle und persönliche Situation
2.4.1 Materielle Situation
Theoretisch wird dem Gefangenen bei der Entlassung sein Überbrückungsgeld (§ 51 StVollzG) ausbezahlt, von dem er bis zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft seinen Unterhalt bestreiten soll. Für diesen Zeitraum (Bemessungsgrundlage ist der Regelsatz der Sozialhilfe) steht dem Entlassenen keine Sozialhilfe zu. Das Überbrückungsgeld genießt einen besonderen Pfändungsschutz, d.h. es darf nicht zur Tilgung von Schulden verwendet werden, die Strafentlassene in der Regel haben (und wenn es „nur“ die Gerichtskosten sind). Durch fehlende Arbeitsmöglichkeiten in den JVAs verliert das Überbrückungsgeld in der Praxis seine Bedeutung. Für Entlassene aus Untersuchungshaft und kurzer Strafhaft (z.B. Ersatzfreiheitsstrafe) hat das Überbrückungsgeld nahezu keine Bedeutung. Ein Großteil der Klienten der Entlassenenhilfe lebt in Armut. Die Bestreitung des Lebensunterhalts mit Sozialhilfe bzw. anderweitigen Einkünften knapp über Sozialhilfeniveau schließt in der heutigen Gesellschaft weitgehend von der Partizipation am öffentlichen Leben aus. Die teilweise dramatische Überschuldung vieler Klienten sorgt dafür, daß keine Perspektive für ein „normales“ Leben vorhanden ist. Die Reaktion darauf ist häufig die Identifizierung mit einer abweichenden Subkultur (z.B. Wohnungslose), damit rücken sie wieder in den Blickwinkel staatlicher Kontrollen.
2.4.3. Perspektiven am Wohnungs- und Arbeitsmarkt
Strafentlassene konkurrieren auf dem Wohnungsmarkt mit anderen sozial schwachen Bevölkerungsgruppen. Die Tatsache der Strafhaft schreckt viele Vermieter ab (vgl. 2.3. Stigmatisierung). In Nürnberg ist die Situation auf dem Wohnungsmarkt allerdings sehr entspannt. Bezahlbarer Wohnraum ist nahezu in ausreichendem Maße vorhanden. Für viele „Kurzstrafige“ wird die (Warm-)Miete während der Haft durch das Sozialamt übernommen, um Kündigung und Zwangsräumung zu vermeiden.
Auf dem Arbeitsmarkt konkurrieren Strafentlassene als häufig ungelernte Langzeitarbeitslose neben anderen ungelernten Kräften, die nicht vorbestraft sind. Die oft einzige Möglichkeit, eine Arbeit zu finden, ist über Arbeitnehmerüberlassungsfirmen (sog. „Zeitarbeitsfirmen“) mit niedriger Entlohnung.
Es ist das Dilemma einer Gesellschaft mit struktureller Arbeitslosigkeit., daß Randgruppen kaum Zugang zum Arbeitsmarkt haben - und daß, obwohl eine Arbeitsstelle unstrittig als ein wichtiger Faktor von Resozialisierung gilt.
2.4.4. Psychosoziale Situation
Für ein zukünftig straffreies Leben steht der Entlassene vor der Aufgabe des (Wieder- )Aufbaus einer mehr oder weniger „bürgerlichen“ Existenz. Neben der materiellen Grundversorgung bedeutet das den Aufbau tragfähiger Sozialer Kontakte und eine perspektivische Sichtweise der eigenen Biographie („Lebenssinn“). Erschwerend ist, daß eine Vielzahl der Klienten noch nie eine Existenz im bürgerlichen Sinn aufgebaut hatte, eine „normale“ Biographie fehlt.
Die Unfähigkeit, die Alltagsprobleme des „Lebens“ zu meistern, hatten viele schon vor der Haft - dies zeigt sich in Delikten wie Hausfriedensbruch (z.B. im Bahnhof), Diebstahl geringfügiger Sachen, Körperverletzung (unter Alkoholeinfluß) oder Beförderungserschleichung. In der Haft wurden die psychosozialen Probleme eher verschärft als gelöst (vgl. 2.2. Sozialisationsprozesse während der Haft).
Darüber hinaus zeigen viele Strafentlassene Schwierigkeiten, Verantwortung zu übernehmen.
3. Staatliche und freie Entlassenenhilfe
3.1. Soziale Dienste der Justiz
Soziale Dienste der Justiz sind Gerichtshilfe, Sozialdienst in der JVA und Bewährungshilfe (bzw. Führungsaufsicht). Als Entlassenenhilfe im weitesten Sinne lassen sich der Sozialdienst der JVA und die Bewährungshilfe / Führungsaufsicht verstehen. Gemeinsam ist den Sozialen Diensten der Justiz, daß sie Soziale Hilfen im Auftrag der Justizbehörden anbieten, aber auch eine Kontrollfunktion gegenüber den Klienten haben.
3.1.1. Sozialdienst der JVA
Der Sozialdienst der JVA hat die rechtliche Grundlage in §§ 71 ff. StVollzG. Jeder Strafgefangene hat das Recht auf Soziale Hilfen, u.a. zur Entlasssungsvorbereitung („eine gute Entlassenenhilfe beginnt bereits mit dem Tag der Inhaftierung“). Einschränken muß man allerdings, daß der Sozialdienst der JVA oft überlastet ist (z.B. im bayerischen Durchschnitt ein SozPäd auf mehr als 100 Inhaftierte) und daß die Zuständigkeit mit dem Tag der Entlassung aufhört (Ausnahme: Sozialtherapeutische JVA).
3.1.2. Bewährungshilfe / Führungsaufsicht
Die Rechtsgrundlage für die Bewährungshilfe sind die §§ 56, 57 StGB, wobei für die Entlassenenhilfe eigentlich nur die Bewährungshilfe nach § 57 StGB eine Rolle spielt (Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung). Der/die BewährungshelferIn hat das Doppelmandat, zum einen Soziale Hilfe anzubieten, zum anderen die Einhaltung von Weisungen und Auflagen zu überwachen und dem Gericht regelmäßig über die Lebensführung des Probanden zu berichten. Die Kontrollfunktion gegenüber dem Klienten ist nicht unproblematisch, wenn sie nicht frühzeitig transparent gemacht wird. Die Soziale Hilfe, die die Bewährungshilfe anbieten kann, entspricht in etwa der Beratung und Betreuung in der freien Entlassenenhilfe.
Rechtsgrundlage für die Führungsaufsicht sind die §§ 68, 68a-f StGB. Entlassene werden i.d.R. bei schlechter Sozialprognose unter Führungsaufsicht gestellt, die rechtlich festgestellten Unterschiede für die Klienten machen in der Praxis allerdings kaum einen Unterschied (Maelicke 1988). Auch für die Struktur des Klientels und die praktische Arbeit mit ihm läßt sich weitgehend das gleiche wie für die Bewährungshilfe sagen.
3.2. Freie Entlassenenhilfe
Die freie (nicht justizförmige) Straffälligen- und Entlassenenhilfe ist gesetzlich grundsätzlich in § 72 BSGH geregelt (Hilfe in besonderen Lebenslagen). Träger der freien Entlassenenhilfe sind öffentliche und private Träger, Kostenträger ist i.d.R. der überörtliche Träger der Sozialhilfe. Freie Entlassenenhilfe versteht sich grundsätzlich als durchgängige Hilfe, schließt also Prophylaxe mit ein, sowie Hilfe für die Angehörigen von Straffälligen. Für die Aufgabenwahrnehmung ist es wichtig, daß sich die freie Straffälligenhilfe deutlich von den Sozialen Diensten der Justiz abgrenzt und damit ihre eigenen Handlungsprinzipien betont: Freiwilligkeit, ganzheitliche Hilfen, Hilfen für spezielle Zielgruppen und evtl. eigene materielle Ressourcen.
Begleitende oder spezifische Hilfen für Haftentlassene werden aber auch von allgemeinen Sozialdiensten, durch Gemeinwesenarbeit oder Spezialdienste (z.B. Drogenhilfe, Nichtseßhaftenhilfe) geleistet.
3.3. Das Klientel
Das Klientel der Entlassenenhilfe ist i.d.R. männlich, zwischen 20 und 40 Jahren alt, der Sozialen Unterschicht angehörig und hat nur eine kurze Haftstrafe verbüßt (oft auch Ersatzfreiheitsstrafe). Die Klienten der Entlassenenhilfe sind in der Regel mehrfach sozial belastet. Neben der Haftentlassung und ihren Folgen haben viele Suchtprobleme, Schulden, keine Ausbildung, Partnerschaftsschwierigkeiten, keine tragfähigen sozialen Beziehungen und vieles mehr.
4. Methoden der Haftentlassenenhilfe
Am Beispiel der Zentralstellen in Österreich (Quelle: VBSA, Wien)
4.1. Einzelfallorientierte Maßnahmen:
- Beratung, Krisenintervention: Sicherung des Lebensunterhalts, Vermittlung einer Wohnmöglichkeit, allgemeine Rechtsberatung, Beratung in Fragen des täglichen Lebens
- Betreuung: sinnvoll, wenn Klienten in sog. Dauerkrisen leben; intensive Form der Einzelfallarbeit, Eingriff in die Alltagswelt des Klienten
- Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeiter: z.B. hinsichtlich psychiatrischer Erscheinungsbilder oder zur Erweiterung des Methodenrepertoires
- Tagesstrukturierende Angebote: geschützter Raum, Treffpunkt, soziales Lernfeld
- Begleitung: längerfristiger Kontakt von Klienten zu einer Beratungsstelle
- Niederschwellige Arbeitstrainingsangebote: Trainingsprogramme (Zuverlässigkeit, Belastbarkeit, Probleme lösen) bei gleichzeitiger intensiver Sozialpädagogischer Betreuung
- Arbeitsberatung: Arbeitsvermittlung, Vermittlung in Arbeitstrainings- und Qualifizierungsmaßnahmen
4.2. Einzelfallübergreifende Initiativen:
- Wohnen: Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum und Notunterkünften
- Koordinierte Straffälligenhilfe: Vernetzung der bestehenden Angebote
- Kooperation mit Justizanstalten und Entlassungsgerichten: „eine gute Entlassenenhilfe beginnt bereits mit dem Tag der Inhaftierung“
- Prävention: Einflußnahme auf gesellschaftliche Entwicklungen, psychosoziale Mangelsituationen von sozial Schwachen „entschärfen“
- Informationsarbeit: Zusammenhänge zwischen Sozialpolitik, Kriminalitätspolitik und Kriminalitätsentwicklung transparent machen
5. Vorstellung von Angeboten der Entlassenenhilfe in Nürnberg
vgl. Organigramm S. 6
6. Diskussion
Statistische Daten zum Klientel
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Geschichte der Entlassenenhilfe?
Die Geschichte der Entlassenenhilfe ist eng mit privaten Initiativen und freien Trägern verbunden. Der Staat hat sich traditionell bei der Wiedereingliederung Straffälliger zurückgehalten. Im 19. Jahrhundert entstanden Gefängnisvereine, die sich um die Betreuung von Strafgefangenen kümmerten. Nach dem zweiten Weltkrieg kam es zu einem Professionalisierungsprozess.
Welche gesellschaftlichen Entwicklungen beeinflussen die Situation Haftentlassener?
Die sogenannte Risikogesellschaft prägt die Situation. Individualisierung und Pluralisierung führen zu vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten, aber auch zu Risiken des Scheiterns. Haftentlassene sind oft Verlierer dieser Risikogesellschaft.
Wie beeinflusst die Haft Sozialisationsprozesse?
Die JVA ist eine totale Institution mit polarer Rollenzuweisung. Routine wird für die Gefangenen angeordnet, was zu Passivität und kompensatorischen Verhaltensweisen führt. Diese sind wenig geeignet für ein straffreies Leben nach der Haft.
Welche Rolle spielen Stigmatisierung und soziale Ächtung?
Die Bevölkerung hat oft eine negative Einstellung gegenüber Strafentlassenen, was zu Stigmatisierung führt. Dies kann zur Identifizierung mit einer abweichenden Subkultur und erneuter Delinquenz führen (Self-fulfilling prophecy).
Wie sieht die materielle Situation von Haftentlassenen aus?
Haftentlassene erhalten Überbrückungsgeld, um ihren Lebensunterhalt zu sichern. Dieses Geld ist oft nicht ausreichend und genießt Pfändungsschutz. Arbeitslosigkeit und Schulden verschärfen die Situation.
Wie sind die Perspektiven am Wohnungs- und Arbeitsmarkt?
Strafentlassene konkurrieren mit anderen sozial schwachen Gruppen auf dem Wohnungsmarkt. Vorstrafen erschweren die Wohnungssuche. Auf dem Arbeitsmarkt haben sie schlechte Chancen aufgrund von Vorstrafen und fehlender Qualifikation.
Wie sieht die psychosoziale Situation aus?
Haftentlassene stehen vor der Aufgabe, eine bürgerliche Existenz aufzubauen. Viele haben jedoch noch nie eine solche Existenz gehabt und haben Schwierigkeiten, Alltagsprobleme zu bewältigen.
Welche Rolle spielen die Sozialen Dienste der Justiz?
Zu den Sozialen Diensten der Justiz gehören Gerichtshilfe, Sozialdienst in der JVA und Bewährungshilfe. Sie bieten Soziale Hilfen an, haben aber auch eine Kontrollfunktion.
Was macht der Sozialdienst der JVA?
Der Sozialdienst der JVA bereitet Strafgefangene auf die Entlassung vor. Er ist jedoch oft überlastet und seine Zuständigkeit endet mit der Entlassung.
Was ist die Aufgabe der Bewährungshilfe?
Die Bewährungshilfe bietet Soziale Hilfe an, überwacht aber auch die Einhaltung von Weisungen und Auflagen. Die Kontrollfunktion kann problematisch sein.
Was versteht man unter freier Entlassenenhilfe?
Die freie Entlassenenhilfe ist gesetzlich geregelt und wird von öffentlichen und privaten Trägern angeboten. Sie unterscheidet sich von den Sozialen Diensten der Justiz durch Freiwilligkeit, ganzheitliche Hilfen und Hilfen für spezielle Zielgruppen.
Wie sieht das Klientel der Entlassenenhilfe aus?
Das Klientel ist meist männlich, zwischen 20 und 40 Jahren alt, der Sozialen Unterschicht angehörig und hat nur eine kurze Haftstrafe verbüßt. Sie haben oft Suchtprobleme, Schulden und keine Ausbildung.
Welche Methoden werden in der Haftentlassenenhilfe angewendet?
Es gibt einzelfallorientierte Maßnahmen wie Beratung, Betreuung, Fortbildungsmaßnahmen, tagesstrukturierende Angebote, Begleitung, Arbeitstrainingsangebote und Arbeitsberatung sowie einzelfallübergreifende Initiativen wie die Bereitstellung von Wohnraum, koordinierte Straffälligenhilfe, Kooperation mit Justizanstalten und Entlassungsgerichten, Prävention und Informationsarbeit.
Welche Angebote der Entlassenenhilfe gibt es in Nürnberg?
Es gibt verschiedene Angebote der Entlassenenhilfe in Nürnberg, die in einem Organigramm dargestellt sind (nicht in dieser Leseprobe enthalten).
- Citation du texte
- Andreas Meier (Auteur), 2000, Entlassenenhilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98078