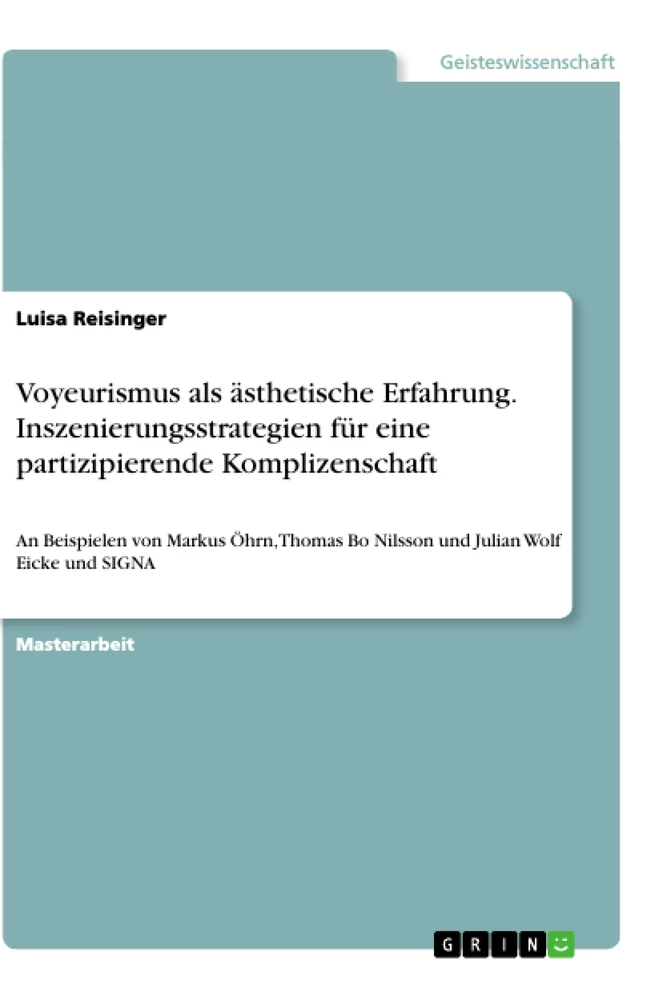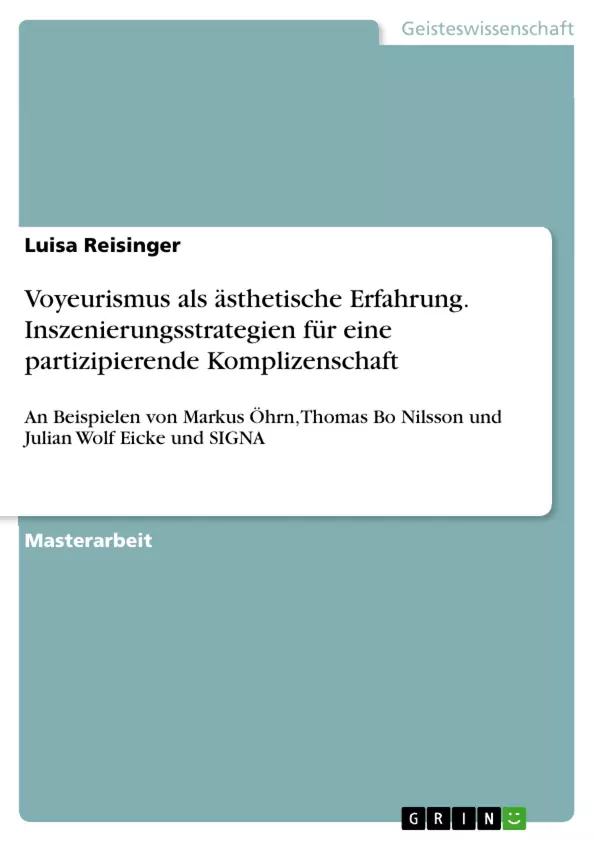Was die Performances von Markus Öhrn, Thomas Bo Nilsson & Julian Wolf Eicke sowie SIGNA zeigen, dass in einem ästhetisch erzeugten Voyeurismus mehr steckt, als eine Provokation. Hier werden voyeuristische Blickposition inszenatorisch hervorgebracht, hinter diesen eine partizipierende Komplizenschaft liegt, die den Zuschauer in seiner Rolle als stupiden Beobachter hinterfragt. Die voyeuristischen Akte, die in den Performances evoziert werden, werden hier als ästhetische Erfahrungen definiert, die den Zuschauenden über einen Schwellenstatus in einen Modus des Reflektierens bringen und dadurch die Perspektiven auf das Gesehene neu verhandeln.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 DAU oder die Provokation eines voyeuristischen Spektakels
- 2 Medialer Voyeurismus
- 2.1 Wir, Voyeure einer visuellen Kultur?
- 2.2 Verfremdung, Spieltrieb, Einfühlung: Über das transformatorische Potenzial von Voyeurismus
- 3 Voyeurismus: Dimensionen eines Phänomens
- 3.1 Der Zuschauer als Voyeur
- 3.2 Blick-Akt-Theorien: Von Maurice Merleau-Ponty zu Jacques Lacan
- 3.2.1 Maurice Merleau-Ponty und der Blick als sinnliche Instanz
- 3.2.2 Jean-Paul Sartre und die Objektivierung des Blicks
- 3.2.3 Jacques Lacan und der Blick als Trieb
- 3.3 Skopophilie oder die Lust am Schauen
- 3.3.1 Die feministische Perspektive oder die Frau und ihr Mangel
- 3.3.2 Female gaze vs. male gaze?
- 3.4 Der entkörperte Voyeur: Über Masken und Überwachungskameras
- 3.4.1 Gefangen in Foucaults Panopticon
- 3.4.2 Wenn die Welt, die Welt erblickt…
- 3.5 Die performative Befreiung des Voyeurs: Ein Zwischenfazit
- 4 Von versteckten Beobachtern und sichtbaren Aktivisten
- 4.1 Markus Öhrn: 3 Episodes of Life oder der Voyeur als Mitwisser
- 4.1.1 Maskierte Blicke als Verfremdungseffekt
- 4.1.2 Aktivierende Appelle
- 4.1.3 Den Theatersaal verlassen…
- 4.2 Thomas Bo Nilsson & Julian Wolf Eicke: Betreutes Leben oder der anonyme Voyeur
- 4.2.1 www.ichwilldeinebrüstesehen oder der Verlust der Realität
- 4.2.2 Die Online-Gemeinde als Überwacher
- 4.2.3 Auf dem Spielfeld der Perspektiven
- 4.3 SIGNA: Das halbe Leid oder der Voyeur als Täter
- 4.3.1 Sehen und gesehen werden: Blickinteraktionen als Begehr
- 4.3.2 Die Provokation der Einfühlung oder wie ich zur Schlägerin wurde
- 4.3.3 Wer partizipiert, ist sichtbar oder über den Mehrwert einer aktiven Teilnahme
- 5 Der voyeuristische Akt als Perspektivenwechsel
- 5.1 Plädoyer für eine partizipierende Komplizenschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht Voyeurismus als ästhetische Erfahrung und analysiert Inszenierungsstrategien, die eine partizipative Komplizenschaft des Zuschauers erzeugen. Die Arbeit fokussiert auf ausgewählte Beispiele von Markus Öhrn, Thomas Bo Nilsson & Julian Wolf Eicke und SIGNA.
- Voyeurismus als ästhetisches Phänomen
- Inszenierungsstrategien und ihre Wirkung auf den Zuschauer
- Partizipation und Komplizenschaft im Kontext des Voyeurismus
- Analyse ausgewählter Kunstwerke
- Theorien des Blicks und der Skopophilie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Voyeurismus als ästhetische Erfahrung ein und benennt die ausgewählten Beispiele von Ilya Khrzhanovskys DAU, Markus Öhrns 3 Episodes of Life, Thomas Bo Nilssons & Julian Wolf Eickes Betreutes Leben und SIGNAs Das halbe Leid. Sie skizziert den Ansatz der Arbeit, der darin besteht, die Inszenierungsstrategien dieser Werke zu analysieren und deren Potenzial für eine partizipative Komplizenschaft zu untersuchen. Der Fokus liegt auf der bewussten Wahrnehmung und Hinterfragung des voyeuristischen Rezipierens, wobei die Entscheidung über den Grad der Eintauchung in die dargestellten Parallelwelten beim Zuschauer liegt.
2 Medialer Voyeurismus: Dieses Kapitel beleuchtet den Voyeurismus im Kontext der visuellen Medienkultur und untersucht seine transformatorischen Möglichkeiten. Es wird diskutiert, wie Verfremdung, Spieltrieb und Einfühlung durch voyeuristische Inszenierungen gefördert werden können und wie der Zuschauer durch gezielte Gestaltungselemente aktiv in den Prozess eingebunden wird. Der Kapitel behandelt die komplexen Wechselwirkungen zwischen Zuschauer und dargestellter Handlung.
3 Voyeurismus: Dimensionen eines Phänomens: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit verschiedenen Dimensionen des Voyeurismus. Es analysiert die Rolle des Zuschauers als Voyeur und untersucht verschiedene Blick-Akt-Theorien von Merleau-Ponty, Sartre und Lacan. Die Konzepte der Skopophilie und die feministische Perspektive auf den Blick werden ebenfalls beleuchtet. Der Einfluss von Masken und Überwachungskameras auf die Erfahrung des Voyeurismus wird unter Einbezug von Foucaults Panopticon-Konzept erörtert. Schließlich wird ein Zwischenfazit gezogen, das die performative Befreiung des Voyeurs im Kontext der betrachteten Theorien diskutiert.
4 Von versteckten Beobachtern und sichtbaren Aktivisten: Dieses Kapitel analysiert die ausgewählten Beispiele von Markus Öhrn, Thomas Bo Nilsson & Julian Wolf Eicke und SIGNA im Detail. Es untersucht, wie die jeweiligen Inszenierungen den Voyeurismus thematisieren und welche Strategien eingesetzt werden, um eine aktive Beteiligung des Zuschauers zu erreichen. Die Kapitel beschreibt, wie verschiedene Werk die Rolle des Voyeurs und das Spannungsfeld zwischen Beobachtung und Partizipation ausloten und auf verschiedene Arten die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lassen. Es werden die unterschiedlichen Ansätze der Künstler verglichen und in ihrem Bezug zum Voyeurismus beleuchtet.
5 Der voyeuristische Akt als Perspektivenwechsel: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der vorherigen Kapitel zusammen und plädiert für eine partizipative Komplizenschaft als produktive Form des Engagements mit voyeuristischen Darstellungen. Es werden die ethischen und ästhetischen Implikationen des Voyeurismus und der aktiven Zuschauerbeteiligung erörtert, und ein abschließendes Fazit wird gezogen.
Schlüsselwörter
Voyeurismus, ästhetische Erfahrung, Inszenierungsstrategien, partizipative Komplizenschaft, visuelle Kultur, Blick-Akt-Theorien, Skopophilie, feministische Perspektive, Foucaults Panopticon, Markus Öhrn, Thomas Bo Nilsson & Julian Wolf Eicke, SIGNA, DAU, Realität und Fiktion, Performancekunst, Medienanalyse.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Voyeurismus als ästhetische Erfahrung
Was ist das Thema der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht Voyeurismus als ästhetische Erfahrung und analysiert Inszenierungsstrategien, die eine partizipative Komplizenschaft des Zuschauers erzeugen. Der Fokus liegt auf ausgewählten Beispielen von Markus Öhrn, Thomas Bo Nilsson & Julian Wolf Eicke und SIGNA.
Welche Künstler und Werke werden analysiert?
Die Arbeit analysiert die Werke von Markus Öhrn (3 Episodes of Life), Thomas Bo Nilsson & Julian Wolf Eicke (Betreutes Leben) und SIGNA (Das halbe Leid). Zusätzlich wird Ilya Khrzhanovskys DAU als einführendes Beispiel erwähnt.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind Voyeurismus als ästhetisches Phänomen, Inszenierungsstrategien und deren Wirkung auf den Zuschauer, Partizipation und Komplizenschaft im Kontext des Voyeurismus, Theorien des Blicks (Merleau-Ponty, Sartre, Lacan), Skopophilie, die feministische Perspektive auf den Blick, Foucaults Panopticon und die Grenzen zwischen Realität und Fiktion.
Welche Theorien werden angewendet?
Die Arbeit bezieht sich auf Blick-Akt-Theorien von Merleau-Ponty, Sartre und Lacan, das Konzept der Skopophilie und die feministische Perspektive auf den Blick. Foucaults Panopticon-Konzept spielt ebenfalls eine Rolle.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, ein Kapitel zu medialem Voyeurismus, ein Kapitel zu den Dimensionen des Voyeurismus, ein Kapitel zur Analyse der ausgewählten Kunstwerke und ein abschließendes Kapitel, das einen Perspektivenwechsel und ein Plädoyer für eine partizipative Komplizenschaft beinhaltet.
Welche Kapitelzusammenfassungen werden gegeben?
Die Zusammenfassung der Kapitel beschreibt den Inhalt jedes Kapitels detailliert. Kapitel 1 führt in das Thema ein, Kapitel 2 behandelt medialem Voyeurismus, Kapitel 3 verschiedene Dimensionen des Voyeurismus, Kapitel 4 analysiert die ausgewählten Kunstwerke und Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen und zieht ein Fazit.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind Voyeurismus, ästhetische Erfahrung, Inszenierungsstrategien, partizipative Komplizenschaft, visuelle Kultur, Blick-Akt-Theorien, Skopophilie, feministische Perspektive, Foucaults Panopticon, Markus Öhrn, Thomas Bo Nilsson & Julian Wolf Eicke, SIGNA, DAU, Realität und Fiktion, Performancekunst und Medienanalyse.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist die Untersuchung von Voyeurismus als ästhetische Erfahrung und die Analyse der Inszenierungsstrategien, die eine partizipative Komplizenschaft des Zuschauers erzeugen.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit?
Die Arbeit plädiert für eine partizipative Komplizenschaft als produktive Form des Engagements mit voyeuristischen Darstellungen und erörtert die ethischen und ästhetischen Implikationen.
- Quote paper
- Luisa Reisinger (Author), 2020, Voyeurismus als ästhetische Erfahrung. Inszenierungsstrategien für eine partizipierende Komplizenschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/981141