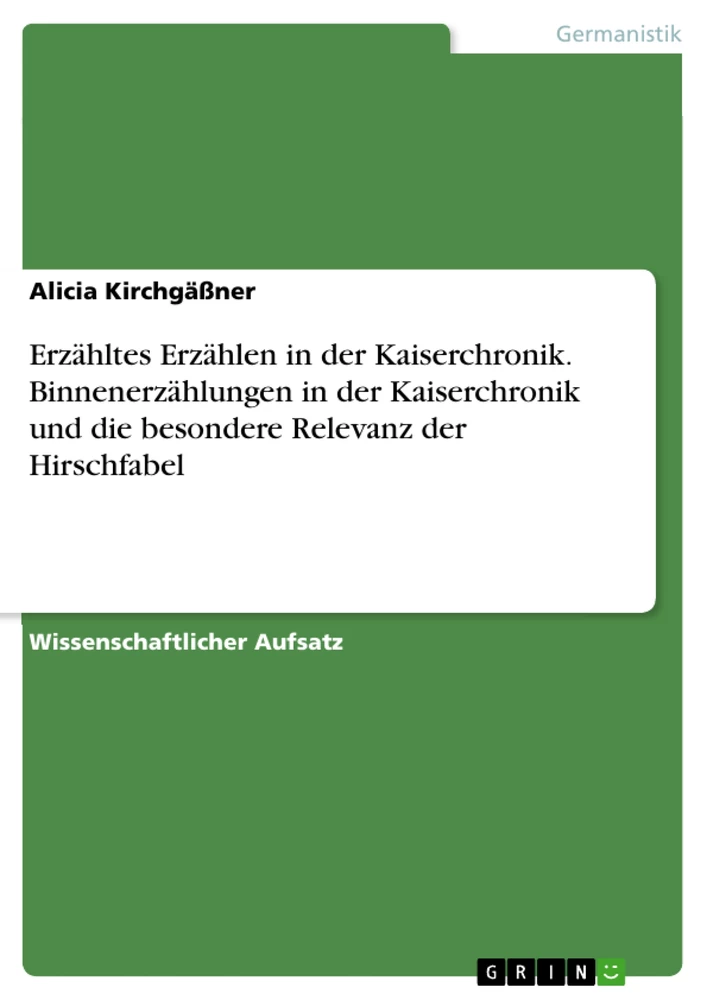Die Kaiserchronik stellt eines der relevantesten frühmediävistischen Werke dar. Durch ihre literarische Komplexität und rhetorischen Besonderheiten sowie durch ihre historisch ausführliche Beschreibung bildet sie einen wichtigen Ausgangspunkt für die spätere Literatur. Eine der auffallendsten Besonderheiten innerhalb des Werkes stellt das erzählte Erzählen dar. Innerhalb der Grundhandlung fügen sich immer wieder, auf verschiedenen Ebenen, weitere Erzählungen ein. Während dieser Sachpunkt bereits literarisch als sehr wichtig gilt, gibt es eine Unterhandlung, die besonders interessant und dadurch auch literaturwissenschaftlich extrem relevant ist. Die Grundlagen des Werks, das Prinzip des erzählten Erzählens sowie eine genaue Aufschlüsselung der relevanten Textstelle sind Basis und Ziel dieser Arbeit. Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf den verschiedenen Erzählfunktionen, Interpretationen und Topoi sowie einem Vergleich mit anderen typischeren Untererzählungen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Grundlagen
- 1.1 Einleitung
- 1.2 Binnenerzählung
- 1.3 Die Fabel
- 1.4 Die Kaiserchronik
- 1.5 Severus und Adelger
- 2 Binnenerzählungen in der Kaiserchronik
- 2.1 Verschiedene Arten der Binnenerzählung in der Kaiserchronik
- 2.2 Fabel in Severus und Adelger
- 2.3 Vergleich mit anderen Binnenerzählungen in der Kaiserchronik
- 3 Fazit
- 4 Anhang
- 4.1 Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen des erzählten Erzählens in der Kaiserchronik, insbesondere mit der Binnenerzählung der Hirschfabel in der Severus- und Adelger-Episode. Sie untersucht die Bedeutung der Fabel im Kontext der Kaiserchronik und stellt sie in Beziehung zu anderen Binnenerzählungen. Das Ziel ist es, die Funktionen, Interpretationen und Topoi dieser Binnenerzählung zu beleuchten und ihren Einfluss auf die literarische Tradition aufzuzeigen.
- Die Kaiserchronik als bedeutendes frühmediävistisches Werk mit seiner komplexen literarischen Struktur und rhetorischen Besonderheiten
- Das Phänomen des erzählten Erzählens, insbesondere die Funktion und Bedeutung von Binnenerzählungen
- Die Hirschfabel als exemplarisches Beispiel für eine Binnenerzählung in der Kaiserchronik
- Der Vergleich der Fabel mit anderen Binnenerzählungen in der Kaiserchronik
- Der Einfluss von Binnenerzählungen auf die spätere Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
1 Grundlagen
Das erste Kapitel führt in die Kaiserchronik als eines der bedeutendsten Werke der frühmittelhochdeutschen Literatur ein. Es beschreibt die Besonderheit des erzählten Erzählens und definiert den Begriff der Binnenerzählung. Außerdem werden die verschiedenen Funktionen und Topoi von Binnenerzählungen erläutert. Das Kapitel geht speziell auf die Fabel als eine Form der Binnenerzählung ein, beschreibt ihre charakteristischen Merkmale und ihren Einfluss auf die Literaturgeschichte.
2 Binnenerzählungen in der Kaiserchronik
Das zweite Kapitel widmet sich der Analyse der Binnenerzählungen in der Kaiserchronik. Es werden verschiedene Arten von Binnenerzählungen innerhalb des Werkes untersucht, insbesondere die Fabel in der Severus- und Adelger-Episode. Durch den Vergleich mit anderen Binnenerzählungen wird die Funktion der Fabel und ihr Stellenwert im Gesamtwerk deutlich.
3 Fazit
Der dritte Abschnitt des Textes wird nicht zusammengefasst, um Spoiler zu vermeiden.
Schlüsselwörter
Kaiserchronik, Binnenerzählung, Fabel, Severus, Adelger, Hirschfabel, Topoi, frühmittelhochdeutsche Literatur, Erzählstruktur, Rhetorik, Translatio Imperii
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Besondere an der "Kaiserchronik"?
Die Kaiserchronik ist ein bedeutendes frühmediävistisches Werk, das sich durch seine literarische Komplexität und das Stilmittel des "erzählten Erzählens" auszeichnet.
Was bedeutet "erzähltes Erzählen"?
Es beschreibt die Struktur von Binnenerzählungen, bei denen innerhalb der Haupthandlung weitere Geschichten auf verschiedenen Ebenen eingefügt werden.
Welche Rolle spielt die "Hirschfabel" in der Arbeit?
Die Hirschfabel in der Severus- und Adelger-Episode wird als besonders relevante Binnenerzählung analysiert, um Funktionen und Topoi des Werks aufzuschlüsseln.
Was ist eine Binnenerzählung?
Eine Erzählung, die von einer Figur innerhalb der Rahmenhandlung eines literarischen Werkes vorgetragen wird.
Welche Themen werden in der Kaiserchronik behandelt?
Das Werk behandelt historische Beschreibungen, die Translatio Imperii sowie moralische und rhetorische Topoi der frühmittelhochdeutschen Literatur.
- Arbeit zitieren
- Alicia Kirchgäßner (Autor:in), 2020, Erzähltes Erzählen in der Kaiserchronik. Binnenerzählungen in der Kaiserchronik und die besondere Relevanz der Hirschfabel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/981186