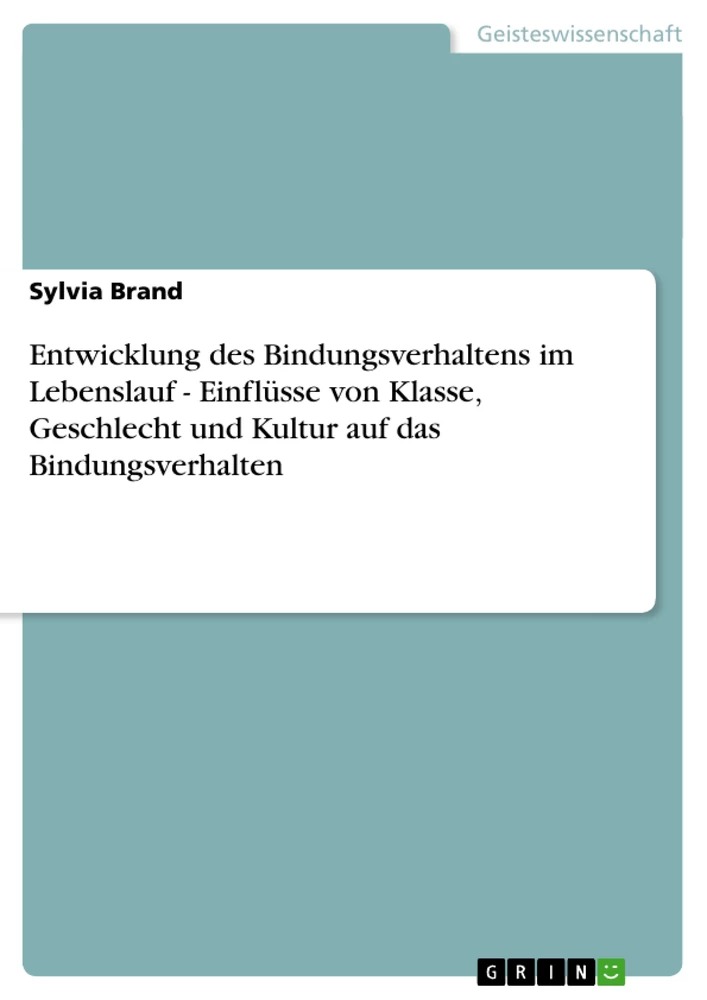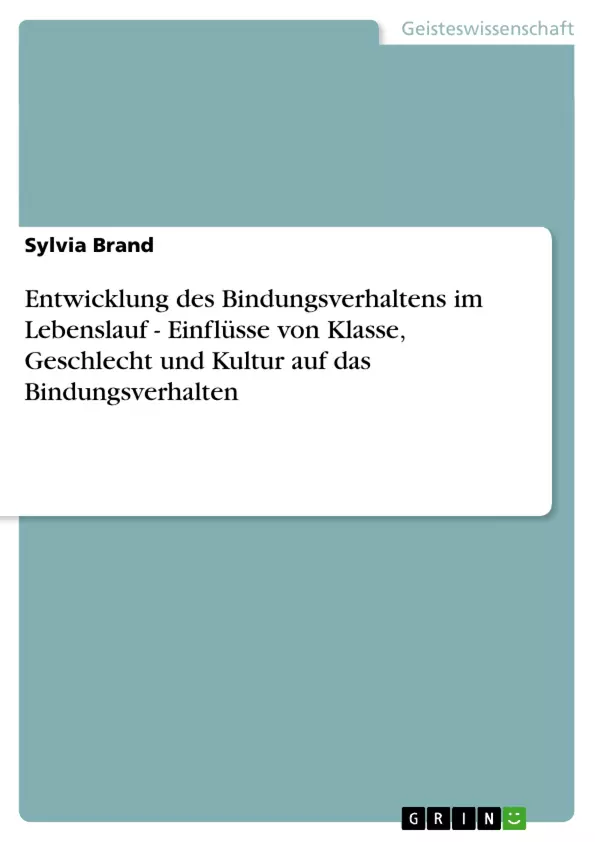Universität Gesamthochschule Siegen
Seminar: Ausgewählte Fragestellungen zur Entwicklungspsychologie der Lebensspanne WS 1997/98
Referat zum Thema:
Entwicklung des Bindungsverhaltens im Lebenslauf - Teil IV: Einflüsse von Klasse, Geschlecht und Kultur auf das Bindungsverhalten
Sylvia Brand
Studiengang: Wirtschaftswissenschaft/ Anglistik/ Sozialwissenschaften auf Lehramt Semester: 3
ESL-Grundstudium
Einflüsse auf das Bindungsverhalten:
Die Effekte von Klasse, Kultur und Geschlecht auf das Bindungsverhalten
Egal, wo auf dieser Welt Kinder aufwachsen, bauen sie Bindungen auf. Aber zwischen den Klassen und Kulturen unserer Welt, gibt es verschiedene Arten und Qualitäten von Bindungen, die von bestimmten Umständen beeinflußt werden.
In verschiedenen Klassen und Kulturen haben die Mütter ihre Kinder unterschiedlich häufig im Arm, reden unterschiedlich viel mit ihnen, widmen ihnen mehr oder weniger Zeit und sind unterschiedlich ängstlich.
Auch die Lehrmethoden in verschiedenen Klassen und Kulturen unterscheiden sich. Diejenigen Eigenschaften, die Eltern bei ihren Kindern als besonders wichtig ansehen, werden von ihnen bestärkt andere sogenannte negative Eigenschaften werden unterdrückt. Dabei gibt es nicht nur kulturelle- und klassenspezifische Unterschiede, sondern spielt auch das Geschlecht eine Rolle.
All diese unterschiedlichen Verhaltensweisen und Gewohnheiten der Eltern gegenüber ihren Kindern beeinflussen deren Bindungsverhalten. Manche Kinder entwickeln ein spezifisches Bindungsverhalten früher als andere, einige entwickeln ein sicheres, andere ein unsicheres Bindungsverhalten.
Es ist nicht unbedingt zwingend, daß ein Kind zu seiner Mutter die engste Bindung aufbaut. In anderen Kulturen z.B. sind andere Verwandte für die Kinderversorgung verantwortlich. In unserer modernen Gesellschaft wird die Kindererziehung immer mehr in institutionalisierte Einrichtungen verlagert. Außerdem hat auch die Rolle des Vaters eine wachsende Bedeutung.
Klasse
Die soziale Klasse einer Person ist im wesentlichen abhängig von ihrer schulischen Bildung, ihrem Beruf und dem Einkommen. Man geht davon aus, daß die soziale Klasse den Bildungsweg, die soziale Macht und viele andere Chancen im Leben beeinflußte. Klasse hat auch einen wichtigen Einfluß auf die Entwicklung des Bindungsverhaltens beim Kind.
Eltern aus der Arbeiterklasse verbringen wesentlich weniger Zeit mit ihren Kindern als Eltern aus der Mittelklasse. Zum einen haben Angehörige niedrigerer sozialer Klassen häufig mehr Kinder und somit weniger Zeit für jedes einzelne. Zum anderen erhöhen finanzielle Schwierigkeiten und harte körperliche Arbeit die Steßbelastungen auf Eltern. Dieses gilt als ein Grund, warum Eltern aus einkommensschwächeren Schichten weniger auf die sozialen und emotionalen Bedürfnisse ihrer Kinder eingehen (Mc Loyd, Ceballo, and Mangelsdorf 1993)1/.
Untersuchungen haben gezeigt, daß Mütter der oberen Klasse eher die Stimmen ihrer Kinder nachahmen, sie eher ermutigen und loben als Mütter niedriger sozialer Klassen.2
Man stellte auch fest, daß je mehr schulische Bildung eine Mutter hatte, um so mehr redete sie mit ihrem Baby. Zum Beispiel versuchen Mütter aus unteren Schichten weinende oder unruhige Babys mit Essen zur Ruhe zu bringen, wohingegen Mütter höherer Schichten Probleme mit Reden zu lösen versuchen (Kagan und Tulkin, 1971)3/.
Mary Ainsworth und ihre Mitarbeiter untersuchten in diesem Zusammenhang die Beziehung zwischen mütterlichem Verhalten und dem Bindungsverhalten der Kinder. Sie stellten fest, daß der auffallende Unterschied zwischen sicher und unsicher gebundenen Kindern auf die Sensibilität der Mütter für Signale und Kommunikationen ihrer Kinder zurückzuführen war.4
Die sicher gebundenen Kinder hatten in der Regel Mütter, die schnell und präzise auf Signale ihrer Sprößlinge reagierten. Im Gegensatz dazu hatten ängstlich gebundene Kinder häufig Mütter, die eher auf der Basis ihrer eigenen Bedürfnisse reagierten. Die Kinder, die den Kontakt vermieden, hatten meist ablehnende Mütter, die selbst eine Aversion gegen engen körperlichen Kontakt zu haben schienen.
Diese Arbeit verstärkte den Eindruck, daß das Bindungsverhalten irgendwie mit der Kommunikationsfähigkeit der Mutter und dadurch mit dem Gefühl der Beherrschbarkeit oder Kontrolle zusammenzuhängen scheint, die das Kind mit seiner Umwelt Umgebung zu erwarten lernt. Wenn die frühen Erfahrungen des Kindes mit seiner Umwelt es lehren, daß seine Handlungen in keiner Weise mit den Reaktionen anderer zusammenhängen, dann kann das Vertrauen des Kindes zu sich selbst und zu anderen ernsthaft geschädigt werden.5
Kultur
Viele Wissenschaftler glauben, daß die Unterschiede in der Kindererziehung verschiedener ethnischer Gruppen dazu dienen, die Kinder auf ihre wirtschaftliche, politische und soziale Rolle in dieser Gruppe vorzubereiten (Ogbu, 1981)6/.
So legen die Eltern in allen Kulturen Wert auf gut erzogene Kinder. Die Frage ist aber: Was kennzeichnet ein gut erzogenes Kind?
Wohingegen puerto-ricanischen Mütter Gehorsam und Respekt als wichtig ansehen, geht es den Anglo-Amerikanischen Mütter eher darum, daß sich ihre Kinder sicher fühlen (Harwood, 1992).7
Amerikaner afrikanischer Abstammung sehen z.B. die Körperbeherrschung ihrer Kinder als das ausschlaggebenste Merkmal an. Daher spornen sie ihre Kinder viel eher zum Laufen und zum selbstständigen auf die Toilette gehen an als anglo-amerikanische Eltern. Hierbei ist die Kultur wie in vielen anderen Fällen nur schwer von der Klasse zu trennen. So legen Angehörige niedriger sozialer Klassen bei ihren Kindern z.B. mehr Wert auf motorische Eigenschaften als auf kognitive. Daher werden motorische Eigenschaften von diesen Eltern mehr bestärkt. 8
Eine Studie (Garcia-Coll, 1990)9 zeigte, das mexikanische Mütter weniger mit ihren Kindern sprachen, sie dafür aber öfter in den Arm nahmen als amerikanische Mütter. Eine Untersuchung von Mary Ainstworth in Uganda und von Schaffer und Emmerson in Schottland zeigte, daß Mütter in Uganda wesentlich mehr mit ihren Kindern interagieren als Mütter aus einem europäischen Land, aus diesem Grund entwickelten die Kinder in Uganda schneller ein spezifisches Bindeverhalten als diejenigen aus Europa.
Amerikanische Kinder verbringen viel Zeit in Kindersitzen Krabbelecken usw. weniger in den Armen ihrer Mutter. Kinder von Urwaldbewohnern dagegen werden den ganzen Tag auf dem Arm oder dem Rücken getragen, auch wenn sie schon laufen können. Dies ist für sie lebenswichtig, weil es für sie auf dem Boden viel zu gefährlich wäre.
Vor etwa dreissig Jahren stellte Urie Bronfenbrenner fest, das Babys in der Sowjetunion wesentlich häufiger geküßt und umarmt wurden, als amerikanische Babys. Auf der anderen Seite stand man ihnen aber auch wesentlich weniger Bewegungsfreiheit zu. Sovjetische Mütter waren so beschützend und ängstlich, daß sie ihre Kinder in ihrem natürlichen Bewegungs- und Entdeckungsdrang behinderten.
Lehrmethoden
Lernen im bildungstheoretischen Sinne besteht im westentlichen in der Unterscheidung zwischen vertraut und fremd. Dabei bestimmen die lernpsychologischen Kategorieen ,,Lob" und ,,Tadel" nicht die Bindung selbst sondern die Entwicklung der Bildungsqualität.
Bindungssicherheit ermöglicht die Erkundung, während aktivierte Bindungsunsicherheit sie verhindert. Erinnern wir uns noch mal an das Schaubild aus dem Kapitel ,,Kindliches Bindungsverhalten" (s. Abb.1), dann wird uns dieses Prinzip deutlich.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.1
Einige Psychologen nehmen an, daß die Art und Weise, wie Mütter ihre Kinder lehren, abhängig vom Bildungsstand der Eltern ist (Laosa 1980)10/. Erwiesen ist aber auch, daß in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Lehrmethoden verwendet werden. Zum Beispiel versuchen mexikanische Mütter ihren Kindern etwas beizubringen, indem sie ihnen etwas vormachen. Anglo-Amerikanische Mütter hingegen stellen ihren Kindern Fragen und loben oder tadeln sie für eine richtige oder falsche Antwort.
Auch das Geschlecht spielt eine entscheidende Rolle, darauf soll später aber noch näher eingegangen werden.
Ersatzbetreuer
In außereuropäischen Kulturen ist es nicht unbedingt üblich, daß Kinder hauptsächlich von der Mutter erzogen werden. So kann es z.B. sein, daß der Onkel für die Erziehung der Söhne einer Familie verantwortlich ist. In den industriellen Gesellschaften wird die Kinderversorgung dagegen immer mehr in die Hände institutionalisierter Einrichtungen gegeben.
Schon lange hat man festgestellt, daß die Mutter Kind Bindung keineswegs die einzige enge Bindung ist. Harlow und Harlow (1965) z.B. sprechen von ,,affektiven Systemen" statt von Bindungen und unterscheiden fünf: Kind an Mutter, Mutter an Kind, Kind an Altersgenossen, heterosexuelle Beziehungen und erwachsener Mann an Kind.11
Da in der modernen Gesellschaft die Verantwortung für die Kinderbetreuung immer mehr verlagert wird, wird in der Wissenschaft auch verstärkt die Rolle der Ersatzbetreuer erforscht. Die Resulatate sind etwas widersprüchlich. Fox (1977) verglich die Reaktionen israelischer Kinder gegenüber ihren Müttern und Tagesmüttern, und stellte fest, daß die Tagesmütter leicht zur primären Bezugspersonen werden konnten.12 Farran und Ramey (1977) berichteten dagegen, daß die Mütter den Betreuerinnen vorgezogen wurden und nicht einmal gegenüber Fremden bevorzugt wurden.13
Nach Untersuchungen von u.a. Alison Clarke-Stewart und Greta Fein 1983 hat diese Form der Erziehung, wenn sie in einer nicht- institutionalisierten Umgebungen wie z.B. einer Großfamilie stattfindet und die Bezugspersonen eine stabile Beziehung zu dem Kind haben, keine negativen Einflüsse auf die Entwicklung des Kindes.14 Als problematisch wird bei diesem Ergebnis nur das Testverfahren angesehen. Durch den Streß einer ungewohnten Situation mit fremden Personen soll Bindungsverhalten ausgelöst werden. Kinder aus Familien, in denen die Mutter ganztags arbeitet zeigten dabei kein unsichereres Verhalten als Kinder, deren Mutter Hausfrau ist. Allerdings liegt die Vermutung nahe, daß Kinder, die tagtäglich mit fremden Personen in Kontakt treten, die fremde Situation als wesentlich weniger angsteinflößend und ungewohnt empfinden als diejenigen, die die meiste Zeit mit einer Hauptbezugsperson verbringen.
Festgestellt wurde aber auch, daß Mütter die während ihrer Arbeitszeit von ihren Kindern getrennt sind, nach der Arbeit und an den Wochenenden die direkten Interaktionen mit ihren Kindern aufholen. Sie halten ihre Kinder z.B. genauso häufig im Arm wie nicht berufstätige Mütter.15
Untersuchungen zeigen, das Kinder die in Kindertagesstätten waren weniger gehorsam und aggressiver sind als Kinder, die bei ihren Müttern zu Hause waren. Auf der anderen Seite standen sie sich aber gleich oder waren sogar besser was die Entwicklung von sozialer Kompetenz, Sprache, Selbstvertrauen und problemlösenden Denken anging (Clarke-Stewart, 1989).16
In einer Studie von Siegal and Storey 1985 fand man heraus, das Kinder, die in Kindertagesstätten waren, Vergehen, wie Stehlen oder Schlagen für schlimmer hielten als z.B. das nicht Aufräumen von Spielzeug. Kinder, die zu Hause bei ihren Müttern waren, hielten beide Vergehen oft für gleich schlimm.17
Väter sind in erst in neuerer Zeit als potentielle Bindungsziele erkannt worden. Der Rolle des Vaters bei der Kindererziehung wird zunehmende Aufmerksamkeit gewidmet, da infolge sich wandelnder gesellschaftlicher Einstellungen ein etwas größerer Teil der Verantwortung für die Kinder auf den Mann übergeht. Lamb (1977) wiederholte Ainsworth Versuchsanordnung der fremden Situation so, daß das Kind einmal von der Mutter und ein anderes mal vom Vater in das Labor begleitet wurde. Mehrere Kinder zeigten dabei unsicheres Bindungsverhalten gegenüber der Mutter aber sicheres Bindungsverhalten gegenüber dem Vater.18
Geschlecht
Die Frage ob Jungen und Mädchen bzw. Männer und Frauen ein unterschiedliche Bindungsverhalten aufweisen, ist nicht eindeutig geklärt. Bei einigen Untersuchungen ergeben sich Unterschiede, in anderen wiederum nicht. Erwiesen scheint aber, daß die Unterschiede abnehmen, da es immer mehr zu einer Gleichbehandlung der Geschlechter kommt.
Jungen und Mädchen werden von ihrer Geburt an anders behandelt. Man kleidet Mädchen in rosa und Jungen in blau, kauft den Mädchen Puppen und den Jungen Autos zum spielen. Eine Studie (M. Lewis, 1971) zeigte sogar, daß Mütter aus der Mittelklasse eher dazu neigten, ihre Töchter mit der Brust zu füttern als ihre Söhne.19 Eine Untersuchung von Caroline Smith und Barbara Loyd (1978) weißt auf, daß wenn man Müttern fremde Kinder als Mädchen oder Jungen vorstellte, diese dadurch in ihrem Verhalten gegenüber den Kindern beeinflußt wurden.20 Die sogenannten Jungen wurden ermutigt zu krabbeln und zu laufen und bekamen einen Hammer zum spielen. Eine Umfrage bei Huston 1983 ergab, das Eltern ihre neugeborenen Mädchen meistens mit den Attributen zart, lieb und zerbrechlich bedachten, Jungen hingegen wurden häufig als stark und frech betitelt.21 So, wie das Bild von ihren Kindern ist, so verhalten sich die Eltern auch gegenüber ihren Kindern. Man geht mit Mädchen zarter um, als mit Jungen. Väter machen besonders Unterschiede je nach dem Geschlecht ihres Kindes. Eine Studie von Beverly Fagot (1978) zeigte, daß Jungen dazu ermutigt werden ihre Umwelt zu erkunden und das sie seltener als Mädchen bestraft werden, wenn sie Sachen kaputt machen. Mädchen hingegen werden dazu erzogen zu helfen und Hilfe zu beanspruchen. Mit diesem Verhalten werden Jungen zur Unabhängigkeit, Mädchen zur Abhängigkeit erzogen.22
Im Erwachsenenalter sind die Geschlechtseffekte insgesamt eher gering. Sie deuten aber tendentiell auf eine größere Bedeutung der ängstlichen Bindungsdimension bei den Frauen und der vermeidenden Bindungsdimension bei den Männern hin.23
In einigen Studien, z.B. von O´Hearn, Brennan und Shaver & Tobey 1991, wurden Geschlechtsunterschiede festgestellt. Bei der Entscheidung zwischen den beiden vermeidenden Alternativen wählen mehr Männer als Frauen den gleichgültig-vermeidenden Bindungsstil und mehr Frauen als Männer den ängstlich-vermeidenden.24 Die Probanden gaben ebenfalls ihre Einschätzung über die Bildungsstil-Ausprägungen ihrer Partner ab. Dabei schätzen die Männer ihre Partnerinnen stärker ängstlich-ambivalent ein als es die Frauen umgekehrt tun und auch stärker ängstlich-ambivalent als sich selbst.25
Literaturverzeichnis
Klaus E. Grossmann & Karin Grossmann, ,,Bindungstheoretische Grundlagen psychologisch sicherer und unsicherer Entwicklung", aus: GwG- Zeitschriften 96/Dezember 1994,
Lois Hoffman, Scott Paris, Elizabeth Hall, Developmental Psychology Today, 6. Auflage, McGraw-Hill, Inc. 1994
David Kretch, Richard S. Crutchfield, Norman Livon, William A. Wilson jr., Allen Parducci, Grundlagen der Psychologie, Bechtermünz Verlag 1992
M. Wensauer, K.E. Grossmann, ,,Qualität der Bindungsrepresentation, soziale Integration und Umgang mit Netzwerkressourcen im höheren Erwachsenenalter", Steinkopf Verlag 1995
Ina Grau, Diplomarbeit ,,Entwicklung und Validierung eines Inventars zur Erfassung von Bindungsstilen in Paarbeziehungen", Marburg/Lahn 1994
[...]
1 In: Lois Hoffman, Scott Paris, Elizabeth Hall, Developmental Psychology Today, 6. Auflage, McGraw-Hill, Inc. 1994, S. 201
2 vgl Ibid
3 Ibid
4 vgl. David Kretch, Richard S. Crutchfield, Norman Livon, William A. Wilson jr., Allen Parducci, Grundlagen der Psychologie, Bechtermünz Verlag 1992, S. 69
5 vgl. David Kretch, Richard S. Crutchfield, Norman Livon, William A. Wilson jr., Allen Parducci, Grundlagen der Psychologie, Bechtermünz Verlag 1992, S. 69
6 In: Lois Hoffman, Scott Paris, Elizabeth Hall, Developmental Psychology Today, 6. Auflage, McGraw-Hill, Inc. 1994, S. 201
7 Ibid, S. 202
8 vgl. Ibid
9 In: Lois Hoffman, Scott Paris, Elizabeth Hall, Developmental Psychology Today, 6. Auflage, McGraw-Hill, Inc. 1994, S. 201
10 In: : Lois Hoffman, Scott Paris, Elizabeth Hall, Developmental Psychology Today, 6. Auflage, McGraw-Hill, Inc. 1994, S. 202
11 vgl. David Kretch, Richard S. Crutchfield, Norman Livon, William A. Wilson jr., Allen Parducci, Grundlagen der Psychologie, Bechtermünz Verlag 1992, S. 70
12 In: David Kretch, Richard S. Crutchfield, Norman Livon, William A. Wilson jr., Allen Parducci, Grundlagen der Psychologie, Bechtermünz Verlag 1992, S. 70
13 Ibid
14 vgl. Lois Hoffman, Scott Paris, Elizabeth Hall, Developmental Psychology Today, 6. Auflage, McGraw-Hill, Inc. 1994, S. 202
15 vgl. Lois Hoffman, Scott Paris, Elizabeth Hall, Developmental Psychology Today, 6. Auflage, McGraw-Hill, Inc. 1994, S. 204
16 Ibid
17 Ibid
18 vgl. ibis, S. 69
19 vgl. Lois Hoffman, Scott Paris, Elizabeth Hall, Developmental Psychology Today, 6. Auflage, McGraw-Hill, Inc. 1994, S. 204
20 In: Ibid
21 In: Ibid
22 vgl. Lois Hoffman, Scott Paris, Elizabeth Hall, Developmental Psychology Today, 6. Auflage, McGraw-Hill, Inc. 1994, S. 204
23 vgl. Ina Grau, Diplomarbeit ,,Entwicklung und Validierung eines Inventars zur Erfassung von Bindungsstilen in Paarbeziehungen", Marburg/Lahn 1994, S.62
24 Ibid
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Referat "Entwicklung des Bindungsverhaltens im Lebenslauf - Teil IV: Einflüsse von Klasse, Geschlecht und Kultur auf das Bindungsverhalten"?
Das Referat untersucht, wie soziale Klasse, Kultur und Geschlecht die Entwicklung des Bindungsverhaltens von Kindern beeinflussen. Es wird analysiert, wie unterschiedliche Erziehungsmethoden und Verhaltensweisen von Eltern in verschiedenen Kontexten die Bindungsmuster der Kinder prägen können.
Wie beeinflusst die soziale Klasse das Bindungsverhalten?
Eltern aus der Arbeiterklasse verbringen oft weniger Zeit mit ihren Kindern aufgrund finanzieller Schwierigkeiten und höherer Stressbelastungen. Mütter der oberen Klasse neigen eher dazu, die Stimmen ihrer Kinder nachzuahmen und sie zu ermutigen. Es gibt auch Unterschiede in der Art und Weise, wie Mütter auf weinende Babys reagieren, wobei Mütter aus unteren Schichten eher zu Essen greifen, während Mütter höherer Schichten versuchen, Probleme mit Reden zu lösen.
Welche Rolle spielt die Kultur bei der Entwicklung des Bindungsverhaltens?
Verschiedene Kulturen haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was ein gut erzogenes Kind ausmacht. Beispielsweise legen puerto-ricanische Mütter Wert auf Gehorsam und Respekt, während anglo-amerikanische Mütter Wert darauf legen, dass sich ihre Kinder sicher fühlen. Die Kindererziehung in verschiedenen ethnischen Gruppen dient dazu, die Kinder auf ihre wirtschaftliche, politische und soziale Rolle in dieser Gruppe vorzubereiten.
Wie beeinflusst das Geschlecht die Entwicklung des Bindungsverhaltens?
Jungen und Mädchen werden von Geburt an unterschiedlich behandelt, was ihr Verhalten beeinflusst. Väter machen oft Unterschiede je nach Geschlecht ihres Kindes. Jungen werden ermutigt, ihre Umwelt zu erkunden, und werden seltener bestraft, wenn sie Sachen kaputt machen, während Mädchen dazu erzogen werden, zu helfen und Hilfe zu beanspruchen. Im Erwachsenenalter deuten Studien auf eine größere Bedeutung der ängstlichen Bindungsdimension bei Frauen und der vermeidenden Bindungsdimension bei Männern hin.
Welche Bedeutung haben Ersatzbetreuer für die Bindungsentwicklung?
In der modernen Gesellschaft wird die Kinderbetreuung zunehmend in institutionalisierte Einrichtungen verlagert. Die Rolle der Ersatzbetreuer wird verstärkt erforscht. Studien zeigen widersprüchliche Ergebnisse, einige weisen darauf hin, dass Tagesmütter leicht zu primären Bezugspersonen werden können, während andere feststellen, dass die Mütter den Betreuerinnen vorgezogen werden.
Welchen Einfluss hat die Betreuung in Kindertagesstätten auf das Verhalten von Kindern?
Untersuchungen zeigen, dass Kinder, die in Kindertagesstätten betreut werden, möglicherweise weniger gehorsam und aggressiver sind als Kinder, die zu Hause betreut werden. Andererseits sind sie oft gleich oder besser in Bezug auf die Entwicklung von sozialer Kompetenz, Sprache, Selbstvertrauen und problemlösendem Denken.
Wie hat sich die Rolle des Vaters in Bezug auf Bindungsverhalten verändert?
Die Rolle des Vaters bei der Kindererziehung wird zunehmend wichtiger. Studien zeigen, dass Kinder manchmal ein unsicheres Bindungsverhalten gegenüber der Mutter, aber ein sicheres Bindungsverhalten gegenüber dem Vater zeigen können.
Was sind die wichtigsten Schlussfolgerungen des Referats?
Das Bindungsverhalten wird durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst, darunter soziale Klasse, Kultur, Geschlecht und die Rolle von Ersatzbetreuern. Die Erfahrungen, die ein Kind in seiner frühen Entwicklung macht, prägen seine Bindungsmuster und beeinflussen seine Beziehungen im späteren Leben. Die Sensibilität und Reaktionsfähigkeit der Bezugspersonen sind entscheidend für die Entwicklung einer sicheren Bindung.
- Citar trabajo
- Sylvia Brand (Autor), 1998, Entwicklung des Bindungsverhaltens im Lebenslauf - Einflüsse von Klasse, Geschlecht und Kultur auf das Bindungsverhalten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98222