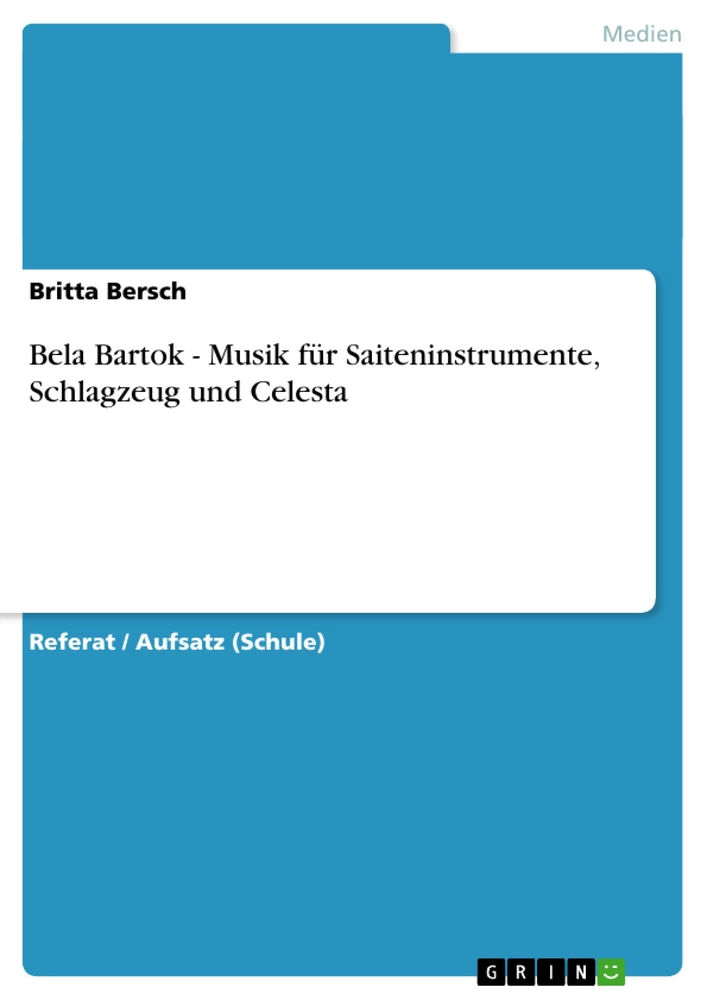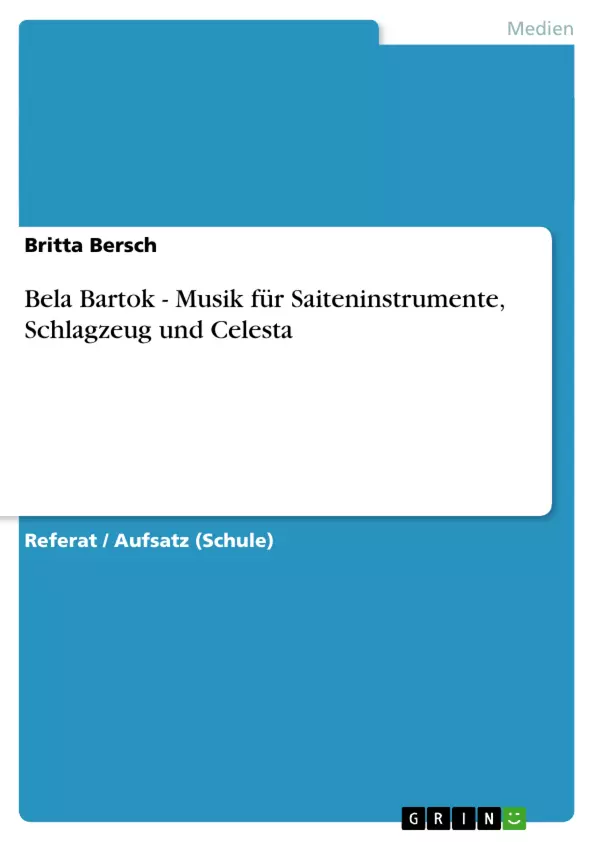I. Biographie
1881 Béla Bartók wird am 25. März 1881 in Nagyszentmiklós (Südungarn; =Sinnicolau Mare, Rumänien) geboren.
Mit fünf Jahren erster Klavierunterricht durch die Mutter. Mit sieben Jahren wird sein absolutes Gehör entdeckt. Mit neun Jahren fallen ihm erstmals eigene Melodien ein.
Er komponiert den "Lauf der Donau", sein umfangreichstes der erhalten gebliebenen Frühwerke.
1892 erster Auftritt als Pianist bei einem Wohltätigkeitskonzert. In Pozsony fällt er László Erkel auf, der sich
1894 - 1899 seiner annimmt und seine musikalische Entwicklung in eine bestimmte Richtung lenkt.
Mit zwölf Jahren begleitet er in Beszterce Violinsonaten von Beethoven und das Violinkonzert von Mendelssohn auf dem Klavier
1899 - 1904 Studium an der Musikhochschule in Budapest.
Ab 1908 Tätigkeit als Professor für Klavier an der Musikhochschule in Budapest.
Rege Tätigkeit als Konzertpianist.
Ab 1913 Zahlreiche grundlegende wissenschaftliche Veröffentlichungen über Volksmusik. Ab 1934 Lebt als freischaffender Komponist in Budapest.
Widmet sich - gemeinsam mit seinem Freund Zoltán Kodály - verstärkt der Sammlung und Erforschung der Volksmusik vor allem Osteuropas.
1940 Entzieht sich der zunehmenden Einschränkung seiner künstlerischen Betätigung durch den expandierenden deutschen Nationalsozialismus durch Auswanderung in die USA. Tätigkeit als Konzertpianist (bis 1943), Dozent, Musikforscher und Komponist. Leben in den USA ist überschattet von Existenzsorgen und Krankheit (Leukämie). 1945 Béla Bartók stirbt am 26. September in New York.
II. Allgemeines zu Bartóks Kompositionen
Seit seinen ersten Kontakten mit authentischer, bäuerlicher Volksmusik um 1904/05 stand Bartók lebenslang unter ihrem Einfluss. Er erarbeitete sich - zwar mit Unterstützung seines Freundes Kodály, einem promovierten Wissenschaftler, aber letztendlich doch autodidaktisch
- eine Methodologie; er unternahm strapaziöse und kostspielige Exkursionen, schrieb jahrelang - oft zehn stunden am tag - , um das gesammelte Material (mehr als 9.000 Melodien von acht Nationalitäten) auszuwerten und zu veröffentlichen. Er machte jedoch mehrfach und entschieden darauf aufmerksam, dass er kein komponierender "Folklorist" sei. Ihm geht es nicht um Zitieren, Einrahmen und Verklären, sondern nutzt die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten. Tatsächlich führte die Volksmusik in der europäischen Musikgeschichte zu vielfältigen Konkretionen. Hierzu schreibt Bartók in seiner Autobiographie: "Das Studium all dieser Bauernmusik war deshalb von entscheidender Bedeutung für mich, weil sie mich auf die Möglichkeit einer vollständigen Emanzipation von der Alleinherrschaft des bisherigen Dur-Moll-Systems brachte. Denn der weitaus überwiegende und gerade wertvollere Teil des gewonnenen Melodieschatzes ist in den alten Kirchentonarten, respektive in altgriechischen und gewissen noch primitiveren (namentlich pentatonischen) Tonarten gehalten, und zeigt außerdem mannigfaltigste und freieste rhythmische Gebilde und Taktwechsel sowohl im Rubato- als auch im Tempo giusto-Vortrag. Es erwies sich, dass die alten, in unserer Kunstmusik nicht mehr gebrauchten Tonleitern ihre Lebensfähigkeit durchaus nicht verloren haben. Die Anwendung derselben ermöglichte auch neuartige harmonische Kombinationen. Diese Behandlung der diatonischen Tonreihe führte zur Befreiung von der erstarrten Dur-Moll-Skala und, als letzte Konsequenz, zur vollkommen freien Verfügung über jeden einzelnen ton unseres chromatischen Zwölftonsystems." Bartók sieht die Volksmusik also als "musikalische Muttersprache" an.
Erstmals 1923 und dann fast ausnahmslos seit Anfang der 30er Jahre sind Bartóks Kompositionen auf Anfrage und Bestellung hin entstanden. So ist die in meinem Referat besprochene Komposition die erste von drei Basler arbeiten, die auf die Initiative von Paul Sacher zurückgehen.
Die zeitliche Gliederung von Bartóks kompositorischen Gesamtwerk ist schwierig. Er selbst weist in seinen autobiographischen Essays darauf hin, dass er den eigenen kompositorischen weg um 1907 gefunden habe. Ansonsten reklamiert er für sein Gesamtwerk Kontinuität - mit zwei ausnahmen: 1. gewisse Radikalismus-Neigungen von 1928 bis 1924 bei gleichzeitiger Akzentuierung der homophonen Satztechnik; 2. nach einer zwei-jährigen Pause verfahre er seit 1926 kompositorisch ökonomischer, bei eindeutig kontrapunktische Schreibweise und ebenso konsequent wie einfach.
Der Durchbruch zu internationaler Anerkennung gelang ihm ausgerechnet in den 20er Jahren, während seiner "radikalen Phase".
III. Die Entstehungsgeschichte
Die "Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta" entstand 1936 als Auftragskomposition:
Paul Sacher, seit langem vom historischen Rang des Komponisten Bartók überzeugt, bat ihn im Sommer 1936 brieflich um die Komposition eines nicht zu schweren Werkes für sein Kammerorchester, notfalls unter Beteiligung weiterer Instrumente. Dieses werk sollte neben anderen Auftragskompositionen von Conrad Beck, Willy Burkhard und Arthur Honegger in einem Jubiläumskonzert des Basler Kammerorchesters, einer "Institution" für zeitgenössische Musik, aus Anlass seines zehn-jährigen Bestehens am 21. Januar 1937 uraufgeführt werden. Bartók antwortete wenige Tage später, hatte sogar schon konkrete Vorstellungen. Er kündigte einen Monat später auch seinem Verleger die neue Arbeit an, ein "etwa 15 Minuten dauerndes Werk." Wieder einen Monat später meldete er, das stück sei bis auf wenige Seiten fertig und dauere etwa 24 Minuten. Beendet wurde es laut Partitureintrag am 7. September 1936 in Budapest.
Am 19. Januar traf Bartók in Basel ein, um bei den Schlussproben und der Uhraufführung anwesend zu sein. Die Uhraufführung wurde zum Sensationserfolg. Aus der lokalen Begeisterung wurde ein weltweiter Triumph, bereits im ersten Jahr wurde das Werk weltweit fast fünfzig Mal aufgeführt. In Deutschland und Österreich kam es - trotz scharfe Ablehnung durch die nationalsozialistisch inspirierte Fachkritik - sogar zu mehr Aufführungen als in jedem anderen Land.
IV. Werkanalyse
Besetzung: 2 Streichergruppen, Kleine Trommel mit Saiten, Kleine Trommel ohne Saiten, Große Trommel, 2 normale und 2 kleinere Becken, Tamtam, Maschinenpauke, Xylophon, Celesta, Harfe, Klavier.
Das aus diesem Instrumentarium gebildete Orchester soll nach Bartóks Anweisungen ungefähr so aufgestellt werden:
Kb. I Kb. II
Vc. I Pauke Gr. Trommel Vc. II Va. I Kl. Trommel Becken Va. II Vl. I Celesta Xylophon Vl. IV VL.II Klavier Harfe Vl. III
Der Aktionsradius ist gegenüber der Konvention deutlich erweitert: neben den üblichen Spielarten gestrichene und gezupfte Glissandi, Pizzicato in beiden Richtungen, Pizzicato, bei dem die Saite auf das Griffbrett aufschlägt ("Bartók-Pizzicato"), col legno, Flageolett etc. Der umfangreiche Einsatz des Schlagzeugs ist typisch für alle bartókschen Orchesterwerke; das Klavier findet sich bei Bartók häufig unter den Orchesterinstrumenten, ebenso seit den "Zwei Bildern" ( 1910) Celesta und Harfe.
Die Streicher sind doppelorchestermäßig in zwei Quintette geteilt. Von dieser Teilung wird im Interesse möglicher Stimmvervielfältigung ausgiebig gebrauch gemacht. Die vorgeschriebene Aufstellung begünstigt konzertante, ja antiphonisch-dialogisierende Musizierpraktiken und hat darüber hinaus raumakustische bzw. "stereo-phone" Konsequenzen. So verstärken interne Gliederung und Aufstellung die klanglichen Differenzierungsmöglichkeiten, die sich bereits aus der Besetzung ergeben.
I. Andante tranquillo - in A; ständiger Taktwechsel
"Eine Fugen-Art, streng durchgeführt. Jeder neue Themeneinsatz ist in einer um eine Quint höher gelegten Tonart (2., 4., 6. usw. Einsatz) bzw. in einer um eine Quinte tiefer gelegenen Tonart (3., 5., 7. usw. Einsatz); hierbei erscheinen später mehrmals 2 Nachbareinsätze in Engführung; manchmal bringen die Einsätze nur Bruchteile des Themas. Nachdem in beiden Richtungen die entfernteste Tonart (Es) erreicht ist (Climax des Satzes), bringen die folgenden Einsätze das Thema nunmehr in der Umkehrung, solange nicht wieder die Haupttonart (A) erreicht ist. Mit diesem beginnt die Coda, in welcher das Thema in beiderlei Gestalt erscheint."
Man kann den Satz also als "Doppelzirkelfuge" bezeichnen. Die Satzanlage ist bis in zahlreiche Details einem symmetrischen Verlaufsmodell unterworfen. Den als Mitte konzipierten "Höhepunkt" markiert der Zirkelschritt Es.
Das Thema besteht aus durch vier Zäsurpausen getrennten Gliedern von ähnlichem, bogenartigem Duktus, die jeweils die ungefähre Länge eines Taktes haben und sich wellenförmig - mit dem 3. Glied als Climax - zu einem Ganzen runden. Es entfaltet sich in kleinsten Intervallfortschreitungen und füllt dabei lediglich eine chromatisierte Quint als Ambitus. Durch diese Chromatisierung und durch die Quintfolge der Themeneinsätze ist die Oktav nach zwei Einsätzen des Themas zwölftönig aufgefächert, so dass "A" eher im sinne einer Hauptstufe und weniger als Tonart zu sehen ist. Die Länge der Themenglieder ist unterschiedlich, die unregelmäßigen rhythmisch-metrischen Strukturen werden von Bartók durch Strichellinien und Betonungszeichen verdeutlicht.
Die Bratschen der beiden Streichquintette eröffnen den Satz mit der einstimmig-unbegleiteten Präsentation des Themas. In den folgenden vier Einsätzen wird von dieser Mittellage aus der Klangraum verbreitert: Die 3.4. Violinen übernehmen den 2. Einsatz, die 1.2. Celli den 3., den 4. die 2. Violine und den 5. die 1.2. Kontrabässe. So wird Zug um Zug Höhe und Tiefe gewonnen. Die Ausweitung umfasst auch den Tonraum, da zugleich der Doppelzirkel ausgeschritten wird. Die fünfmalige Darbietung des Themas geschieht ohne Überschneidungen, nahtlos, ungekürzt und - mit Ausnahme einer zugefügten Achtelpause - notengetreu. Ein solches Gleichmaß kehrt im Laufe des Satzes nicht mehr wieder. Es schließt sich ein themenabhängiges und Zwischenspiel an (T. 21 - 26).
Die Form Dieses Satzanfanges weist Ähnlichkeiten mit der Exposition einer barocken fuge auf; daher ist es wahrscheinlich, dass Bartók sich von dieser Idee leiten ließ. Die Analogie zur Fuge des Barock weiter zu treiben dürfte allerdings doch fragwürdig sein, auch weil die Tonalitätsstruktur in ihrer Chromatik zwar Zentren, aber keine Dominante(n) als Gegenpol(e) kennt.
Der 6.-7. Zirkelschritt (T. 27 - 30) bringt durch Engführung und Oktavverdoppelungen Neuerungen in die Behandlung des Themas: Themenverschränkung, auskomponierte dynamische Steigerung und erneute Verbreiterung des Klangraums. Es folgt ein weiteres, nur dreitaktiges themenabhängiges Zwischenspiel. Es folgen der 8. bis 11. Zirkelschritt, wobei das Thema zum ersten mal verkürzt vorkommt. Es spielen nun alle Stimmen des Doppelquintetts sowie die Pauken.
Es folgt der längste Abschnitt des Satzes mit dem Climax (12./13. Zirkelschritt); er präsentiert das Thema zum vorerst letzten und seine Umkehrung zum ersten Mal. In der nächsten Durchführung erklingen der 14. und 16. Zirkelschritt auf ihren Anfangston reduziert, der 15. erklingt nur leicht verändert. Als einziger überhaupt wird der 17. Zirkelschritt sogar ausgelassen! Die Takte 63/64 erhalten besonderen Nachdruck durch Einmünden in die Einstimmigkeit, ein Decrescendo und durch ein Poco rallentando. Konsequenz: eine Generalpause. Der 18. und 19. Zirkelschritt erklingt in einer sechsstimmigen Engführung, die das gesamte Doppelquintett einbezieht. Mit dem 20. und 21. sowie dem 22. und 23. Zirkelschritt erklingt das Thema in zwei unmittelbar aufeinander folgenden Engführungen wieder authentisch (davor zuletzt beim 6. Zirkelschritt), und zwar drei- bzw. fünfstimmig (mit Hilfe von Gegenstimmen). Der 24. und letzte Zirkelschritt mündet nach außerordentlichen - durch verschiedene Kompositorische Mittel erreichte - Änderungen in die zweite Generalpause des Satzes. Doch hier ist der Satz nicht zuende: es schließt sich - auf Grundlage des letzten Zirkelschritts - ein sieben Takte langer Schlussabschnitt an, von Bartók als "Coda" bezeichnet. Er besteht aus zwei teilen, in denen noch mehrmals das vollständige oder fragmentierte Thema erklingt.
Der Satz wird von dem Doppelquintett realisiert und nur an drei Schlüsselstellen durch Schlaginstrumente und Celesta akzentuiert.
II. Allegro - in C; 2/4
"Sonaten-Form. Haupttonart C, Seitensatz in G; in der Durchführung erscheint das Fugenthema des 1. Satzes stark verändert (pizz. Akkorde der Streicher und des Klaviers), dem anschließend ein, das Hauptthema des 4. Satzes antizipierendes, neues Thema, imitatorisch durchgeführt. Die Wiederkehr ändert den 2/4 Rhythmus in der Exposition in 3/8."
III. Adagio - in Fis; 4/4
"Brücken-Form: A, B, C + D, B, A; in den einzelnen Teilen sind die 4 Sektionen des Fugenthemas des 1. Satzes eingestreut."
IV. Allegro molto - in A; 2/2
Häufig gestellte Fragen
I. Biographie von Béla Bartók: Wann und wo wurde Béla Bartók geboren?
Béla Bartók wurde am 25. März 1881 in Nagyszentmiklós (Südungarn; =Sinnicolau Mare, Rumänien) geboren.
I. Biographie von Béla Bartók: Wann erhielt Bartók seinen ersten Klavierunterricht und welche musikalischen Fähigkeiten wurden früh entdeckt?
Mit fünf Jahren erhielt Bartók ersten Klavierunterricht von seiner Mutter. Mit sieben Jahren wurde sein absolutes Gehör entdeckt. Mit neun Jahren fielen ihm erstmals eigene Melodien ein.
I. Biographie von Béla Bartók: Welche musikalische Ausbildung erhielt Bartók und wo studierte er?
Bartók studierte von 1899 bis 1904 an der Musikhochschule in Budapest. Ab 1908 war er als Professor für Klavier an dieser Hochschule tätig.
I. Biographie von Béla Bartók: Welche Rolle spielte Zoltán Kodály in Bartóks Leben und Werk?
Bartók widmete sich - gemeinsam mit seinem Freund Zoltán Kodály - verstärkt der Sammlung und Erforschung der Volksmusik vor allem Osteuropas.
I. Biographie von Béla Bartók: Warum emigrierte Bartók in die USA und wie waren seine Lebensumstände dort?
Bartók entzog sich der zunehmenden Einschränkung seiner künstlerischen Betätigung durch den expandierenden deutschen Nationalsozialismus durch Auswanderung in die USA im Jahr 1940. Sein Leben in den USA war überschattet von Existenzsorgen und Krankheit (Leukämie).
I. Biographie von Béla Bartók: Wann und wo starb Béla Bartók?
Béla Bartók starb am 26. September 1945 in New York.
II. Allgemeines zu Bartóks Kompositionen: Welchen Einfluss hatte die Volksmusik auf Bartóks Kompositionen?
Seit seinen ersten Kontakten mit authentischer, bäuerlicher Volksmusik um 1904/05 stand Bartók lebenslang unter ihrem Einfluss. Er nutzte die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten der Volksmusik, ging es aber nicht um Zitieren, Einrahmen und Verklären.
II. Allgemeines zu Bartóks Kompositionen: Wie sah Bartók die Volksmusik?
Bartók sah die Volksmusik als "musikalische Muttersprache" an.
II. Allgemeines zu Bartóks Kompositionen: Wie entstanden Bartóks Kompositionen seit den 1920ern?
Erstmals 1923 und dann fast ausnahmslos seit Anfang der 30er Jahre sind Bartóks Kompositionen auf Anfrage und Bestellung hin entstanden.
II. Allgemeines zu Bartóks Kompositionen: Wann gelang Bartók der internationale Durchbruch und in welcher Phase seines Schaffens war das?
Der Durchbruch zu internationaler Anerkennung gelang ihm ausgerechnet in den 20er Jahren, während seiner "radikalen Phase".
III. Die Entstehungsgeschichte der "Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta": Wann entstand das Werk und wer gab es in Auftrag?
Die "Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta" entstand 1936 als Auftragskomposition von Paul Sacher.
III. Die Entstehungsgeschichte der "Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta": Wann und wo wurde das Werk uraufgeführt und wie wurde es aufgenommen?
Die Uraufführung fand am 21. Januar 1937 in Basel statt und wurde zum Sensationserfolg.
IV. Werkanalyse der "Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta": Welche Instrumente umfasst die Besetzung?
Die Besetzung umfasst: 2 Streichergruppen, Kleine Trommel mit Saiten, Kleine Trommel ohne Saiten, Große Trommel, 2 normale und 2 kleinere Becken, Tamtam, Maschinenpauke, Xylophon, Celesta, Harfe, Klavier.
IV. Werkanalyse der "Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta": Wie sind die Streicher aufgeteilt und welche Auswirkungen hat das?
Die Streicher sind doppelorchestermäßig in zwei Quintette geteilt. Die Teilung begünstigt konzertante, ja antiphonisch-dialogisierende Musizierpraktiken und hat darüber hinaus raumakustische bzw. "stereo-phone" Konsequenzen.
IV. Werkanalyse der "Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta": Was ist das Besondere am ersten Satz (Andante tranquillo)?
Der erste Satz ist eine "Doppelzirkelfuge", bei der jeder neue Themeneinsatz in einer um eine Quint höher bzw. tiefer gelegten Tonart erfolgt. Die Satzanlage ist einem symmetrischen Verlaufsmodell unterworfen.
IV. Werkanalyse der "Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta": Welche Form hat der zweite Satz (Allegro)?
Der zweite Satz ist in Sonatenform. Haupttonart C, Seitensatz in G. In der Durchführung erscheint das Fugenthema des 1. Satzes stark verändert.
IV. Werkanalyse der "Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta": Welche Form hat der dritte Satz (Adagio)?
Der dritte Satz hat Brücken-Form: A, B, C + D, B, A. In den einzelnen Teilen sind die 4 Sektionen des Fugenthemas des 1. Satzes eingestreut.
IV. Werkanalyse der "Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta": Welche Form hat der vierte Satz (Allegro molto)?
Der vierte Satz hat folgendes Form-Schema: ABACDEDFHA. Der H Teil bringt das Fugenthema des ersten Satzes, aus dem ursprünglichen Chromatischen ins Diatonische auseinandergezogen.
- Quote paper
- Britta Bersch (Author), 1999, Bela Bartok - Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98262