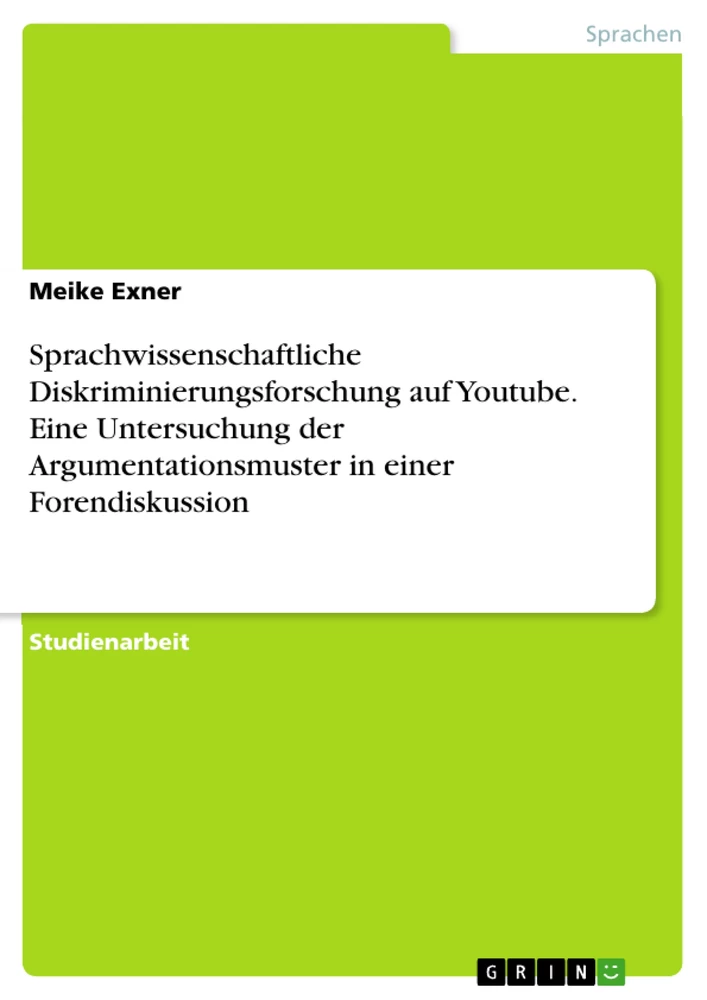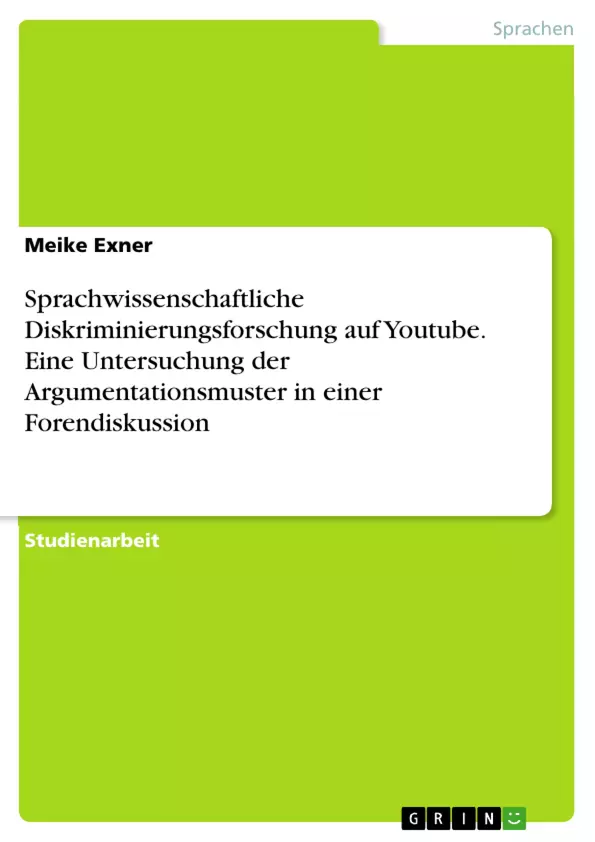Ziel dieser Arbeit ist es, diskriminierende Sprechakte in der Forenkommunikation zu identifizieren und herauszuarbeiten, wie sie tatsächlich realisiert werden. Diese Arbeit nimmt die getippten Äußerungen in öffentlicher computerbasierter Kommunikation in Diskussionen des Videoportals YouTube in den Blick, da es eines der meistgenutzten Foren ist.
Zu diesem Zweck wird eingangs kurz die Beziehung von Sprache und Medien hinsichtlich der zu beachtenden Weiterentwicklung des sprachwissenschaftlichen Zugangs untersucht. Denn die traditionellen sprachwissenschaftlichen Analyseinstrumente müssen beispielsweise hinsichtlich der Bezugselemente Mündlichkeit und Schriftlichkeit an den Kommunikationsraum Internet angepasst werden.
Der sprachliche Ausdruck diskriminierender Äußerungen wird mit Hilfe des linguistischen Instruments der funktional-pragmatischen Diskursanalyse untersucht. Dies kann in diesem Rahmen vorerst innerhalb einer beispielhaften Analyse geschehen, die weitere Forschungsvorhaben in diesem Bereich vorbereiten und anstoßen kann.
Um die Thematik Diskriminierung auf fundierter Ebene in die Analyse einzubeziehen, wird im Theorieteil ein Überblick zu Diskriminierung gegeben. Auch wird der sprachwissenschaftliche Zugang und Online Hate Speech beleuchtet. Erkenntnisse und Werkzeuge der sprachwissenschaftlichen Diskriminierungsforschung werden erläutert und schließlich im Emipirieteil angewandt. Dafür werden die Analysekategorien diskriminierende Nomination, Prädikation, und Argumentation im empirischen Teil mit der funktionalpragmatischen Diskursanalyse verknüpft und unter Bezugnahme auf die Erläuterungen über Diskriminierung im medialen Sprachraum in die Analyse der YouTube Kommentare einbezogen.
Diskriminierende Äußerungen in medialer Kommunikation sind anhand des schier unendlichen Fundus Internet nicht ganzheitlich überprüfbar und die Kontrolle des öffentlichen Meinungsaustausches außerdem fraglich in Hinblick auf die Meinungsfreiheit. Die Frage, ob das Menschenrecht Meinungsfreiheit auch in Form diskriminierender und propagandistischer Meinungsmache, die zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und Diskriminierung beitragen, im Netz Raum behalten sollte oder ob der Schutz vor (medialer) Gewalt dieser vorrangig sein sollte, kann in dieser Arbeit nicht geklärt werden, wird aber ausblickend soweit es der Umfang zulässt, diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Computerbasierte Sprache zwischen mündlicher Flüchtigkeit und schriftlicher Vielfalt: Eine kritisch vorbereitende Betrachtung
- Diskriminierung und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit
- Begriffsbestimmung
- Sprachwissenschaftliche Diskriminierungsforschung
- Diskriminierung in öffentlicher Forenkommunikation
- Methodische Annäherung
- Empirischer Teil
- Analyse
- Diskussion der Ergebnisse
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert diskriminierende Sprechakte in der Forenkommunikation auf YouTube. Ziel ist es, die Realisierung diskriminierender Äußerungen anhand der funktional-pragmatischen Diskursanalyse zu untersuchen. Die Analyse umfasst die Erfassung von Mustern der Reproduktion gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und die Rolle des Verhaltens der diskutierenden Gruppe.
- Diskriminierende Sprechakte in Online-Foren
- Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in politischen Diskussionen
- Funktional-pragmatische Diskursanalyse
- Sprachwissenschaftliche Diskriminierungsforschung
- Online Hate Speech
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Relevanz computerbasierter Kommunikation im Kontext von Diskriminierung und Hassreden im Internet dar. Sie hebt die wachsende Bedeutung von Foren und die Herausforderungen für die sprachwissenschaftliche Analyse aufgrund der spezifischen Eigenschaften der computerbasierten Sprache hervor.
- Computerbasierte Sprache zwischen mündlicher Flüchtigkeit und schriftlicher Vielfalt: Eine kritisch vorbereitende Betrachtung: Dieses Kapitel untersucht die Beziehung der getippten Kommunikation zu mündlicher und schriftlicher Sprache und die Schwierigkeiten, traditionelle Konzepte von Mündlichkeit und Schriftlichkeit auf die computerbasierte Kommunikation anzuwenden.
- Diskriminierung und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit: Dieser Abschnitt liefert einen Überblick über den Begriff der Diskriminierung und die sprachwissenschaftliche Forschung im Bereich der Diskriminierung.
- Methodische Annäherung: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise der Arbeit, insbesondere die Anwendung der funktional-pragmatischen Diskursanalyse zur Analyse diskriminierender Sprechakte.
- Empirischer Teil: Der empirische Teil der Arbeit beinhaltet die Analyse diskriminierender Sprechakte in YouTube-Kommentaren. Er untersucht die Kategorien der diskriminierenden Nomination, Prädikation und Argumentation.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Diskriminierung, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Online Hate Speech, computerbasierte Kommunikation, YouTube-Foren, funktional-pragmatische Diskursanalyse, sprachwissenschaftliche Diskriminierungsforschung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der sprachwissenschaftlichen Diskriminierungsforschung auf YouTube?
Ziel ist es, diskriminierende Sprechakte in Forendiskussionen zu identifizieren und die Muster der Reproduktion von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu analysieren.
Was versteht man unter Online Hate Speech?
Hate Speech bezeichnet hasserfüllte, diskriminierende oder propagandistische Äußerungen im Internet, die sich gegen bestimmte Gruppen richten und oft die Grenzen der Meinungsfreiheit austesten.
Welche Methode wird zur Analyse der YouTube-Kommentare genutzt?
Die Arbeit verwendet die funktional-pragmatische Diskursanalyse, um sprachliche Kategorien wie diskriminierende Nomination, Prädikation und Argumentation zu untersuchen.
Wie unterscheidet sich computerbasierte Sprache von klassischer Schriftlichkeit?
Die getippte Kommunikation auf Portalen wie YouTube liegt in einem Spannungsfeld zwischen mündlicher Flüchtigkeit und schriftlicher Dauerhaftigkeit, was neue Anforderungen an die Analyse stellt.
Ist die Kontrolle von Diskriminierung im Netz mit der Meinungsfreiheit vereinbar?
Die Arbeit diskutiert das Spannungsverhältnis zwischen dem Schutz vor medialer Gewalt und dem Menschenrecht auf Meinungsfreiheit, ohne eine abschließende rechtliche Klärung herbeizuführen.
- Arbeit zitieren
- Meike Exner (Autor:in), 2019, Sprachwissenschaftliche Diskriminierungsforschung auf Youtube. Eine Untersuchung der Argumentationsmuster in einer Forendiskussion, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/983808