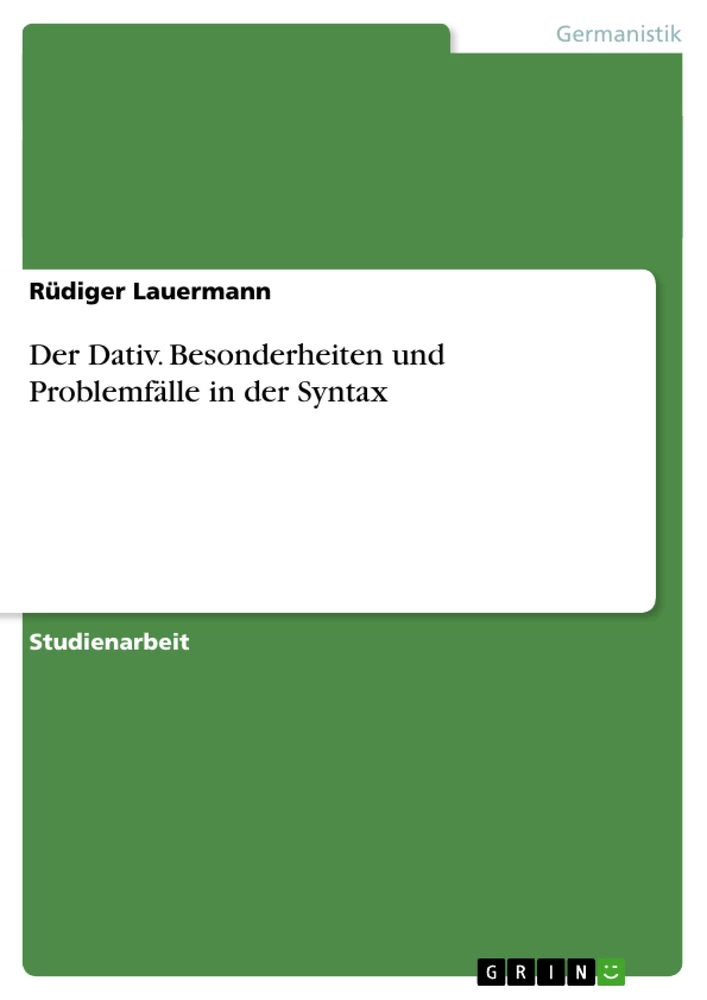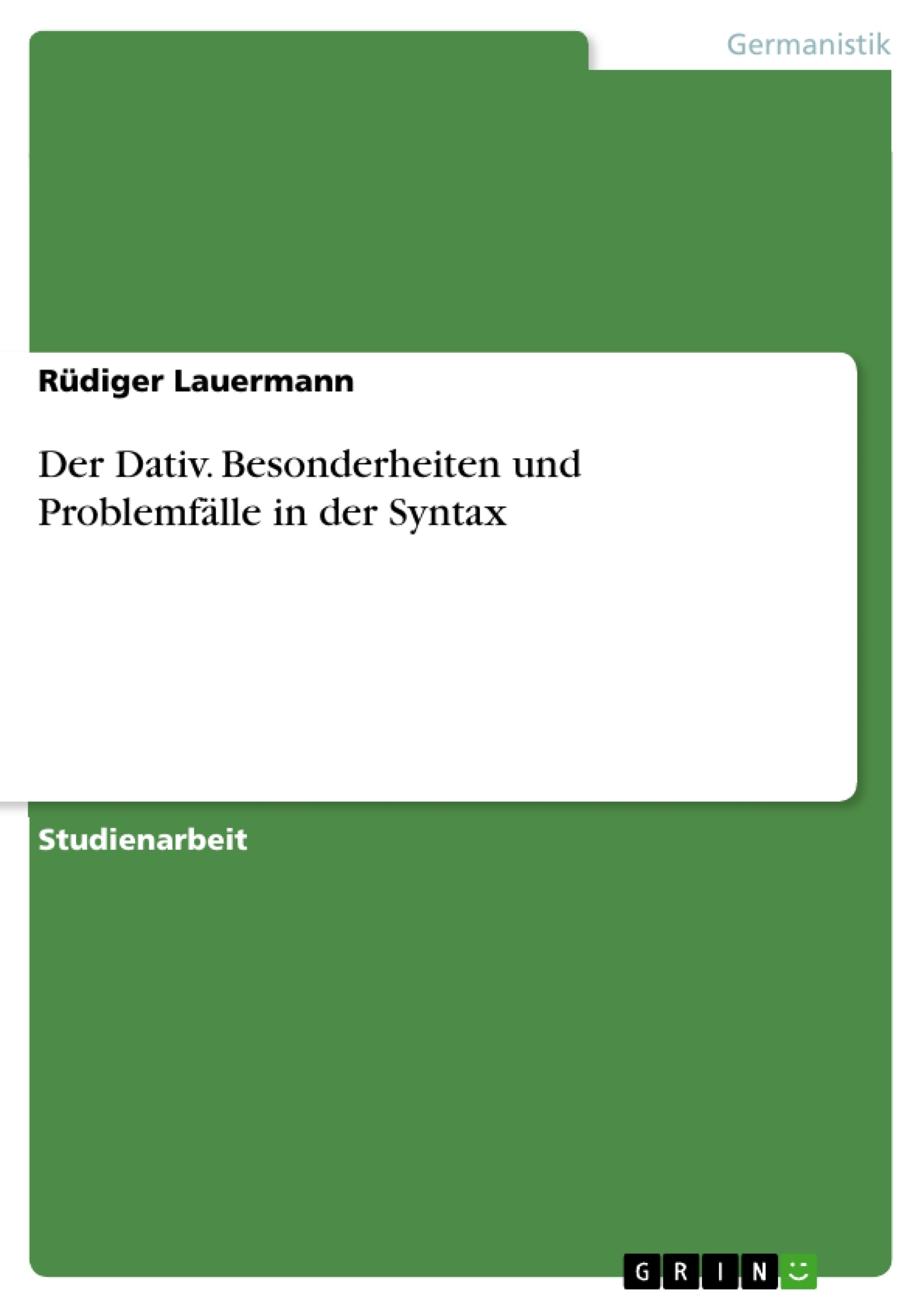Stellen Sie sich vor, ein grammatikalisches Rätsel, gehüllt in den Nebel sprachlicher Konventionen, wartet darauf, gelöst zu werden: der Dativ. Diese Arbeit entführt den Leser in die faszinierende Welt dieses grammatikalischen Phänomens, das scheinbar so vertraut und doch so komplex ist. Jenseits der bloßen Kasuslehre offenbart sich eine tiefere Ebene der Bedeutung, die unsere Wahrnehmung von Raum, Beziehungen und Verantwortlichkeiten prägt. Von den scheinbar harmlosen Präpositionalphrasen bis hin zu den geheimnisvollen "freien Dativen" – jeder Aspekt wird einer kritischen Analyse unterzogen, um seine wahre Funktion und seinen Einfluss auf die deutsche Sprache zu entschlüsseln. Wir begeben uns auf eine sprachliche Detektivarbeit, die die feinen Nuancen des Dativs aufdeckt, seine Rolle bei der Gestaltung von Perspektiven und die subtilen Unterschiede, die ganze Sätze verändern können. Diese Abhandlung geht über traditionelle grammatikalische Erklärungen hinaus und beleuchtet die semantischen Tiefen, die den Dativ zu einem unverzichtbaren Werkzeug für nuancierte Kommunikation machen. Ob es sich um die Unterscheidung zwischen "im Wald" und "in den Wald", die persönliche Note des "Ethicus" oder die implizite Verantwortung des "Incommodi" handelt, der Dativ erweist sich als Schlüssel zum Verständnis der deutschen Sprache. Die Arbeit untersucht nicht nur die syntaktische Struktur des Dativs, sondern auch seine semantische Bedeutung, indem sie die Beziehung zwischen Dativ und Akkusativ untersucht und die Rolle des Dativs bei der Vermittlung von Perspektive und Verantwortung analysiert. Es werden scheinbar feste Regeln in Frage gestellt und neue Interpretationen angeboten, die den Dativ in einem neuen Licht erscheinen lassen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob sogenannte „freie“ Dative wirklich frei sind oder ob sie von subtilen, oft unbemerkten Elementen im Satz abhängen. Sprachwissenschaftler, Germanistikstudenten und alle, die ein tieferes Verständnis der deutschen Sprache suchen, werden in dieser Untersuchung eine fesselnde und aufschlussreiche Lektüre finden, die ihre Perspektive auf die Grammatik für immer verändern wird. Tauchen Sie ein in die Welt des Dativs und entdecken Sie die verborgenen Schätze der deutschen Sprache. Ergründen Sie die Geheimnisse des Dativs und entdecken Sie, wie dieser vermeintlich einfache Fall unsere Wahrnehmung der Welt formt.
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
Der Werwolf
Ein Werwolf eines Nachts entwich, von Weib und Kind und sich begab an eines Dorfschullehrers Grab und bat ihn: ,,Bitte, beuge mich!"
Der Dorfschulmeister stieg hinauf
auf seines Blechschilds Messingknauf und sprach zum Wolf, der seine Pfoten geduldig kreuzte vor dem Toten:
,,Der Werwolf" - sprach der Gute dann, ,,des Weswolfs, Genitiv sodann, dem Wemwolf, Dativ, wie man's nennt, den Wenwolf, - damit hats ein End'."
Dem Werwolf schmeichelten die Fälle, er rollte seine Augenbälle,
,,Indessen", bat er, ,,füge doch zur Einzahl auch die Mehrzahl noch!"
Der Dorfschulmeister aber mußte gestehn, daß er von ihr nichts wußte. Zwar Wölfe gäb's in großer Schar, doch ,,Wer" gäb's nur im Singular.
Der Wolf erhob sich tränenblind - er hatte ja noch Weib und Kind!! Doch da er kein Gelehrter eben, so schied er dankend und ergeben.1
Laut Peter Eisenberg kann der Dativ von allen deutschen Kasus die meisten Konstruktionen leisten.2 Beim Studium der deskriptiven und auch der normativen Grammatiken und Untersuchungen über die deutsche Sprache zeigt sich, daß sich diese Konstruktionen unterschiedlich einteilen lassen. Eine der neuesten Untersuchungen3, im Rahmen einer Darstellung des Dativs bzw. des indirekten Objektes in mehreren germanischen und romanischen Sprachen, beschränkt sich auf eine Einteilung der deutschen Dative in dativische Präpositionalphrasen und verbbezogene Dative4 und zweifelt die Existenz sogenannter ,,freier" Dative an.
Das (verbbezogene) Dativobjekt ist gekennzeichnet durch seine ,Persönlichkeit'. Nur
Personen erscheinen im Dativ, wobei das Wort Personen in diesem Falle auch fiktive
Personen, wie z. B. ein Kollektiv oder ein Objekt, dem Persönlichkeit zugeschrieben werden kann, bezeichnet:
Ich gebe dir etwas;
Ich schließe mich der Mehrheit an; Ich stutze dem Baum die Äste.
Unter die letzte Kategorie fallen auch Redensarten wie Das schlägt dem Faßden Boden aus. Die vorliegende Arbeit zieht bei der Betrachtung der verschiedenen Spielarten des Dativs und ihrer Verwendungsmöglichkeiten ,textlinguistische' Elemente hinzu, indem die Beispielphrasen auch über die Bedeutung ihrer nicht expliziten Aussagen befragt werden.
II. Der Dativ und die Syntax
1. Die dativische Präpositionalphrase
Die Betrachtung dativischer Präpositionalphrasen findet sich bei Eisenberg5 und Draye; die Präpositionen können einen, zwei oder gar drei Kasus nehmen.6 Betrachtung finden hier nur die Phrasen mit two-way-Präpositionen.
a) Verwendung des Dativs bei two-way-Präpositionen
Die sowohl Dativ als auch Genitiv nehmenden Präpositionen (trotz, dank, wegen, während) können den gleichen Sachverhalt in beiden Fällen ausdrücken:
Ich habe während diesen Jahren nichts von ihm gehört - Ich habe während dieser Jahre nichts von ihm gehört. wegen Umbau geschlossen - wegen Umbaus geschlossen.
In einigen Fällen ist jedoch die Flexion im Genitiv nicht möglich:
Ich habe während diesen fünf Jahren nichts von ihm gehört -
* Ich habe während dieser fünf Jahre nichts von ihm gehört.
In einem Fall wie dem folgenden ist es problematisch, das Objekt einwandfrei einem der beiden Kasus zuzuschreiben, da beide dieselben Flexionsendungen tragen:
Ich gehe wegen meiner Krankheit nicht in die Schule.
Etwas deutlicher wird der Satz in der Umstellung und wenn das zu wegen gehörende Fragewort: weswegen auf den implizierenden Fall (wessen _ GEN) hin analysiert wird: Ich gehe nicht in die Schule, meiner Krankheit wegen.
Eine normative Grammatik würde eine derartige Konstruktion wohl als umgangssprachlich ansehen und der Präposition ,wegen' das genauere ,weil' mit der entsprechenden Kon-struktion vorziehen.
Bei Präpositionen, die entweder den Dativ oder den Akkusativ nehmen hängt der Kasus von der Art der beschriebenen Bewegung ab. Wenn die Grenze eines ,topischen Bereiches' überschritten wird, steht der Akkusativ; spielt sich die Bewegung innerhalb des topischen Bereiches ab, steht der Dativ:
Ich gehe in den Wald - Ich gehe im Wald.
Auf diese Thematik wird im Zusammenhang mit der Semantik von Dativ und Akkusativ noch näher eingegangen.7
b) Zur syntaktischen Position der Präpositionalphrase
Die dativische Präpositionalphrase kann in Sätzen mit genau einer Präpositionalphrase überall stehen mit Ausnahme der Stellung, die möglicherweise ,gewohnheitsrechtlich' für den Akkusativ ,reserviert' ist, um Verwechslungen vorzubeugen:
1) * Mein Bruder ist nie im Schwimmbad gefallen.
2) Mein Bruder ist im Schwimmbad nie gefallen.
3) Im Schwimmbad ist mein Bruder nie gefallen.
4) Nie ist mein Bruder im Schwimmbad gefallen. 8
In Sätzen mit zwei oder mehr Präpositionalphrasen ist die Stellung frei, solange diese im gleichen Kasus stehen:
Die Frau hat neben mir auf der Bank gesessen.
_ Neben mir auf der Bank hat die Frau gesessen; sie hat auf der Bank neben mir gesessen; neben mir hat sie auf der Bank gesessen; auf der Bank hat sie neben mir gesessen.
Der Satz: ,,Sie hat auf der Bank neben mir gesessen" trägt gleichwohl zwei
Bedeutungen, deren eine nicht mehr kongruent mit der ursprünglichen ist und nur durch zusätzliche Informationen präzisiert werden kann (durch die Frage, wieviele Bänke der Sprecher sich denkt).
Stehen die Präpositionalphrasen in verschiedenen Kasus, so müssen sie beieinander stehen. Aus Umstellungen ergeben sich Änderungen in der Bedeutung:
Die Frau sich neben mir auf die Bank gesetzt.
_ Neben mir auf die Bank hat sich die Frau gesetzt; Neben mir hat sich die Frau auf die Bank gesetzt.
2. Valenzgebundener oder verbbezogener Dativ
Am Beispiel von Verba dicendi zeigt Draye9, daß der Dativ nur mit Verba simplices kombiniert werden kann, die wenig spezifisch sind:
Er hat [ihm] etwas gesagt, mitgeteilt - *gebrüllt, geschrien,
Dies liegt aber nicht an Eigenschaften des Dativs, sondern an der Einstelligkeit der Verben, die durch Komposition (anbrüllen, zuschreien) aufgehoben werden kann.10 Zur Passivierung dativischer Nominalphrasen dient das ,Bekommen-Passiv':
Hans schenkt Maria ein Buch .
Maria bekommt von Hans ein Buch geschenkt.
Mit Formen von sein wird für dativische Nominalphrasen kein Passiv gebildet.
III. Die sogenannten ,freien Dative' und andere Besonderheiten
Die Definition für einen ,,freien" Dativ beinhaltet dessen Unabhängigkeit von allen anderen Satzgliedern und seine Weglaßbarkeit. Im folgenden wird gezeigt, daß einzig der nicht der Hochsprache angehörende Dativus Ethicus diese Merkmale erfüllt. Alle anderen Dative tragen in unterschiedlichem Ausmaß den Charakter eines Dativobjektes. Da die Verwendtbarkeit dieser Dative eng mit den Bedeutungen ihrer Sätze zusammenhängt, wird in diesem Abschnitt schon hauptsächlich auf den semantische Punkte eingegangen.
1. Der Ethicus
Ein typischer Beispielsatz für einen Ethicus lautet:
Spring mir nicht vom Eiffelturm! oder, im Indikativ: Da springt er uns vom Eiffelturm.
Der Ethicus ist eher in weniger formalen umgangssprachlichen Lagen gebräuchlich11 als in genormter Hochsprache (Du bist mir vielleicht ein Schlingel!). Er bringt persönliche Anteilnahme und Betroffenheit zum Ausdruck und taucht nur mit den Personalpronomen der
1. Person auf.12 Die Merkmale Unabhängigkeit, Nicht-Erfragbarkeit und damit auch Weglaßbarkeit sind erfüllt.
2. Der Judicantis
Mit dem Judicantis setzt der Sprecher dem Dativobjekt durch ein Adjektiv oder Adverb eine Norm, nach der das Subjekt beurteilt wird:
Dieser Tee ist mir zu bitter.
Dieser Tee ist mir stark genug.
Der Judicantis ist kein ,freier Dativ', da er von einem ,,specific sentence constituent"13, nämlich eben der gesetzten Norm, abhängt. Man vergleiche den Bedeutungsverlust durch Weglassen mit einem Ethicus:
Dieser Tee ist (mir) zu bitter - Spring (mir) nicht vom Eiffelturm!
Der Satz ohne den Judicantis bleibt zwar grammatikalisch korrekt und sinnvoll, verliert jedoch den Inhalt der persönlichen Normsetzung und Beurteilung durch den Sprecher, während bei dem Satz ohne Ethicus lediglich die Betonung der persönlichen Betroffenheit verloren geht. Zudem ist der Judicantis im Gegensatz zum Ethicus mit einer Präpositionalkonstruktion austauschbar:
Dieeser Tee ist zu bitter für mich.
Dabei geht jedoch ein Anteil Subjektivität gegenüber dem Judicantis verloren; das Personalpronomen bringt mehr von der Persönlichkeit des Referenten zum Ausdruck. Die Verwendbarkeit des Judicantis hängt von den Eigenschaften der gesetzten Norm und von deren Bedeutung für das Dativobjekt ab:
* Dieser Mann ist dir zu alt - Dieser Mann ist zu alt für dich. Diese Hose ist dir zu klein.
Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen? Weshalb kann im ersten Fall kein
Judicantis stehen und im zweiten Fall doch? Werden die Sätze als Ja-Nein-Fragen konstruiert, so ist der Judicantis nicht mehr problematisch:
Ist dieser Mann dir zu alt? - Ist diese Hose dir zu klein?
Anders als oben gibt der Sprecher, nachdem er die Norm gesetzt hat, die Urteilskompetenz an das Dativobjekt ab. Die direkt betroffene Person befindet sich ,näher' am zu beurteilenden Subjekt als der Sprecher. Bedingen möglicherweise gesellschaftliche Konventionen, bei der Beurteilung des Mannes mehr Distanz zu wahren als bei Kleidungsstücken? Oder müßte dieser Satz korrekt heißen: ,,Dieser Mann ist mir/uns dir zu alt?", also zwei Dative tragen?
3. Der Possesivus oder Pertinenzdativ
Beim Pertinenzdativ tritt der Dativ zusammen mit einem Attribut auf. Dieses repräsentiert unveräußerlichen, inhärenten ,Besitz' wie Körperteile oder Verwandte, auch Dinge, die zum Zeitpunkt der Aktion zum Objekt gehören:
Sie haben ihm den linken Arm gebrochen.
Diese Konstruktion ist nicht ersetzbar durch:
Sie haben seinen linken Arm gebrochen, da ein signifikanter semantischer Unterschied im Ausmaß des Erlebens des Betroffenen besteht: im ersten Fall ist die Beteiligung intensiver. Deutlicher wird dieser in Sätzen wie:
Dem Missionar ist eine Katze vor den Wagen gelaufen.
Dem Missionar ist eine Katze vor seinen Wagen gelaufen. Es ist eine Katze vor den Wagen des Missionars gelaufen.
In den ersten beiden Fällen ist die Unfallsituation deutlicher als im dritten; dort kann das Auto auch geparkt stehen.
4. Der Commodi
Die Bezeichnung ,,Dativus Commodi" rührt von der zugrundeliegenden Idee her, daß dem Dativobjekt etwas angenehmes geschieht, wie in:
Der Professor zahlt dem Studenten das Bier.
Der Commodi ist austauschbar mit Konstruktionen mit für, zugunsten, statt oder Genitiv, jedoch nicht ersetzbar, da sich sich jeweils Bedeutungsverschiebungen ergäben. Weglassen führt zu einem entscheidenden Bedeutungsverlust. Nur Verben, die nicht eine Dativergänzung fordern, können den Dativus Commodi führen.14
5. Der Incommodi
Analog zum Commodi liegt dem Dativus Incommodi die Idee zugrunde, daß dem Dativobjekt etwas unangenehmes geschieht.15 Anders als der Commodi kann er zwar nicht mit einer Präpositionalphrase ausgetauscht werden, aber durch eine genitivische Nominalphrase:
Dem Niederländer welken die Tulpen - Die Tulpen des Niederländers welken, welche eine entscheidende Bedeutungsverschiebung auslöst und daher keinen Ersatz darstellt. Die beiden Sätze unterscheiden sich wieder hinsichtlich der Beteiligung des Dativobjektes bzw. der Nomimalphrase am Geschehen: Dem Niederländer welken die Tulpen läßt die Eigentumsfrage offen, verdeutlicht aber die Verantwortung des Referenten. Den Status als freie Dative für Commodi und Incommodi widerlegt, daß sich bei beiden eine entscheidende Sinnänderung ergibt, wenn sie weggelassen werden. Der ,,specific sentence constituent", von dem sie abhängen, ist die Verantwortung bzw. das Zulassen der Aktion seitens des Dativobjektes. Da die Grenzen zwischen Commodi/Incommodi und ,valenzabhängigem' Dativ fließend sind, böte sich an, willkürlich die Tatsache als Grenze festzusetzen, daß Commodi und Incommodi nur bei Verben auftreten, die eine Dativergänzung nicht nur nicht fordern, sondern mit ihnen auch in weniger intensiver Beziehung stehen.16
III. Der Dativ und die Semantik - Dativ und Akkusativ
1. Die dativische Präpositionalphrase
Dativ und Akkusativ beschreiben grundverschiedene Sachverhalte:
Gustav läuft im Wald - Gustav läuft in den Wald.
Der Dativ beschreibt den Verbleib der Handlung innerhalb eines vom Sprecher umrissenen topischen Bereiches, der auch abstrakt sein kann:17
Sie ist in anderen Umständen - Sie ist in andere Umstände geraten.
Im ersten Beispiel werden die Grenzen des topischen Bereiches nicht überschritten - entsprechend steht der Dativ. Das zweite Beispiel beschreibt mit einem anderen Verb und mit dem Akkusativ das Überschreiten der Grenzen.
Demnach kann ein Großteil der Verben nach dem Kriterium der Bewegung dem Akkusativ oder dem Dativ zugeordnet werden: Verba movendi nehmen eher den Akkusativ, Verba standi den Dativ:18 stellen, setzen (+Akk) - stehen, sitzen (+Dat)
Einschränkungen dieser vermeintlichen Regel ergeben sich durch die Intensität der Bewegung:
In ihren Wimpern hängen Tränen - * In ihre Wimpern hängen Tränen.
* Die Kabel hängen auf der Straße - Die Kabel hängen auf die Straße.
Draye erklärt die Verwendung der verschiedenen Kasus für die -grammatikalisch- gleiche Art der Aktion durch den Unterschied in der Dynamik der Bewegung; das Herabhängen abgerissener Kabel beschreibt einen weitaus größeren topischen Bereich als ein Paar feuchte Augen.19
Ebenso bleibt der topische Bereich statisch und unverletzt bei:
Er lief hinter mir
und wird verletzt bei:
Er lief hinter mich.
Auf den ersten Blick wird der topische Bereich auch verletzt bei:
Er lief hinter mir hervor.
Daß trotz der Grenzüberschreitung ein Dativ steht, liegt an der Verwendung eines anderen Verbs, eines Kompositums, und daran, daß der topische Bereich hier nicht sofort deutlich wird. Besser erkennbar ist er in:
Die Studenten gehen von der Bibliothek in die Mensa.
Hier liegen zwei topische Bereiche vor. Die ,Grenzen' der Mensa werden überschritten, daher steht der Akkusativ. Die Präpositionalphrase von der Bibliothek jedoch bezeichnet einen exklusiven topischen Bereich, die auf ihn bezogene Bewegung findet überall dort statt, wo nicht ,die Bibliothek' ist. Ebenso bezeichnet Er lief hinter mir hervor eine Bewegung, die überall, außer hinter mir geschehen kann. ,Überall, außer hinter mir' wird eingeschränkt durch eine nicht ausgesprochene Grenzziehung durch den Sprecher, der sich bei seiner Aussage nur auf die nächste Umgebung des Subjekts beziehen wird. Ebenso bezieht sich der Sprecher von: Die Studenten gehen von der Bibliothek in die Mensa. auf bestimmte Örtlichkeiten, deren Identität er bei seinen Zuhörern als bekannt voraussetzt.
2. Der verbbezogene Dativ
a) Unterscheidung nach Verbsemantik
Bei psychologischen und somatischen Verben (träumen, schmerzen, grauen, nicht: schwanen) tritt der Dativ in Konkurrenz mit dem Nominativ:
Mir ekelt [es] vor fetten Speisen - Ich ekle mich vor fetten Speisen.
Analog zu den Eigenschaften von Objekt und Subjekt in einem Satz hat der Referent im Dativ weniger Kontrolle über die Handlung als im Nominativ.20 Je nach Beteiligung des Dativ-Objektes bzw. des Subjektes können diese im Satz agentive bis unagentive Züge aufweisen. Der Satz:
Ich erinnere mich an die Namen der Spender.
beinhaltet mehr aktive Beteiligung des Referenten und Betroffenen am Geschehen als der im Resultat gleichbedeutende
Mir fallen die Namen der Spender wieder ein.
Damit besteht auch ein entscheidender Bedeutungsunterschied zwischen beiden Sätzen, der noch deutlicher ist in:
Mir wird schlecht - Ich werde schlecht. 21
b) Spannung zwischen Dativobjekt und Präpositionalphrasen Die beiden Sätze:
Er hat seinem Vater [einen Brief] geschrieben - Er hat [einen Brief] an seinen Vater geschrieben unterscheiden sich im Grad der Beteiligung des Dativobjekts bzw. der Präpositionalphrase an der Handlung - der erste Satz impliziert, daß der Brief auch wirklich abgeschickt wurde. Ist der zweite in dieser Hinsicht ungenau, so ist es der erste, wenn die (durch den Kontext aufzuklärende) Frage auftaucht, ob hier nicht auch ein Dativus Commodi gelten könnte.
Die Präpositionalphrase bzw. das Dativobjekt steht in einer Beziehung mit dem
direkten Objekt, selbst dann, wenn keines explizit auftaucht (er hat _ an seinen
Vater/seinem Vater geschrieben). Ob Dativobjekt und Präpositionalphrase
austauschbar sind, richtet sich nach dem Abstraktionsgrad des direkten Objekts und nach dem Grad der Beteiligung des Betroffenen:
Er hat seinem Vater eine Neuigkeit geschrieben -
*Er hat an seinen Vater eine Neuigkeit geschrieben. Der Koch hat zu viel Salz an die Suppe gegeben
*Der Koch hat der Suppe zu viel Salz gegeben. 22
Die Grenzen zum Dativus Commodi bzw. Incommodi sind jeweils fließend.
IV. Zusammenfassung
Für die dativische Präpositionalphrase gilt, daß sie in jedem Fall den Verbleib ihres
Referenten im topischen Bereich beschreibt. Dessen Grenzen werden vom Sprecher
empfunden und umrissen und können auch einen exklusiven topischen Bereich beschreiben (Ich sitze auf dem Stuhl - Ich gehe aus dem Raum).
Die drei wesentlichen Merkmale des verbbezogenen Dativobjekts sind die Belebtheit bzw. (fiktive) Persönlichkeit des Objekts, dessen Betroffenheit, bis hin zu teilweiser oder voller Verantwortung für die Handlung; dadurch erhält das Dativobjekt Agens-Charakter. Als einziger freier, weil vollends vom Restsatz unabhängiger Dativ kann der Ethicus gelten; die anderen Dative (Judicantis, Pertinenzdativ, Commodi und Incommodi) sind jeweils von einem meist nicht explizit erscheinenden ,,specific sentence constituent" abhängig und daher nicht frei. Von den ,valenzgebundenen' Dativen können sie anhand weniger intensiver Bindungen an die anderen Satzlglieder unterschieden werden.
Verzeichnis der verwendeten Literatur:
Draye, Luk: The German Dative. In: Willy van Langendonck / William van Belle (Hgg.): The Dative. Bd. 1: Descriptive Studies. Amsterdam: John Benjamins 1996 S. 155-215.
Eisenberg, Peter: Grundriß der deutschen Grammatik. Bd. 2: Der Satz. Stuttgart: Metzler 1999.
Lühr, Rosemarie: Neuhochdeutsch. München: Wilhelm Fink 1986.
Gedicht: Morgenstern, Christian: Werke und Briefe. Stuttgarter Ausgabe Band III. Stuttgart: Urachhaus 1990.
1 Christian Morgenstern: Werke und Briefe. Stuttgarter Ausgabe Band III S. 87f.
2 Peter Eisenberg, Grundriß der deutschen Grammatik. Bd. 2: Der Satz. Stuttgart: Metzler 1999. S. 286.
3 Luk Draye, The German Dative. In: Willy van Langendonck / William van Belle (Hgg.): The Dative. Bd. 1: Descriptive Studies. Amsterdam: John Benjamins 1996. S. 155-215.
4 Im Original ,,adverbal dative", z. B. S. 174.
5 Eisenberg S. 188ff.
6 Im Folgenden wird nach Draye S. 168ff die Bezeichnung one way-, two way- oder three way- Präpositionen benutzt.
7 S. u. S. 9.
8 Dazu Draye, S. 170. Zwar ist der Akkusativ auch in den Konstruktionen 3 und 4 vorstellbar, jedoch tritt er meistens wie in 1 auf. Die Frage nach dem ,Gewohnheitsrecht' des Akkusativs kann hier nicht genauer verfolgt werden.
9 Draye S. 174ff.
10 Zur Verwendung von Dativ oder Akkusativ s. u. S. 9ff. Verben wie sagen/mitteilen sind in ihrer Bedeutung mehr auf den Transfer bezogen, während brüllen/schreien mehr Gewicht auf die Art der Handlung legen.
11 Rosemarie Lühr, Neuhochdeutsch. München: Wilhelm Fink 1986 S. 65.
12 Der Satz ,,Er sprang seiner Mutter vom Eiffelturm" suggeriert fälschlicherweise einen Pertinenzdativ und erfüllt das Merkmal der persönlichen Anteilnahme nicht.
13 Draye S. 158.
14 Lühr, Neuhochdeutsch S. 65f. Demnach ist das entscheidende Kriterium für den ,Commodi' nicht das Angenehme sondern die Valenz des Verbs.
15 Sowohl Commodi als auch Incommodi können mit Negationspartikeln vom Angenehmen zum Unangenehmen bzw. umgekehrt gebracht werden: ,,Der Professor zahlt dem Studenten das Bier nicht." - ,,Dem Niederländer welken keine Tulpen."
16 Ein deutlicher Commodi, ein zweifelhafter und ein deutlicher valenzabhängiger Dativ wären: Hans bezahlt Maria ein Buch - Hans kauft Maria ein Buch - Hans gibt Maria ein Buch. Die Beziehungen zwischen dativischer NP und Verb nehmen vom Commodi zum valenzabhängigen Dativ an Intensität zu, was zu der fälschlichen Einordnung des Commodi/Incommodi als ,freie' Dative beigetragen hat.
17 Draye S. 186. Der Begriff ,,landmark" ist zu ungenau, weil ihm die Grenzziehung durch den Sprecher fehlt.
18 Draye S. 187.
19 Draye S. 187f.
20 Draye S. 193.
21 Andere Adjektive beinhalten eine andere Beteiligung des Betroffenen: ,,Ich werde brav - *Mir wird brav."
22
Häufig gestellte Fragen
Was behandelt der Text hauptsächlich?
Der Text analysiert den Dativ im Deutschen, einschließlich seiner syntaktischen und semantischen Eigenschaften, sowie die Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Dativen wie dativische Präpositionalphrasen, verbbezogene Dative und sogenannte "freie" Dative.
Was sind dativische Präpositionalphrasen und wie werden sie verwendet?
Dativische Präpositionalphrasen sind Phrasen, die durch Präpositionen mit Dativ gebildet werden. Der Kasus (Dativ oder Akkusativ) bei two-way-Präpositionen hängt von der Art der Bewegung ab: Akkusativ bei Überschreitung der Grenze eines topischen Bereiches, Dativ bei Bewegung innerhalb des topischen Bereiches. Die Position der Präpositionalphrase im Satz ist relativ frei, solange keine Verwechslung mit dem Akkusativ droht oder verschiedene Kasus kombiniert werden.
Was ist ein verbbezogener Dativ?
Ein verbbezogener Dativ ist ein Dativobjekt, das eng mit dem Verb verbunden ist und dessen Verwendung oft von der Verbsemantik abhängt. Nur Personen erscheinen im Dativ (wobei das Wort Personen in diesem Falle auch fiktive Personen, wie z. B. ein Kollektiv oder ein Objekt, dem Persönlichkeit zugeschrieben werden kann, bezeichnet).
Was sind die sogenannten "freien" Dative und welche Arten werden unterschieden?
Die sogenannten "freien" Dative sind Dative, die angeblich unabhängig von anderen Satzgliedern sind und weggelassen werden können. Der Text untersucht den Ethicus, Judicantis, Possesivus (Pertinenzdativ), Commodi und Incommodi. Es wird argumentiert, dass nur der Ethicus wirklich "frei" ist, da die anderen von einem "specific sentence constituent" abhängen.
Was ist der Unterschied zwischen Ethicus, Judicantis, Possesivus, Commodi und Incommodi?
- Ethicus: Bringt persönliche Anteilnahme und Betroffenheit zum Ausdruck und taucht nur mit Personalpronomen der 1. Person auf.
- Judicantis: Setzt dem Dativobjekt durch ein Adjektiv oder Adverb eine Norm, nach der das Subjekt beurteilt wird.
- Possesivus (Pertinenzdativ): Tritt zusammen mit einem Attribut auf, das unveräußerlichen "Besitz" repräsentiert (Körperteile, Verwandte).
- Commodi: Dem Dativobjekt geschieht etwas Angenehmes.
- Incommodi: Dem Dativobjekt geschieht etwas Unangenehmes.
Wie unterscheidet sich der Dativ vom Akkusativ hinsichtlich der Semantik?
Der Dativ beschreibt den Verbleib der Handlung innerhalb eines topischen Bereiches, während der Akkusativ die Überschreitung der Grenzen dieses Bereiches beschreibt. Verba movendi nehmen eher den Akkusativ, Verba standi den Dativ.
Was ist die Spannung zwischen Dativobjekt und Präpositionalphrasen?
Dativobjekt und Präpositionalphrasen können in Beziehung zum direkten Objekt stehen. Die Austauschbarkeit hängt vom Abstraktionsgrad des direkten Objekts und dem Grad der Beteiligung des Betroffenen ab. Die Grenzen zum Dativus Commodi bzw. Incommodi sind fließend.
Was sind die Hauptmerkmale des verbbezogenen Dativobjekts?
Die Hauptmerkmale sind die Belebtheit bzw. (fiktive) Persönlichkeit des Objekts, dessen Betroffenheit bis hin zu teilweiser oder voller Verantwortung für die Handlung. Dadurch erhält das Dativobjekt Agens-Charakter.
Wie ist die Beziehung zwischen Dativ und Verben im Zusammenhang mit der Semantik?
Bei psychologischen und somatischen Verben (z. B. träumen, schmerzen) konkurriert der Dativ mit dem Nominativ. Der Referent im Dativ hat weniger Kontrolle über die Handlung als im Nominativ. Je nach Beteiligung können diese im Satz agentive bis unagentive Züge aufweisen.
- Citation du texte
- Rüdiger Lauermann (Auteur), 2000, Der Dativ. Besonderheiten und Problemfälle in der Syntax, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98398