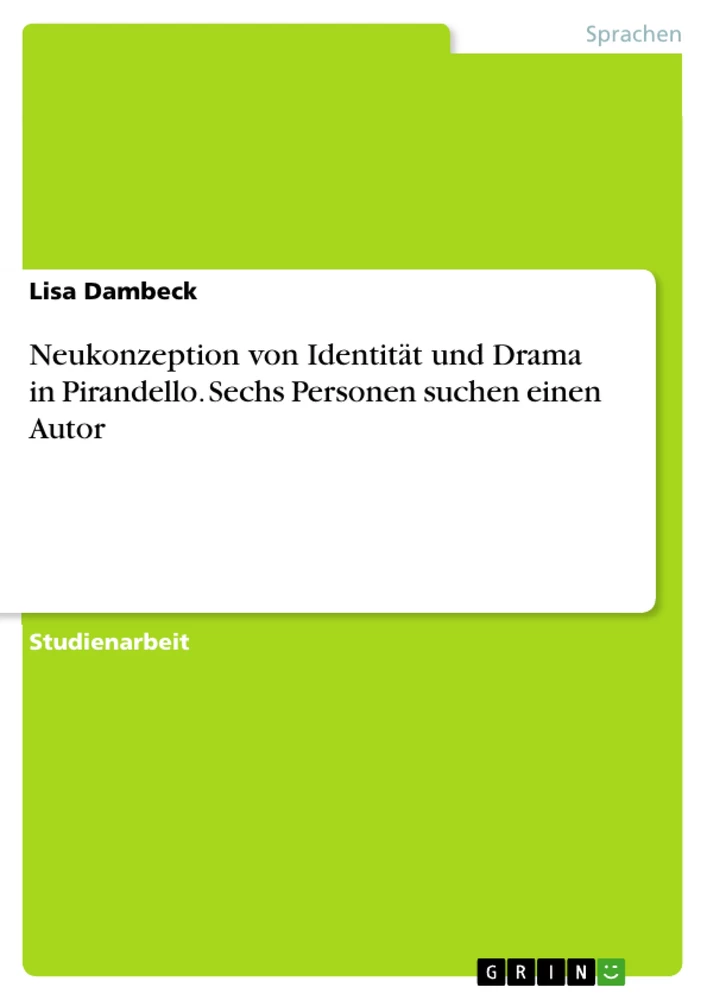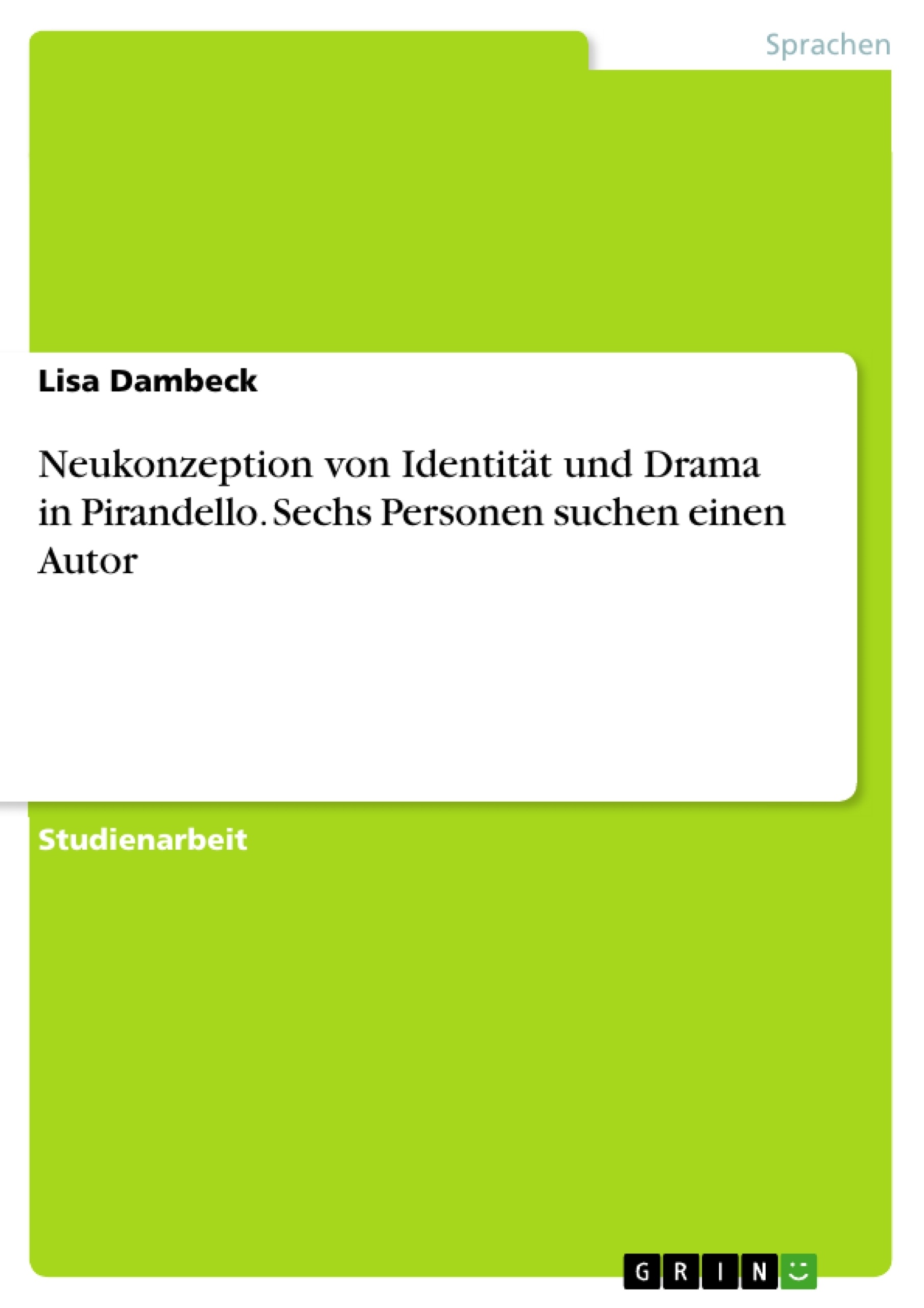Im Mittelpunkt dieser Arbeit soll die Frage nach der neuen Konzeption von Identität im modernen pirandellesken Drama stehen. In sechs Personen verarbeitet Pirandello seine Ideen zur Selbstdefinition, welche die Thematisierung der Unmöglichkeit des Theaters innerhalb eines Theaterstückes rechtfertigen und die Neukonzeption des Dramas erforderlich machen.
Pirandello hat das Theater revolutioniert. Sein Werk steht im Kontext der zeitgenössischen Vorstellung von Identität und Rolle sowie der Metatextualität - das Drama selbst wird zum Gegenstand der Betrachtung. Die vorliegende Arbeit widmet sich zunächst dem Vergleich des traditionellen und des 'pirandellesken' Theaters. Zu Beginn soll daher das Wesen des Dramas und seine Funktion im Fokus stehen. Der zweite Teil widmet sich der Thematisierung von Identität in dem Stück Sechs Personen unter Betrachtung literaturhistorischer Gesichtspunkte. Zu guter Letzt wenden wir uns mit kritischem Blick dem traditionellen Medium des Theaters, der fixierten Sprache, zu.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Dramentheorie
- 2. Das Wesen des Dramas
- 3. Pirandello und das moderne Theater
- 4. Theater als soziale Institution und das Prinzip des Sich-leben-Sehens
- III. Eine Neukonzeption von Identität und Drama
- 5. Identität
- 6. Historische Rahmenbedingungen
- 6.1. Ein Autor des Fin de siècle - „Auslöschung des Subjekts“
- 6.2. Die Identitätskrise des théâtre de l'entre-deux-guerres
- 6.3. Freud, die Psychoanalyse und das Unbewusste
- 7. Pirandellos Sechs Personen im historischen Kontext
- EXKURS: theatrum mundi – eine Rolle spielen
- 8. Die Identität der Sechs Personen
- 9. Polyphonie der Figuren
- IV. Theater und Sprache
- 10. Das Wesen der Sprache
- 11. Die Sprache des Unbewussten
- V. Schlussbetrachtung – La vie fluide et la forme
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die neuartige Konzeption von Identität im modernen Drama am Beispiel von Luigi Pirandellos Stück "Sechs Personen suchen einen Autor". Dabei wird insbesondere auf die Thematisierung der Unmöglichkeit des Theaters innerhalb des Stückes und die daraus resultierende Neukonzeption des Dramas eingegangen.
- Die Unmöglichkeit, das Leben in ein Kunstkonstrukt einzubinden
- Die Bedeutung von Sprache und Worten im Theater
- Die Fragmentierung der Persönlichkeit durch das "Ich" und das Gegenüber
- Das Theater als Spiegel der Realität
- Die Interaktion von Sein und Schein im Leben
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Stückes "Sechs Personen suchen einen Autor" ein und beschreibt die Situation, in der sich die sechs Personen befinden: Sie suchen einen Autor, der ihre tragische Familiengeschichte auf die Bühne bringen soll.
Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Dramentheorie und den grundlegenden Merkmalen der Gattung. Dabei werden die Neuerungen des "pirandellesken" Theaters im Vergleich zum traditionellen Drama herausgestellt.
Im dritten Kapitel steht die Thematisierung von Identität im Mittelpunkt. Pirandellos Werk "Sechs Personen" wird in den Kontext des zeitgenössischen Diskurses über Identität und Rolle gestellt. Das Kapitel beleuchtet außerdem die historischen Rahmenbedingungen für Pirandellos Werk und seine Auseinandersetzung mit der "Identitätskrise" des frühen 20. Jahrhunderts.
Der vierte Abschnitt widmet sich dem Medium Sprache und dessen Rolle im Theater. Dabei wird die Sprache des Unbewussten im Kontext von Pirandellos Dramen untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themen Identität, Theater, Drama, Sprache, Unbewusstes, Luigi Pirandello, "Sechs Personen suchen einen Autor", moderne Dramen, Metafiktion, Metatheater, Spiel im Spiel, Realität und Schein.
- Citation du texte
- Lisa Dambeck (Auteur), 2020, Neukonzeption von Identität und Drama in Pirandello. Sechs Personen suchen einen Autor, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/984218