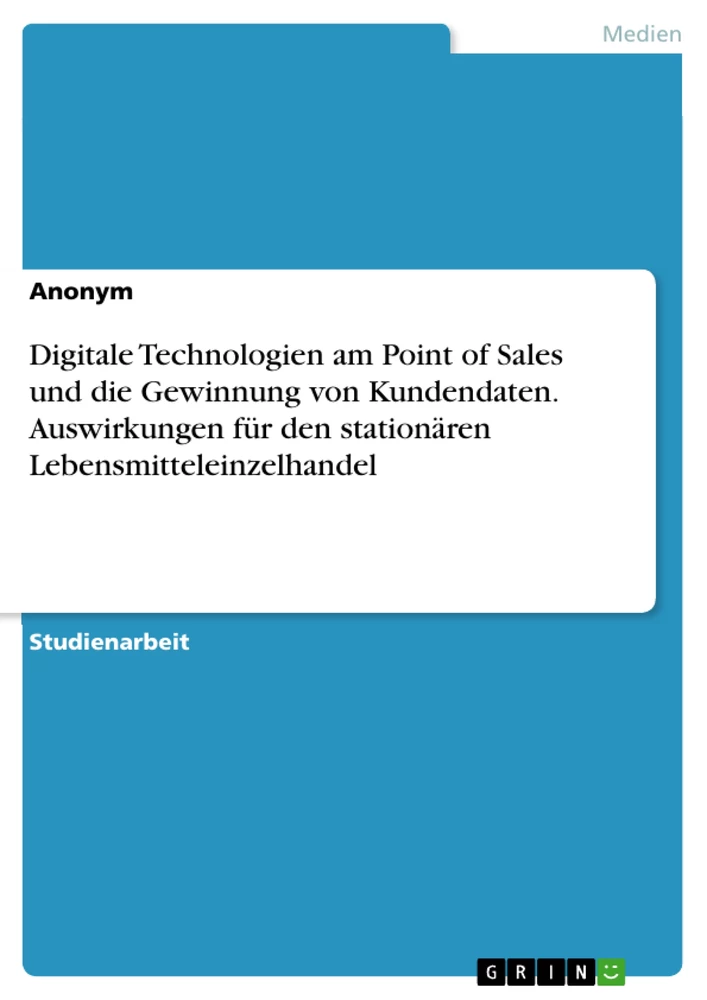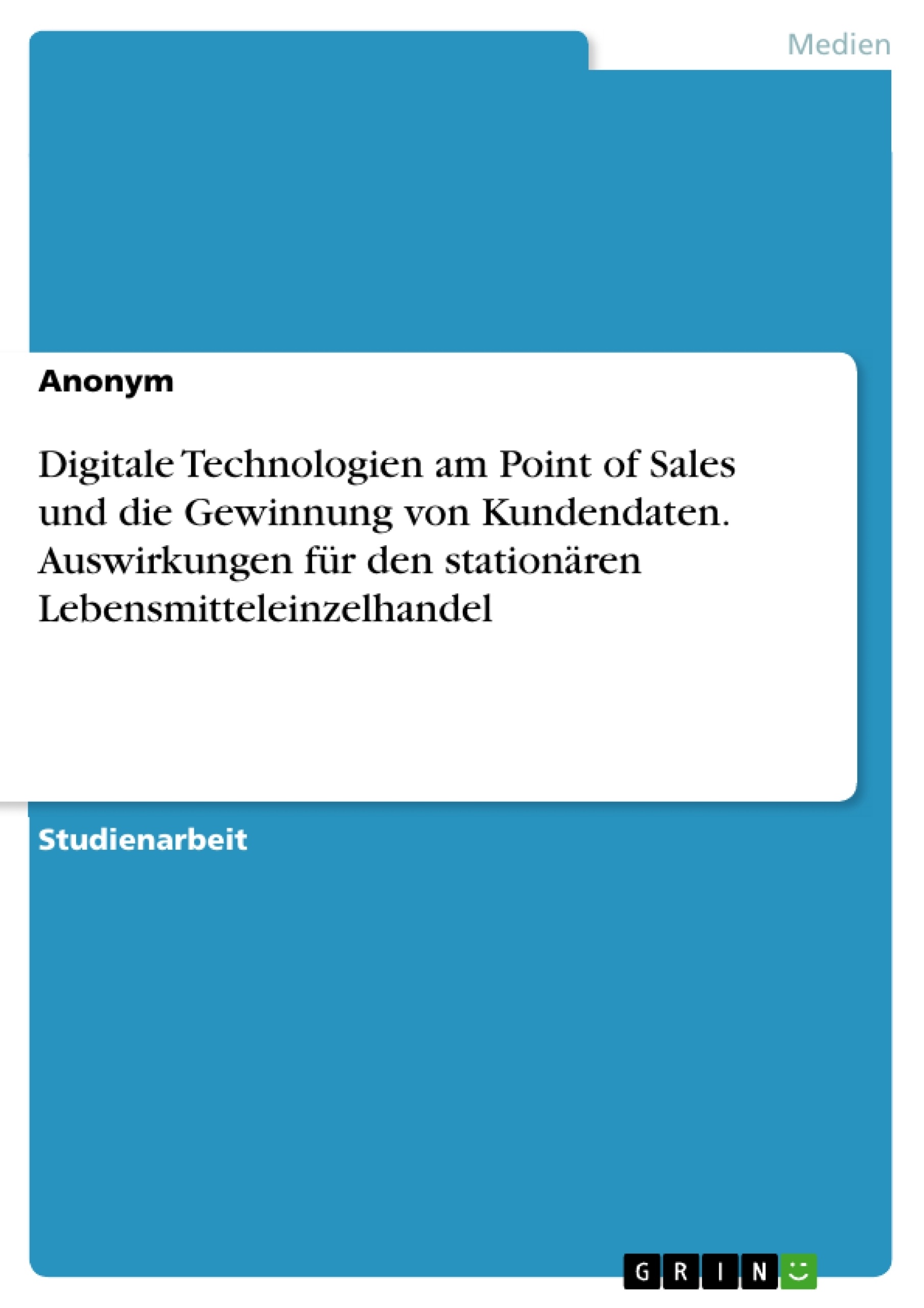Welche Technologien durch die Digitalisierung, speziell zur Gewinnung von Kundendaten, bereits implementiert wurden und welche Vorteile diese den jeweiligen Betriebsformen des LEH (Lebensmitteleinzelhandels) bieten, wird in dieser Arbeit näher betrachtet. Außerdem bewertet die vorliegende Arbeit die verschiedenen Technologien zur Kundendatengewinnung für verschiedene Betriebsformen des stationären Lebensmitteleinzelhandels.
Der Handel befindet sich in einem Wandel. Die Auswirkungen der Digitalisierung sind in dieser Branche sehr stark. Der sich verändernde Bedarf durch verändertes Kundenverhalten, aber auch neue Vertriebskanäle fordert den Einsatz innovativer Techniken im stationären Lebensmitteleinzelhandel. Der stationäre Einzelhandel steht vor der Herausforderung, aus den vielen verfügbaren Technologien am Markt die für sich geeigneten Techniken ausfindig zu machen und zu etablieren. In Bezug auf die Gewinnung von Kundendaten haben Onlinehändler dem stationären Einzelhandel gegenüber einen Informationsvorsprung. Mittlerweile gibt es jedoch auch für den stationären Einzelhandel Möglichkeiten, Daten von Kunden zu gewinnen. Viele Technologien haben sich hierzu bereits im stationären Einzelhandel etabliert, andere hingegen befinden sich noch in der Testphase.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- Kundendaten
- POS
- Stationärer Lebensmitteleinzelhandel
- Betriebsformen des LEH
- Discounter
- Supermarkt
- Verbrauchermarkt
- Selbstbedienungswarenhaus
- Betriebsformen des LEH
- Digitale Technologien
- Location Based Services
- RFID
- NFC
- BLE und Beacons
- WLAN und GPS
- Wearables
- Augmented Reality
- Optische Sensoren
- Mobile App
- Trackingsysteme
- Location Based Services
- Technologien der Kundengewinnung im stationären LEH
- Stand der Digitalisierung im LEH zur Kundendatengewinnung
- Vorteile der Technologien für den LEH
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit den Auswirkungen digitaler Technologien am Point of Sale (POS) auf die Gewinnung von Kundendaten im stationären Lebensmitteleinzelhandel (LEH). Ziel ist es, die verschiedenen Technologien und deren Einsatzmöglichkeiten im LEH zu analysieren und deren Einfluss auf die Datenerfassung und -nutzung zu beleuchten.
- Digitalisierung im LEH
- Kundendatengewinnung durch digitale Technologien
- Vorteile und Herausforderungen der Datenerfassung
- Einsatzmöglichkeiten von Location Based Services, Wearables und Augmented Reality
- Datenschutz und Datensicherheit im Kontext des stationären LEH
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Relevanz des Themas Digitalisierung im stationären LEH dar und führt in die Thematik der Kundendatengewinnung ein. Sie definiert den Forschungsgegenstand und die Zielsetzung der Arbeit.
- Grundlagen: Dieses Kapitel bietet grundlegende Informationen zu den Themen Kundendaten, POS und stationärem Lebensmitteleinzelhandel. Es werden verschiedene Betriebsformen des LEH vorgestellt und wichtige digitale Technologien, wie Location Based Services, Wearables und Augmented Reality, erläutert.
- Technologien der Kundengewinnung im stationären LEH: In diesem Kapitel werden die Einsatzmöglichkeiten digitaler Technologien im LEH zur Kundendatengewinnung analysiert. Es wird der aktuelle Stand der Digitalisierung im LEH und die Vorteile der Technologien für den Handel beleuchtet.
Schlüsselwörter
Digitale Technologien, Kundendaten, Lebensmitteleinzelhandel, Point of Sale (POS), Location Based Services, Wearables, Augmented Reality, Datenerfassung, Datenschutz, Datensicherheit.
Häufig gestellte Fragen
Welche digitalen Technologien werden am Point of Sale (POS) eingesetzt?
Eingesetzt werden Location Based Services (RFID, NFC, Beacons, WLAN), Wearables, Augmented Reality, optische Sensoren und mobile Apps.
Wie profitiert der stationäre Lebensmittelhandel von der Datengewinnung?
Durch die Gewinnung von Kundendaten kann der stationäre Handel den Informationsvorsprung von Onlinehändlern verringern und Angebote besser auf das Kundenverhalten zuschneiden.
Welche Betriebsformen des LEH werden in der Arbeit unterschieden?
Die Arbeit betrachtet Discounter, Supermärkte, Verbrauchermärkte und Selbstbedienungswarenhäuser.
Was sind Beacons und wie werden sie genutzt?
Beacons nutzen Bluetooth Low Energy (BLE), um den Standort von Kunden im Laden zu bestimmen und ortsbezogene Informationen oder Angebote auf deren Smartphones zu senden.
Spielen Datenschutz und Datensicherheit eine Rolle?
Ja, die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Anforderungen an den Datenschutz bei der Erfassung von Kundendaten im stationären Handel.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2020, Digitale Technologien am Point of Sales und die Gewinnung von Kundendaten. Auswirkungen für den stationären Lebensmitteleinzelhandel, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/984770