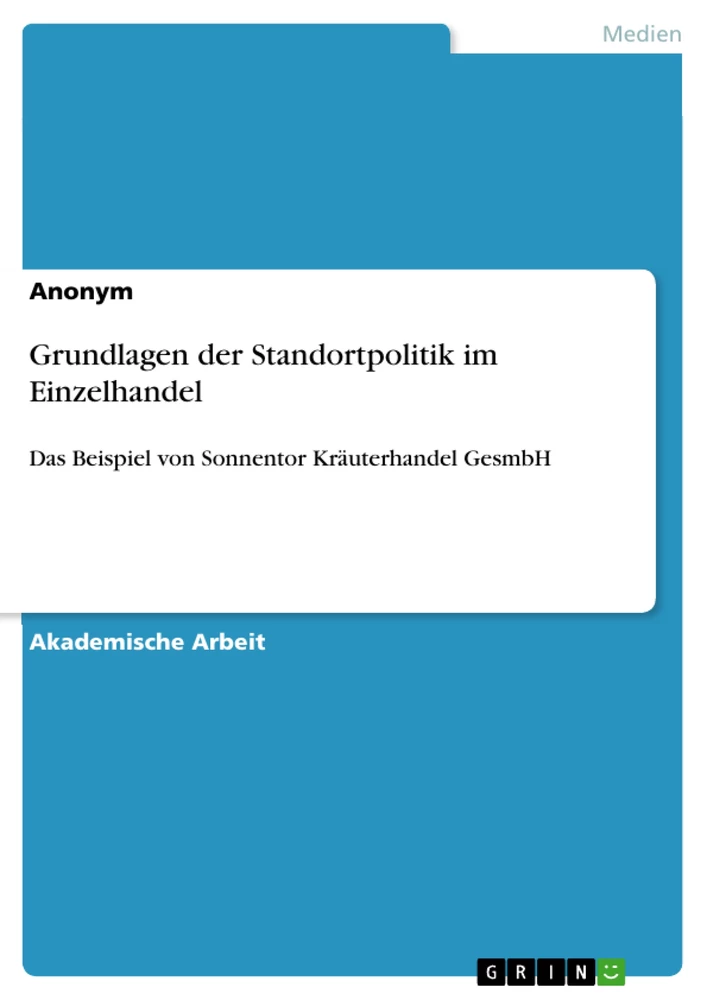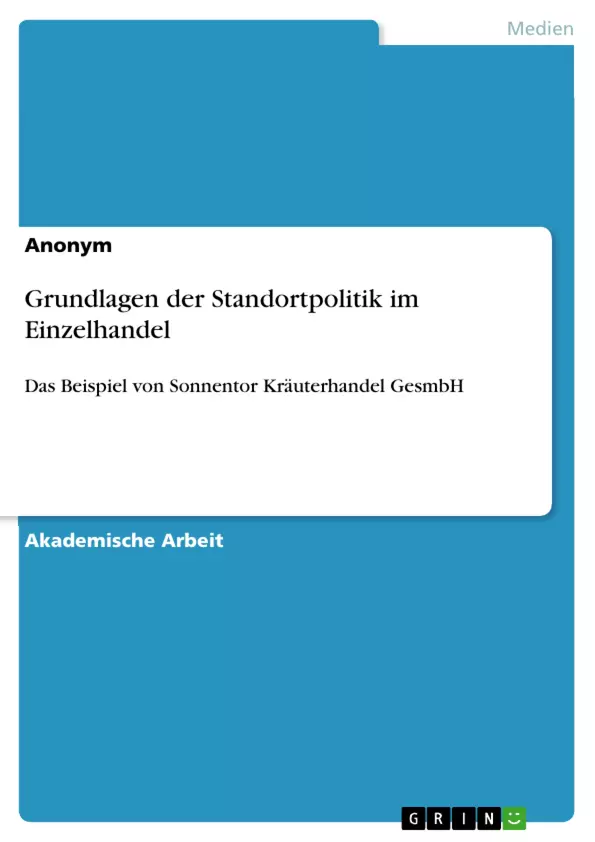In modernen Volkswirtschaften ist Konsum verantwortlich für Zweidrittel der gesamt-wirtschaftlichen Nachfrage, so dass die Nachfrage nach Gütern bei einer wachsenden Wirtschaft rasant ansteigt. Der Einzelhandel ist zur Bedürfnisbefriedigung der Konsumenten unabdingbar. Produktion und Endverbraucher benötigen den Einzelhandel als Bindeglied.
Es ist allgemein anerkannt, dass der Standort stationärer Einzelhandelsunternehmen einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren für Unternehmen ist. Zugleich könne man eine schlechte Standortentscheidung nur schwer mit anderen Maßnahmen ausgleichen. Die Entscheidung einer Einzelhandelsunternehmung für einen bestimmten Standort determiniert gleichzeitig das relevante Einzugsgebiet somit das vor Ort herrschende Absatzpotential. Die Wahl des Standortes ist von verschiedenen, in dieser Arbeit erläuterten Standortkriterien abhängig, und zählt neben der Geschäftszweigwahl, zu den ersten unternehmerischen Entscheidungen der Einzelhandelsunternehmen. Die folgende Arbeit beschäftigt sich mit den Grundlagen der Standortpolitik. Zusätzlich wird mit der Fallstudie zur Sonnentor Kräuterhandels GesmbH ein praktisches Beispiel erörtert, um dem Leser einen besseren Einblick in die Thematik zu ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen
- Der Begriff „Standort“, „Standortpolitik“ und „Einzelhandel“
- Ziele der Standortpolitik
- Standortfaktoren
- Standortmanagement
- Instrumente der Standortwahl
- Fallstudie Sonnentor Kräuterhandels GesmbH
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Grundlagen der Standortpolitik im Einzelhandel anhand der Fallstudie der Sonnentor Kräuterhandels GesmbH. Ziel ist es, die Bedeutung der Standortwahl für den Unternehmenserfolg zu verdeutlichen und verschiedene Standortfaktoren sowie -instrumente zu analysieren.
- Bedeutung des Standorts für den Einzelhandelserfolg
- Analyse relevanter Standortfaktoren
- Instrumente der Standortwahl und deren Anwendung
- Fallstudie Sonnentor: Standortentscheidungen und deren Auswirkungen
- Zusammenhang zwischen Standortpolitik und Unternehmenszielen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung betont die immense Bedeutung des Einzelhandels für moderne Volkswirtschaften und hebt die zentrale Rolle der Standortwahl für den Erfolg stationärer Einzelhandelsunternehmen hervor. Sie führt in die Thematik ein und kündigt die anschließende Analyse der Grundlagen der Standortpolitik sowie die Fallstudie zu Sonnentor an. Die Einleitung verweist auf die enge Verknüpfung von Produktionsfaktoren, Absatzpotential und der Notwendigkeit einer fundierten Standortentscheidung für langfristigen Erfolg.
Grundlagen: Dieses Kapitel definiert die Kernbegriffe „Standort“, „Standortpolitik“ und „Einzelhandel“. Es unterstreicht die langfristige und strategische Bedeutung von Standortentscheidungen, da diese nur schwer revidierbar sind und den Erfolg eines Unternehmens maßgeblich beeinflussen. Am Beispiel von Walmart wird die Bedeutung der Standortwahl als Alleinstellungsmerkmal in einem Marktgebiet illustriert. Das Kapitel legt den Grundstein für das Verständnis der folgenden Kapitel und veranschaulicht, warum der Standort als der wichtigste Faktor im Einzelhandel gilt.
Standortfaktoren: Dieses Kapitel (voraussichtlich) befasst sich mit den verschiedenen Kriterien, die bei der Standortwahl berücksichtigt werden müssen. Es werden verschiedene Faktoren und Instrumente beleuchtet, welche die Entscheidungen beeinflussen und den Erfolg des Unternehmens langfristig sichern sollen. Die Zusammenfassung wird die verschiedenen Aspekte aufzeigen und die Wichtigkeit für eine fundierte Auswahl hervorheben. Ein Fokus liegt sicher auf der Analyse von Instrumenten, die bei der strategischen Planung der Standortwahl von Bedeutung sind.
Fallstudie Sonnentor Kräuterhandels GesmbH: Diese Fallstudie untersucht die Standortpolitik von Sonnentor. Sie analysiert die konkreten Entscheidungen des Unternehmens, die verwendeten Instrumente und die Auswirkungen der gewählten Standorte auf den Geschäftserfolg. Der Fall wird detailliert untersucht, um die Theorie der vorherigen Kapitel anhand eines praxisnahen Beispiels zu veranschaulichen. Die Analyse wird die strategischen Überlegungen hinter der Standortwahl und deren Erfolgsfaktoren beleuchten.
Schlüsselwörter
Standortpolitik, Einzelhandel, Standortfaktoren, Standortwahl, Fallstudie, Sonnentor, Unternehmenserfolg, Standortmanagement, Absatzpotential, Investitionsentscheidung.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Standortpolitik im Einzelhandel am Beispiel von Sonnentor
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert die Grundlagen der Standortpolitik im Einzelhandel anhand einer Fallstudie über die Sonnentor Kräuterhandels GesmbH. Sie untersucht die Bedeutung der Standortwahl für den Unternehmenserfolg und analysiert verschiedene Standortfaktoren und -instrumente.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: die Bedeutung des Standorts für den Einzelhandelserfolg, die Analyse relevanter Standortfaktoren, Instrumente der Standortwahl und deren Anwendung, die Standortentscheidungen von Sonnentor und deren Auswirkungen, sowie den Zusammenhang zwischen Standortpolitik und Unternehmenszielen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Grundlagen (Definitionen von Standort, Standortpolitik und Einzelhandel, Ziele der Standortpolitik), Standortfaktoren (inkl. Standortmanagement und Instrumente der Standortwahl), Fallstudie Sonnentor Kräuterhandels GesmbH und Fazit.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung betont die immense Bedeutung des Einzelhandels und der Standortwahl für den Erfolg stationärer Einzelhandelsunternehmen. Sie führt in die Thematik ein und kündigt die Analyse der Grundlagen der Standortpolitik und die Fallstudie an. Die enge Verknüpfung von Produktionsfaktoren, Absatzpotential und der Notwendigkeit einer fundierten Standortentscheidung wird hervorgehoben.
Worauf konzentriert sich das Kapitel "Grundlagen"?
Dieses Kapitel definiert die Kernbegriffe "Standort", "Standortpolitik" und "Einzelhandel". Es unterstreicht die langfristige Bedeutung von Standortentscheidungen und veranschaulicht am Beispiel von Walmart deren Bedeutung als Alleinstellungsmerkmal. Es legt den Grundstein für das Verständnis der folgenden Kapitel.
Was wird im Kapitel "Standortfaktoren" behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit den Kriterien der Standortwahl, verschiedenen Faktoren und Instrumenten, die die Entscheidungen beeinflussen und den langfristigen Erfolg sichern sollen. Der Fokus liegt auf der Analyse von Instrumenten für die strategische Planung der Standortwahl.
Wie wird die Fallstudie Sonnentor behandelt?
Die Fallstudie analysiert die Standortpolitik von Sonnentor, die konkreten Entscheidungen des Unternehmens, die verwendeten Instrumente und die Auswirkungen der gewählten Standorte auf den Geschäftserfolg. Sie veranschaulicht die Theorie anhand eines praxisnahen Beispiels und beleuchtet die strategischen Überlegungen hinter der Standortwahl und deren Erfolgsfaktoren.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Standortpolitik, Einzelhandel, Standortfaktoren, Standortwahl, Fallstudie, Sonnentor, Unternehmenserfolg, Standortmanagement, Absatzpotential, Investitionsentscheidung.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2020, Grundlagen der Standortpolitik im Einzelhandel, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/985670