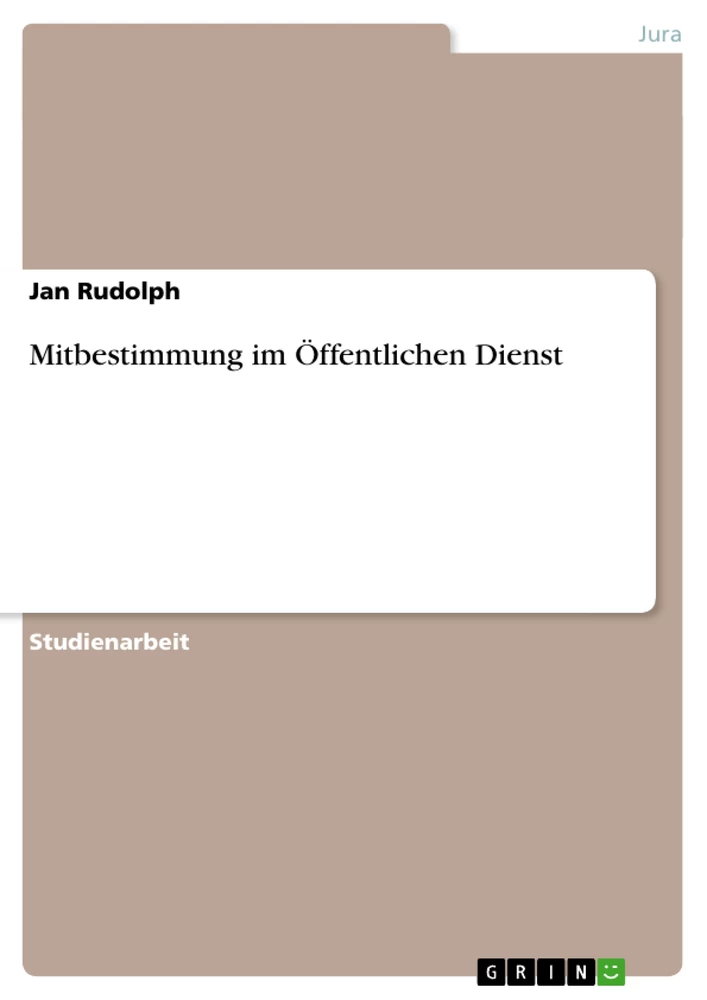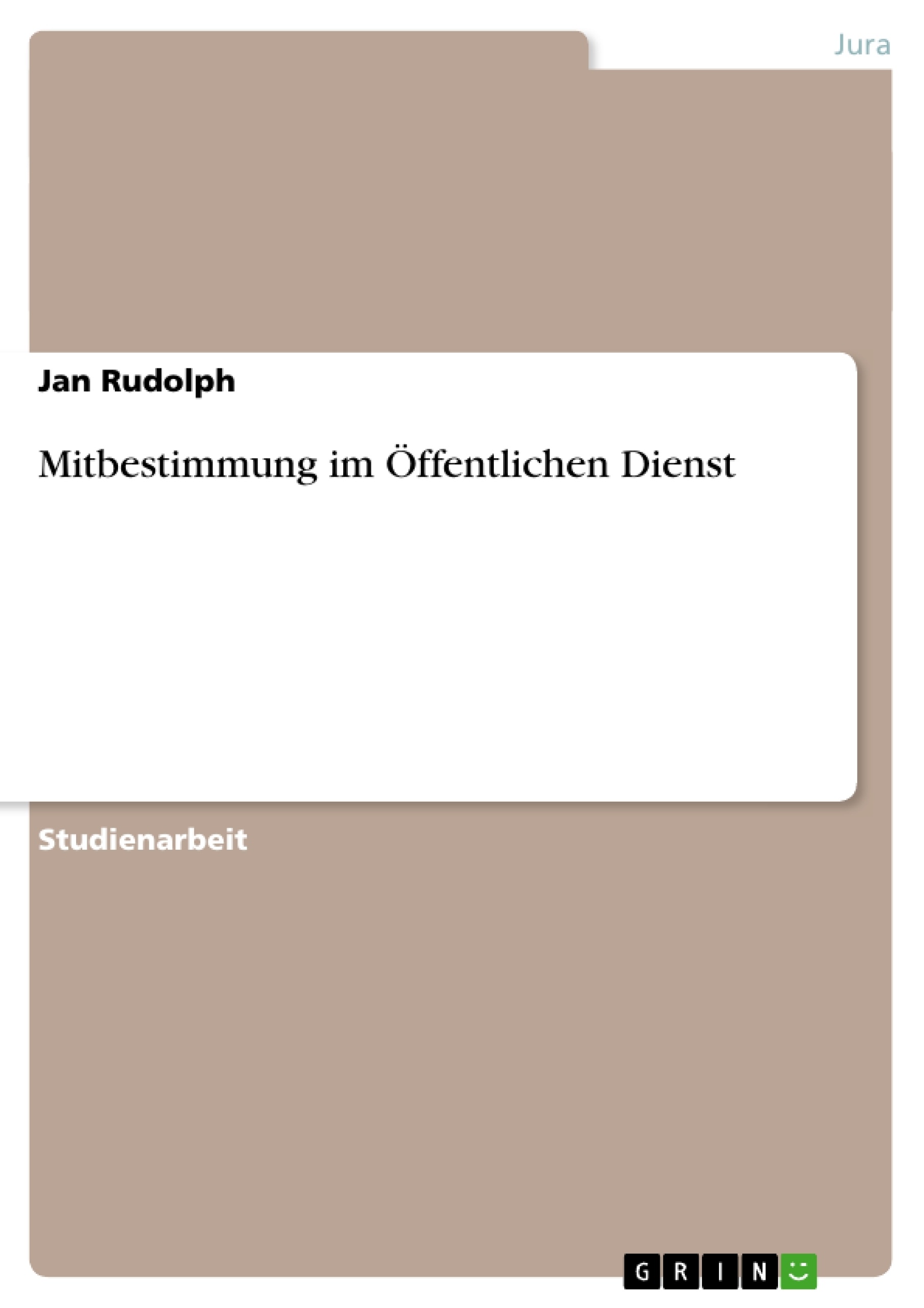Gliederung
A. Einleitung
B. Zulässigkeit und Umfang der Beteiligung der Personalvertretung
I. Verfassungsrechtliche Schranken der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst
1. Durchbrechung des Demokratieprinzips
a. Demokratische Legitimation staatlichen Handelns
aa. Ausübung von Staatsgewalt durch die Personalvertretung
bb. Erfordernis der ununterbrochenen demokratischen Legitimation
cc. Fehlende demokratische Legitimation der Personalvertretung
b. Einheit von Entscheidungsverantwortung und Entscheidungsmacht
2. Durchbrechung des Rechtsstaatsprinzips
3. Funktionsfähigkeit der Verwaltung
4. Zwischenergebnis
II. Rechtfertigung der Durchbrechung von Demokratieprinzip und Rechtsstaatsprinzip
1. Grundrechte als Rechtfertigung
a. Art. 3 I GG i.V.m. den Regelungen des BetrVG
aa. Allgemein
bb. Sonderbereich der Privatisierungsbeamten
b. Kollektive Wahrnehmung von Grundrechten
2. Personalvertretung als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums gem. Art. 33 V GG i.V.m. Art. 130 III WRV
3. „Demokratisierung der Verwaltung“
4. Rechtsstaatliche Kontrolle der Verwaltung
5. Sozialstaatsprinzip
III. Anwendung der Grenzen auf einige bestehende und mögliche Beteiligungsrechte
1. Allzuständigkeit der Personalvertretungen durch Generalklauseln
2. Beteiligung an Personalentscheidungen
a. Problemstellung
b. Ausweitung auf Angestellte und Arbeiter
c. Umfang möglicher verbleibender Beteiligungsrechte
3. Beteiligung an Organisationsangelegenheiten - insbesondere Lage und Dauer der täglichen Arbeitszeit
4. Beteiligung der Gewerkschaften
5. Initiativrechte der Personalvertretung
C. Strenge Durchhaltung des Gruppenprinzips
D. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
A. Einleitung
Das Recht der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst[1] in der Bundesrepublik ist nicht einheitlich durch Bundesgesetz geregelt sondern zum einen auf Bundesebene durch das Bundespersonalvertretungsgesetz (BPersVG) und durch die auf Landesebene geltenden Landespersonalvertretungsgesetze (LPVG) bzw. in Schleswig Holstein durch das sogenannte Mitbestimmungsgesetz (MBG), wobei sich für letztere im BPersVG einige Rahmenregelungen finden.
Während nach einer relativ frühen Entscheidung zum bremischen LPVG durch das BVerfG[2] zunächst Ruhe in diesem Bereich eingekehrt war, wird, ausgelöst durch Entscheidungen einiger Landesverfassungsgerichte[3] sowie des BVerfG[4], das Thema wieder häufiger in der Literatur behandelt.[5] Dabei geht es im Wesentlichen um die Frage der Grenzen des Personalvertretungsrechts und damit verbunden auch seiner Rechtfertigung[6]. Des weiteren stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit des im Personalvertretungsrechts sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene durch § 99 BPersVG vorgeschriebenen strengen Gruppenprinzips.[7] Auf eine detaillierte Darstellung einzelner Regelungen des Personalvertretungsrechts des Bundes und der Länder muß im Rahmen dieser Arbeit aus Platzgründen jedoch weitgehend verzichtet werden.[8]
B. Zulässigkeit und Umfang der Beteiligung der Personalvertretung
I. Verfassungsrechtliche Schranken der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst
Schon in der Entscheidung des BVerfG zum bremischen LPVG wurden tlw. verfassungsrechtliche Grenzen der Beteiligung der Personalvertretungen aufgezeigt. Bedenken gegen die Zulässigkeit einer Beteiligung ergeben sich zum einen in Bezug auf das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip und damit zusammenhängend das Prinzip der Funktionsfähigkeit der staatlichen Organe.
1. Durchbrechung des Demokratieprinzips
Bedenken ergeben sich im Rahmen des Demokratieprinzips insoweit, als sich die Personalvertretung als eine Vertretung von demokratisch nicht direkt durch das Volk legitimierten Interessen bei der Ausübung von Staatsgewalt entsprechend Art. 20 II GG darstellen könnte. Auch wird ein Konflikt zwischen Personalvertretung und dem aus dem Demokratieprinzip hergeleiteten Erfordernis der Einheit von Entscheidungsmacht und Entscheidungsverantwortung zu prüfen sein.
a. Demokratische Legitimation staatlichen Handelns
aa. Ausübung von Staatsgewalt durch die Personalvertretung
Um einen Konflikt mit dem Demokratieprinzip aus Art. 20 II GG zu begründen, muß zunächst festgestellt werden, ob es sich bei der Tätigkeit der Personalvertretung im Rahmen der Personalvertretungsgesetze um die Ausübung von Staatsgewalt handelt. Das bedeutet, die Personalvertretung müßte hoheitliche Entscheidungen treffen, die dem Staat vorenthalten sind.
Während das BVerfG in seiner Entscheidung zum schleswig-holsteinischen Mitbestimmungsgesetz[9] dies vorauszusetzen scheint, wird dies gelegentlich mit der Begründung abgelehnt, daß es sich bei der Beteiligung der Personalvertretung nur um eine Art kollektive Grundrechtsausübung handele, die nur als Reflex eine Auswirkung auf staatliches Handeln habe.[10] Es handele sich vielmehr um eine Beeinflussung der Entscheidungen aber nicht um eine Mitwirkung oder gar eigenständige Entscheidung. Bei der Personalvertretung handele es sich ausschließlich um Angelegenheiten des Innenverhältnisses.[11]
Dieser Ansicht ist jedoch entgegenzusetzen, daß zum einen eine Differenzierung zwischen rein innenrechtlich wirkenden und auch nach außen Wirkung entfaltenden Formen der Beteiligung nicht immer ohne weiteres möglich sein dürfte.[12] Oftmals wird es zu einer Außenwirkung kommen. Auch ist der Personalrat nicht als kollektiver Träger der Grundrechte der einzelnen Bediensteten berufen, so daß das Argument der Grundrechtswahrnehmung nicht zu überzeugen vermag.[13]
Auch wenn die Letztentscheidung dem Dienstherren vorenthalten sein sollte, so schließt dies nicht staatliches Handeln durch die Personalvertretung aus[14], da die Möglichkeit der Einflußnahme durch eine mögliche Blockade der Entscheidungen schon eine Ausübung von Staatsgewalt darstellen kann.[15] Auch die Beeinflussung der Entscheidung stellt demnach eine Ausübung von Staatsgewalt dar, da sowohl Personalrat als auch die paritätisch besetzte Einigungsstelle einen starken Einfluß auf die Endentscheidung haben.[16] [17]
Die Beteiligung der Personalvertretung stellt somit immer eine Form der Ausübung von Staatsgewalt dar.
bb. Erfordernis der ununterbrochenen demokratischen Legitimation
Ausgehend von dem Grundsatz, daß es sich um die Ausübung von Staatsgewalt handelt, ist gem. Art. 20 II 2 GG zu fordern, daß diese vom Volk ausgeht, d. h. durch dieses legitimiert wird. Dies ist bei, wie hier, mangels direkter Volkswahlen nur mittelbar möglicher Legitimation, durch eine ununterbrochene demokratische Legitimationskette zu fordern.[18]
cc. Fehlende demokratische Legitimation der Personalvertretung
Da die Personalvertretungen nicht direkt vom Volk gewählt sind und auch nicht von den demokratisch legitimierten Amtsinhabern in das Amt ernannt werden, wird zunächst oft davon ausgegangen, daß es dem Personalrat an der demokratischen Legitimation durch das Volk fehlt.[19]
Dem wird man nicht entgegen halten können, daß die Legitimation sich aus der Wahl durch die wiederum demokratisch legitimierten Bediensteten herleitet.[20] Deren Legitimation erschöpft sich lediglich in der dienstrechtlichen Zuweisung eines Sachgebietes und beinhaltet nicht eine darüber hinausgehende Beteiligung an der Ausübung von Staatsgewalt.[21] Vielmehr wird von der Zielsetzung der Personalvertretung als Interessenvertretung der Bedien- steten[22] davon auszugehen sein, daß bei der Wahl des Personalrats die Bediensteten in Ihrer Funktion als Private tätig werden und nicht in ihrer Amtsfunktion.[23] Eine Fortführung der Legitimationskette ist darin nicht zu sehen.
Ein beachtlicher, wenn auch bedenklicher Ansatz, ist es, eine Legitimation durch die freiwillige Aufgabe der Entscheidungsbefugnis durch das demokratisch legitimierte Parlament als begründet anzusehen, welches die entsprechenden Personalvertretungsgesetze erläßt[24] oder anzunehmen, daß es dem Gesetzgeber überlassen sei, wie er das Demokratieprinzip ausgestalte, welches überdies nicht genau in der Verfassung umschrieben sei.[25] Dieser Konstruktion ist entgegenzusetzen, daß es damit dem Gesetzgeber ohne weitere Überprüfbarkeit überlassen wäre, auf einfachgesetzlicher Ebene das Erfordernis der demokratischen Legitimation zu umgehen, was insbesondere unter dem Gesichtspunkt sogenannten „Ewigkeits- garantie“des Art. 79 III GG nicht möglich ist.[26]
Auch die Einigungsstellen sind in diesem Sinn nicht als ausreichend legitimiert anzusehen. Sie sind paritätisch besetzt und daher nicht zumindest mehrheitlich demokratisch legitimiert sind. Dies wäre jedoch als Minimum zu fordern.[27]
Zusammenfassend wird man also feststellen können, daß trotz der versuchten Begründung einer demokratischen Legitimation eine solche für die Personalvertretung nicht vorliegt, sich diese mithin im direkten Konflikt zum Demokratieprinzip befindet.
b. Einheit von Entscheidungsverantwortung und Entscheidungsmacht
Ein weiteres Problem im Zusammenhang mit dem Demokratieprinzip ist der tlw. in der Literatur vorgebrachte Verstoß gegen das Prinzip der die Einheit von Verantwortung und Entscheidungsmacht, indem dem parlamentarisch Verantwortlichen die Entscheidungsmacht entzogen werde, wenn diese zumindest zum Teil auf den Personalrat übertragen werde.[28] Ob dieses Problem jedoch in der Tat in dem Umfang besteht, mag bezweifelt werden, da dieses Prinzip lediglich zur Folge haben müßte, daß der jeweils parlamentarisch zuständige Minister in weniger starken Umfang dem Parlament gegenüber verantwortlich sein könnte.[29] Die Verantwortung würde dann vom Personalrat zu tragen sein, was allerdings auf Grund dessen soeben festgestellter mangelnder Legitimation und der damit einhergehenden fehlenden Verantwortung gegenüber dem Parlament zu einer Schaffung eines sogenannten ministerial- freien Raumes führte.[30]
2. Durchbrechung des Rechtsstaatsprinzips
Ein wichtiger Grundsatz des Rechtsstaatsprinzips aus Art. 20 III GG ist es, daß die Verwaltung dazu verpflichtet ist, neutrale Entscheidungen zu treffen, die mit dem geltenden Recht übereinstimmen.[31] Eine zur Sicherung dieses Grundsatzes bei der Ausübung der Beteiligungsrechte angeführte Bindung des Personalrates an Recht und Gesetz[32] wird jedoch auf Grund der Konzeption des Personalvertretungsrechts als Mittel der Interessenvertretung der Bediensteten nicht ausreichen, um eine solche neutrale Entscheidung zu garantieren.[33] Von der Grundkonzeption ist der Personalrat gerade nicht gehalten, neutrale Entscheidungen zu treffen, sondern interessenorientiert zu entscheiden. Die Personalvertretung stellt somit auch eine Durchbrechung des Rechtsstaatsprinzips dar.
3. Funktionsfähigkeit der Verwaltung
Eng mit dem Rechtsstaatsprinzip verbunden ist das aus der Verfassung herzuleitende Prinzip der Funktionsfähigkeit der Verwaltung, aus dem sich ergibt, daß die Personalratsbeteiligung dort auf Grenzen stößt, wo die Personalvertretung die Möglichkeit hat, die Funktionsfähigkeit der Verwaltung zum Erliegen zu bringen, wovor gelegentlich in der Literatur gewarnt wird.[34] Dieses Argument ist allerdings an Gewicht nicht zu überschätzen, da eben eine solche Verzögerung im Einzelfall oftmals ebenso schwer nachzuweisen sein wird, wie die tlw. angeführte Effektuierung der Verwaltung durch Mitbestimmung.[35] Einen generellen Verstoß gegen das Prinzip der Funktionsfähigkeit der Verwaltung wird sich demnach nicht annehmen lassen, wenn dadurch jedoch nicht ausgeschlossen sein kann, daß im Einzelfall es zu bedenklichen Verzögerungen kommen kann und eine erhebliche Straffung des tlw. sehr aufwendigen Verfahrens anzuraten wäre.
4. Zwischenergebnis
Es läßt sich somit zunächst festhalten, daß die Personalvertretung eine Durchbrechung des Demokratie- und des Rechtsstaatsprinzips darstellt und unter Umständen auch in Konflikt mit dem verfassungsrechtlichen Gebot der Funktionsfähigkeit der Verwaltung kommen kann.
II. Rechtfertigung der Durchbrechung von Demokratieprinzip und Rechtsstaatsprinzip
Mit der festgestellten Durchbrechung des Demokratie- und des Rechtsstaatsprinzips stellt sich die Frage, ob dieses nicht unter Umständen durch anderweitig geltendes Verfassungsrecht gerechtfertigt sein könnte.
1. Grundrechte als Rechtfertigung
a. Art. 3 I GG i.V.m. den Regelungen des BetrVG
aa. Allgemein
Teilweise wird ein Vergleich zwischen Bediensteten im öffentlichen Dienst und den Arbeitnehmern in der freien Wirtschaft vorgenommen und befürwortet, daß auf Grund der Regelungen im BetrVG aus Gleichheitsgründen gem. Art. 3 I GG eine Pflicht zur umfangreichen Schaffung von Beteiligungsrechten der Personalvertretung bestehe.[36] So wurde und wird teilweise auch heute noch vertreten, daß die Personalvertretung der Bediensteten eher dem Arbeitsrecht zuzuordnen sei und somit gar der konkurrierenden Gesetzgebung gem. Art. 74 Nr. 12 GG unterfalle.[37]
Dem wird jedoch nicht zuzustimmen sein. Ein Vergleich der Arbeitnehmer in der freien Wirtschaft mit den Bediensteten im öffentlichen Dienst scheidet nämlich zum einen schon aus den verschiedenen rechtlichen Grundlagen der jeweiligen Arbeits- bzw. Dienstverhältnisse aus.[38] Das Grundgesetz geht von seiner Konzeption her insbesondere bei den Beamten davon aus, daß deren Dienstrecht nicht dem Arbeits- und somit dem Zivilrecht zuzuordnen ist, sondern dem öffentlichen Recht, was sich auch in den unterschiedlichen Gesetzgebungskompetenzen gem. Art. 73 Nr. 8, 75 Nr. 1 GG im Vergleich zum Betriebsverfassungsrecht ergibt.[39]
Zum anderen ist die wirtschaftliche Situation im öffentlichen Dienst eine andere, da es hier nicht den „klassischen“ Gegensatz von Arbeitskraft und Produktionsmitteln gibt und die Gefahr eines Verlustes des Arbeitsplatzes durch wirtschaftliche Veränderung nicht besteht.[40] Des weiteren verbietet sich der Vergleich auch schon durch die oft bestehende Betroffenheit der Allgemeinheit durch eine Außenwirkung der Entscheidungen, die von der Personalvertretung zumindest mit getroffen werden.[41]
Auf Grund der Tatsache, daß von der grundgesetzlichen Konzeption her Angestellte und Arbeiter gem. Art. 33 IV GG als Ausnahme für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben heranzuziehen waren, wird daher auch vertreten, daß deren Beteiligungsrechte ebenfalls dem öffentlichen Dienstrecht unterfallen, zumal eine Trennung auch zu strukturellen Problemen führen könnte.[42] Eine andere Ansicht, die eine Angleichung des Personalvertretungsrechts an das Betriebsverfassungsrecht mit der Begründung fordert, die Angleichung der Beamten an die Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst und die schleichende Privatisierung staatlicher Aufgaben rechtfertige dies[43], verkennt, daß es sich dabei um eine verfassungsrechtlich äußerst fragwürdige Praxis handelt.[44] Diese Forderung dürfte insofern nicht mit dem tlw. vorliegendem Verfassungsverstoß zu rechtfertigen sein. Abgesehen davon handelt es sich bei dem derzeitigen Vorgehen eher um eine Annäherung der Rechtsverhältnisse der Angestellten im öffentlichen Dienst an die Rechtsverhältnisse der Beamten.
Zusammenfassend ist daher festzustellen, daß auch nach heutiger Sicht das Mitbestimmungsrecht dem öffentlichem Dienstrecht zuzuordnen ist. Vor diesem Hintergrund ist das BPersVG als umfassende Regelung auf Bundesebene und Rahmengesetzgebung für Regelungen in den Ländern gem. den Art. 73 Nr. 8, 75 Nr. 1 GG zu sehen.
Ein Vergleich mit dem BetrVG scheidet insofern aus, sodaß daraus keine Pflichten des Gesetzgebers zur Schaffung umfangreicher Beteiligungsrechte der Personalvertretung besteht.
bb. Sonderbereich der Privatisierungsbeamten
Eine besondere Problematik tritt indes im Bereich der sogenannten Privatisierungsbeamten auf. Dabei handelt es sich um die Beamten, denen aus statusrechtlichen Gründen nicht die Eigenschaft als Beamter im Zuge der Privatisierung staatlicher Stellen aberkannt werden kann.[45] Besonders bei den Beamten der ehemaligen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost aber auch im Zuge anderer tlw. auf Landesebene erfolgten Privatisierungen[46] stellt sich die Frage nach der Ausgestaltung der Beteiligungsrechte dieser Bediensteten in den Nachfolgeunternehmen. Dies ist insbesondere daher problematisch als die Unterscheidung zwischen Beteiligung nach den Personalvertretungsgesetzen und BetrVG/SprAuG rein formal an Hand der Organisation der jeweiligen Stelle, an der der Bedienstete oder Arbeitnehmer tätig ist, vorgenommen wird.[47]
Im Rahmen der Privatisierung von Bundespost und Bundesbahn ist dieses Problem weitgehend gelöst, indem in den §§ 28, 29 Postpersonalrechtsgesetz und in den §§ 17, 19 Deutsche-Bahn-Gründungsgesetz eine entsprechende Regelung getroffen wurde, die zum Teil das BetrVG zur Anwendung kommen läßt, es in Personalangelegenheiten aber bei der weiteren Anwendung des BPersVG beläßt.[48] Begründbar ist dies insbesondere in Bezug auf die Beamten mit der Modifikation des Beamtenstatus und dem teilweise damit einhergehenden Entfall der Grundrechtsbeschränkungen.[49] Eine naheliegende analoge Anwendung dieser Vorschriften, um einen Wegfall der Mitbestimmungsrechte der Privatisierungsbeamten insbesondere durch § 13 II 4 BPersVG zu verhindern,[50] wird jedoch vom BAG abgelehnt.[51]
b. Kollektive Wahrnehmung von Grundrechten
Einschränkungen des Demokratieprinzips und des Rechtsstaatsprinzips können auch nicht damit gerechtfertigt werden, daß diese nur die kollektive Ausübung der Grundrechte der Bediensteten darstelle[52], weil eben der Personalrat als nicht als Träger kollektiver Grundrechte auftritt, sondern lediglich der Effektuierung dieser Grundrechte dienen kann.[53] Der Personalrat ist zur Wahrnehmung der kollektiven Interessen der Bediensteten berufen[54] und nicht zur kollektiven Wahrnehmung der einzelner Grundrechte. Eine Pflicht zur Errichtung von Personalräten als Rechtfertigung der Durchbrechung von Demokratieprinzip und Rechtsstaatsprinzip kann daraus nicht hergeleitet werden.
2. Personalvertretung als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums gem. Art. 33 V GG i.V.m. Art. 130 III WRV
Zum Teil wird in der Literatur vertreten, daß zur Schaffung der Personalvertretung für Beamte gem. Art. 33 V GG i.V.m. Art. 130 III WRV eine Pflicht bestehe.[55]
Es ist jedoch fraglich, ob in der Bestimmung des Art. 130 III WRV, der eine Einrichtung einer gesonderten Vertretung der Beamten vorsah, ein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums zu sehen ist. Ein solcher kann nur dann angenommen werden, wenn es sich um eine prägende Ausgestaltung des Beamtentums handelte, die zumindest unter der Weimarer Reichsverfassung Geltung beansprucht hat.[56] In diesem Zusammenhang wird jedoch zu beachten sein, daß es zu einer gesetzlichen Regelung der Beamtenvertretung nie zum Zeitpunkt der Geltung der Weimarer Reichsverfassung gekommen ist, sondern nur - tlw. vorübergehende - Beamtenausschüsse auf dem Verordnungswege gegründet worden sind.[57] Ob dieses nun ausreicht, um eine das Beamtentum prägende Ausgestaltung anzunehmen und eine Geltung eines solchen Prinzips als hergebrachten Grundsatz des Berufsbeamtentums anzunehmen[58], erscheint sehr fragwürdig, weil somit nahezu alle geltenden Regelungen des Beamtenrechts als hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums anzusehen wären, was nicht die Intention des Verfassungsgebers war.[59]
Im Rahmen der Rechtfertigung einer Durchbrechung des Demokratieprinzips und des Rechtsstaatsprinzips kann jedoch letztlich dahingestellt bleiben, ob ein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums besteht, weil dieser - durch andere Grundsätze, wie z.B. die Treue- und Gehorsamspflicht oder die Neutralitätspflicht eingeschränkt[60] - nur sehr geringen Umfanges sein kann.[61] In der Regel wird man daraus daher keine Rechtfertigung für anderweitige Verfassungsdurchbrechungen herleiten können.[62]
3. „Demokratisierung der Verwaltung“
Ein anderer Ansatz der Rechtfertigung der Mitbestimmung findet sich in dem Schlagwort der „Demokratisierung der Verwaltung“. Die darin zum Ausdruck kommende Ansicht geht davon aus, daß das Demokratieprinzip es gerade fordere, daß die Bediensteten ein Mitbestimmungsrecht haben, um demokratisch Entscheidungen beeinflussen zu können.[63]
Dieser Ansatz kann jedoch schon allein auf Grund des oben festgestellten Verstoßes gegen das Demokratieprinzip durch mangelnde Legitimation der Vertretung einzelner Interessen nicht überzeugen.[64] Vielmehr dürfte sich das Schlagwort der „Demokratisierung der Verwaltung“ als ein eher soziologischer oder politikwissenschaftlicher Begriff darstellen, der jedoch nicht für eine verfassungsrechtlich haltbare Rechtfertigung einer Durchbrechung tragender Staatsprinzipien herhalten kann.
4. Rechtsstaatliche Kontrolle der Verwaltung
Das tlw. eng mit dem eben genannten Argument verbundene und im gleichen Zusammenhang genannte Argument der rechtsstaatlichen Kontrolle des Verwaltungshandelns durch den Personalrat[65] vermag ebenfalls nicht als eine Rechtfertigung für die Durchbrechung der genannten Staatsprinzipien herzuhalten. Dies ist eben aus dem Grunde nicht anzunehmen, daß der Personalrat primär nicht zu dieser Aufgabe berufen ist, sondern der Vertretung der Individualinteressen der Bediensteten dienen soll.[66] Wie oben schon dargestellt stellt sich die
Personalvertretung eher als ein Gebiet dar, welches in einem starken Spannungsverhältnis zum Rechtsstaatsprinzip steht.[67]
5. Sozialstaatsprinzip
Letztlich verbleibt es zu prüfen, ob sich die Personalvertretung unter Umständen mit dem Sozialstaatsprinzip rechtfertigen ließe.
Das Sozialstaatsprinzip aus Art. 20 I, 28 I GG beinhaltet die Verpflichtung des Gesetzgebers zur Schaffung einer gerechten Sozialordnung[68], der auch in einem gewissen Umfang den Schutz der Bediensteten umfaßt.[69] Daraus wird teilweise gefolgert, daß der Gesetzgeber die Pflicht zur Schaffung einer Personalvertretung habe[70], zumindest jedoch nicht an der Schaffung einer solchen auf Grund seines breiten Gestaltungsspielraumes gehindert sei.[71] Allerdings wird man jedoch auf Grund der Tatsache, daß die das Sozialstaatsprinzip sehr vage gefaßt ist, daraus nur beschränkt eine Rechtfertigung für die Durchbrechung anderen Verfassungsrechts herleiten können.[72]
Um jedoch dem Sozialstaatsprinzip einen möglichst weiten Geltungsbereich zu verschaffen, bietet es sich an, im Wege eines gerechten Ausgleichs zwischen Demokratieprinzip und Rechtsstaatlichkeit einerseits und der Verwirklichung einer Sozialstaatlichkeit andererseits, die Mitbestimmung in gewissem Maß zuzulassen. Dabei wird jedoch darauf zu achten sein, daß zum einen ein Vorrang des Sozialstaatsprinzips nur dann in Frage kommen kann, wenn die Beteiligungsmaßnahme im konkreten Fall der Wahrung der dienstlichen Interessen der Bediensteten dienen soll (personalvertretungsrelevante Maßnahmen) und eine Verhältnismäßigkeit zwischen Zweck der Mitbestimmung und dem jeweils vorliegendem Eingriff gegeben ist.[73]
Auf Grund der relativen Schwäche des Sozialstaatsprinzips wird man dann im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsprüfung davon auszugehen haben, daß insbesondere bei einem stärkeren Eingriff in das Demokratieprinzip, d.h. bei deutlich fühlbareren Folgen, insbesondere durch eine Außenwirkung, eine um so stärkere Einschränkung des Sozialstaatsgedankens zu fordern sein wird.[74] Des weiteren ist die Entscheidung der Personalvertretung dadurch zu beschränken, daß diese sich an den spezifischen Interessen der Bediensteten zu orientieren hat, was sich aus der Aufgabe des Personalrates ergibt.[75] Auch zusätzliche verfassungsrechtliche Grundsätze, z.B. weitere hergebrachte Grundsätze des Beamtentums, können in diesem Zusammenhang dazu führen, daß das Sozialstaatsprinzip hier weniger starke Durchsetzung beanspruchen kann, wenn auch hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums nicht automatisch Beteiligungsmaßnahmen ausschließen.[76]
Diesem Ansatz entspricht im Wesentlichen auch die Entscheidung des BVerfG zum schleswig-holsteinischen Mitbestimmungsgesetz, welches eine, schwerpunktmäßig auf die Verhältnismäßigkeit von Demokratieprinzip und den aus dem Sozialstaatsprinzip hergeleiteten Zielen der Personalvertretung abstellende, Unterscheidung in drei Stufen vornimmt.[77] Soweit eine konkrete Beteiligungsform nach dem hier vorgestellten Prüfungsmodell nicht zulässig sein sollte, verbleibt es dann, zu prüfen, ob nicht eine abgeschwächte Beteiligung in Frage kommt, z.B. der Mitwirkung oder Anhörung anstelle der Mitbestimmung.[78]
Daraus ergibt sich, daß das Sozialstaatsprinzip nur sehr begrenzt als Rechtfertigung für die Durchbrechung des Demokratieprinzips und des Rechtsstaatsprinzips herangezogen werden kann. Soweit eine konkrete Beteiligungsmaßnahme der Personalvertretung den eben genannten Anforderungen nicht entspricht, ist sie verfassungswidrig.
III. Anwendung der Grenzen auf einige bestehende und mögliche Beteiligungsrechte
Es bleibt mithin bei jedem einzelnen Beteiligungsrecht zu klären, ob und in welchem Umfang die Personalvertretung an einzelnen Entscheidungen beteiligt werden kann. Im Folgenden sollen daher einige in Rechtsprechung und Literatur diskutierte Regelungen der Personalvertretung genauer untersucht werden.[79]
1. Allzuständigkeit der Personalvertretungen durch Generalklauseln
Während im BPersVG und in den meisten Landesgesetzen die Entscheidungen, in denen die Personalvertretungen zu beteiligen ist, durch abschließende Kataloge geregelt sind, finden sich in einigen Landespersonalvertretungsgesetzen Generalklauseln zur Umschreibung der beteiligungspflichtigen beziehungsweise gar mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten.[80]
Das Problem dieser Regelungsmethode liegt darin, daß an Hand dieser Klauseln die Grenzen der Mitbestimmung nicht zu erkennen sind. So ist es möglich, eine nicht weiter eingeschränkte Generalklausel so auszulegen, als stünde dem Personalrat das Mandat zu, in allen dienstbezogenen Angelegenheiten mitzubestimmen.[81] Soweit damit die Mitbestimmung unabhängig von der Außenwirkung zugelassen wird, wird dies der Problematik der Durchbrechung des Demokratie- und des Rechtsstaatsprinzips nicht gerecht und ist daher unzulässig.[82] Dieser Möglichkeit der Auslegung dieser Gesetze kann jedoch durch Beispielkataloge zuvorgekommen werden, weswegen mit Ausnahme des in diesem Bereichs durch das BVerfG für verfassungswidrig erklärten schleswig-holsteinischen MBG andere Gesetze solche Kataloge vorsehen.[83] Durch die Nennung rein personalvertretungsrechtlicher Angelegenheiten in diesen Katalogen wird sichergestellt, daß eine Auslegung im Sinne eines allgemeinen Mitbestimmungsrechtes ausgeschlossen ist.[84]
Somit ist festzustellen, daß eine Festlegung der Angelegenheiten, an denen die Personalvertretung zu beteiligen ist, nur dann zulässig ist, wenn durch Beispielkataloge sichergestellt ist, daß eine Beteiligung der Personalvertretung und nur im Bereich der personalvertretungsrelevanten Maßnahmen stattzufinden hat. Daraus ergibt sich jedoch nicht die generelle verfassungsrechtliche Zulässigkeit der jeweilig durch die Gesetze zugelassen Beteiligungstatbestände. Diese sind dann immer noch im Einzelfall zu prüfen.
2. Beteiligung an Personalentscheidungen
Ein stark diskutiertes Problem der Personalvertretung ist die Beteiligung des Personalrates an Personalentscheidungen. Alle Personalvertretungsgesetze sehen eine mehr oder minder starke Mitbestimmung mit einer Beteiligung der Einigungsstelle in Personalangelegenheiten vor.
a. Problemstellung
Zwar handelt es sich bei Personalmaßnahmen um eine personalvertretungsrechtliche Maßnahme, bei der in weiten Bereichen eine gewisse Beteiligung der Personalvertretung erforderlich scheinen mag, um eine ausreichende Interessenwahrung in personalvertretungsrechtlichen Angelegenheiten zu erreichen.
Die Besetzung von Stellen und ähnliche Personalmaßnahmen haben jedoch starke Außenwirkung, indem durch die Besetzung der Amtsposten auch auf die Ausführung der Amtsgeschäfte nach Außen Einfluß genommen wird.[85] Des weiteren besteht bei Einstellungen den Bewerbern gegenüber eine Außenwirkung, da der Personalrat zur Wahrnehmung der Interessen der Bediensteten und nicht der Bewerber berufen ist und sich die Entscheidung auch insofern auf die Rechte des akzeptierten aber auch der abgelehnten Bewerber auswirkt. Der Schwerpunkt der Entscheidung liegt somit auf der Amtsführung, sodaß ein echtes Mitbestimmungsrecht hier einen unverhältnismäßig starken Eingriff in das Demokratieprinzip darstellt und abzulehnen ist.
Dieses Ergebnis wird für Personalentscheidungen bei Beamten dadurch bestärkt, daß ein hergebrachter Grundsatz anzunehmen ist, der Letztentscheidungen in Personalangelegenheiten beim Dienstherren beläßt.[86] Eine Mitwirkung der Einigungsstelle, bei der ihr eine Letztentscheidung zusteht, ist somit abzulehnen.
b. Ausweitung auf Angestellte und Arbeiter
Das BVerfG hat in seiner ersten Entscheidung nur bezogen auf die Beamten entschieden, daß eine echte Mitbestimmung der Personalvertretung unzulässig sei.[87] Dem entspricht auch die Regelung der Mitbestimmung in Personalentscheidungen auf Bundesebene und die Rahmenbestimmung des § 104 Satz 3 BPersVG, die eine solche Ausnahme auch auf Landesebene vorschreibt. Als Begründung wurde angeführt, daß durch den Funktionsvorbehalt in Art. 33 IV GG eine Mitentscheidung bei Angestellten und Arbeitern durch den Personalrat wesentlich seltener vorkommen werde, weswegen bei diesen eine Durchbrechung des Demokratieprinzips eher gerechtfertigt sein dürfte.[88]
Diese Ansicht dürfte aber angesichts der Tendenz, verstärkt insbesondere Angestellte bei der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben einzusetzen, überholt sein. Auch Angestellte des öffentlichen Dienstes werden auf Bereichen tätig, bei denen eine Außenwirkung besteht.[89] Aus diesem Grunde ist anzunehmen, daß die Durchbrechung des Demokratie- und des Rechtsstaatsprinzips auch in diesem Bereich nicht mehr zu rechtfertigen sein dürfte, weswegen auch hier eine Mitbestimmung mit Letztentscheidungsbefugnis abzulehnen ist.[90] Daraus resultiert, daß die Bestimmungen der Personalvertretungsgesetze, bei denen die Einigungsstelle in Personalangelegenheiten Letztentscheidungsrecht hat, verfassungswidrig sind.
c. Umfang möglicher verbleibender Beteiligungsrechte
Nachdem festgestellt ist, daß eine echte Mitbestimmung bei Personalentscheidungen abzulehnen ist, ist zu klären, ob in anderer Weise der Personalrat an der Entscheidung beteiligt werden kann.[91] In Betracht kommen insbesondere eine eingeschränkte Mitbestimmung, d.h. die Beschränkung der Entscheidungsmacht der Einigungsstelle auf eine Empfehlung, oder aber die bloße Mitwirkung oder einfache Anhörung.
Ein gänzlicher Ausschluß wäre insofern wohl nicht zu vertreten, da der Personalvertretung damit sämtliche Beteiligungsmöglichkeiten bei einer Angelegenheit genommen wären, die eine personalrechtliche Relevanz aufweist.
Bei der Einstellung eines Beamten oder Arbeitnehmer bestehen bezogen auf die Rechtsschutzmöglichkeiten, abgesehen von der Konkurrentenklage und bei Arbeitnehmern der zivilrechtlichen Anspruchsgrundlagen, geringere Möglichkeiten der Interessenwahrung als in den eher formalisierten Verfahren der Beendigung des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses.[92] Es ließe sich somit annehmen, daß bei der Begründung des Dienst-/Arbeitsverhältnisses ein größeres Bedürfnis an der Beteiligung der Personalvertretung besteht, als bei deren Beendigung. Bei der Kündigung oder Entlassung aus dem Dienstverhältnis wird man daher im Hinblick auf die Erforderlichkeit der Beteiligung eine stärker abgeschwächte Form der Beteiligung fordern müssen, während bei den übrigen Maßnahmen indes eine stärkere Form möglich sein wird.
Es scheint somit auch denkbar und angemessen, die Personalvertretung bei einfacher Beendigung des Dienst-/Arbeitsverhältnisses zum Beispiel auf die Mitwirkung zu beschränken. Bei fristloser oder außerordentlicher Kündigung bzw. Disziplinarmaßnahmen, die zumeist vom Erfordernis einer zügigen Entscheidung geprägt sind und auch noch eine starke Außenwirkung haben, erscheint es auch gerechtfertigt, gar nur ein einfaches Anhörungsrecht vorzusehen.[93] Dies wird insofern bei den Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst durch die in § 626 II BGB festgelegte und auch im öffentlichen Dienst geltende[94], kurze Zweiwochenfrist nötig sein. Diese Frist wird durch eine Beteiligung des Personalrats nicht gehemmt und dient im Wesentlichen dem Schutz des Arbeitnehmers,[95] so daß hier kein wesentliches Defizit entsteht.
Bei anderen Personalentscheidungen ist hingegen denkbar, eine weitergehende Beteiligung durch die Beteiligung auch der Einigungsstelle mit der Möglichkeit der Abgabe einer Empfehlung vorzusehen. Dies wird auch dem Umstand gerecht, daß durch diese Maßnahmen Personalinteressen in besonderem Maße betroffen werden. Eventueller Eilbedürftigkeit, könnte man durch erweiterte Anwendung von Vorschriften über (vorläufige) Beschränkungen der Personalratsbeteiligung in Eilfällen Rechnung tragen.[96]
Nicht zulässig dürfte jedoch die Lösung sein, bei der die Einigungsstelle zunächst eine verbindliche Entscheidung trifft, die dann erst von der obersten Dienstbehörde unter Wahrung bestimmter Fristen zurückgenommen werden kann.[97] Bei diesen Ausformungen der Beteiligung kommt es zu einer nicht mehr zu vertretenden Stärkung der Entscheidung der Personalvertretung in einem Bereich, in dem eine starke Beteiligung aus Gründen des Schutzes des Demokratie- und des Rechtsstaatsprinzips nicht zulässig ist.[98] Somit ist es auch unzulässig, in diesen Fällen einen Letztentscheid durch die Einigungsstelle vorzusehen, der durch die oberste Dienstbehörde aufgehoben werden könnte.
3. Beteiligung an Organisationsangelegenheiten - insbesondere Lage und Dauer der täglichen Arbeitszeit
Bei organisatorischen Maßnahmen kann auf Grund der starken Außenrelevanz der Entscheidungen eine echte Mitbestimmung nicht in Frage kommen. Problematisch dürfte es daher sein, z.B. die Einführung der Datenverarbeitung, die auch einen sozialen Bezug hat, der Mitbestimmung zu unterstellen.[99]
Vergleichbare Probleme stellen sich jedoch auch bei anderen, anerkannten sozialen Angelegenheiten, wie zum Beispiel der in § 75 III Nr. 1 BPersVG genannten echten Mitbestimmung bei der Frage der Lage und Dauer[100] der täglichen Arbeitszeit. Bei Behörden, die dem Publikumsverkehr zugänglich oder die auf Telefonsprechzeiten angewiesen sind, kann auch diese Maßnahme eine wesentliche Außenwirkung aufweisen.[101]
Dies wird auch teilweise erkannt, weswegen eine Mitbestimmung in Bezug auf die Öffnungszeiten - unter Bezugnahme auf die Rechtsprechung des BAG - hier abgelehnt wird.[102] Ob dies jedoch auch für das Personalvertretungsrecht zwingend ist, mag bezweifelt werden. Fraglich ist schon, ob die Verwaltungsgerichtsbarkeit dem BAG hier folgen würde. Zwingend wäre es nicht einmal nach dem Gesetz zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung der obersten Gerichtshöfe des Bundes den gemeinsamen Senat anzurufen, weil eben dieses Gesetz sich nur auf Differenzen in der Auffassung bezüglich einer Rechtsfrage aus einer Rechtsnorm bezieht. Da es sich aber bei Personalvertretungsrecht und Betriebsverfassungsrecht um rechtlich verschiedene Bereiche handelt, kann hier nicht ohne weiteres ein Rückschluß gezogen werden.
Insofern kann man auch hier eine Mitbestimmung nicht mehr für mit dem Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip für vereinbar halten. Da es aber auch Bereiche gibt, in denen Entscheidungen über den Beginn und das Ende der Arbeitszeit keine Außenwirkung haben kann, könnte man unter Umständen in verfassungskonformer Auslegung bzw. Reduktion zu dem Ergebnis kommen, daß nur solche Entscheidungen von einem Mitbestimmungsrecht umfaßt sind. Zu begrüßen wäre allerdings die Aufnahme einer Regelung in die Gesetze, nach der die Mitbestimmung von vornherein in den Fällen ausgeschlossen ist, in denen eine wesentliche Außenwirkung besteht.
4. Beteiligung der Gewerkschaften
Fraglich scheint auch die Zulässigkeit der Beteiligung von Gewerkschaften an Personalvertretungsmaßnahmen, wie sie in einigen der Landesgesetzen vorgesehen ist.[103]
Auch die Gewerkschaften sind nicht demokratisch durch das Volk legitimiert.[104] Hinzukommt jedoch auch noch eine fehlende Legitimation der Gewerkschaften durch die zum Teil nicht gewerkschaftlich organisierten Bediensteten.[105] Überdies ist zu beachten, daß eine Beteiligung der Gewerkschaften für die nicht organisierten Bediensteten einen Verstoß gegen die negative Koalitionsfreiheit begründet.[106] Daraus resultiert, daß die Gewerkschaften zu einer Interessenvertretung aller Bediensteten nicht berufen sein können, sodaß deren Beteiligung nicht in Betracht zu ziehen ist und insofern auch nicht verfassungsgemäß sein kann.
5. Initiativrechte der Personalvertretung
In einigen Gesetzen sind für die Personalvertretungen umfassende aktive Beteiligungsrechte durch Initiativrechte vorgesehen.[107] Fraglich ist, inwieweit diese verfassungsrechtlich haltbar sein können.
Gegen eine den passiven Beteiligungsrechten entsprechendes Initiativrecht ist insofern einzuwenden, daß durch diese die Durchbrechung des Demokratieprinzips wesentlich verstärkt wird, indem die Personalvertretung nunmehr aktiv Verwaltungshandeln beeinflußt.[108] Insbesondere bei Maßnahmen die eine Außenwirkung haben, ist dies als unzulässig zu betrachten, weil dem Dienstherren so eine Angelegenheit aufgezwungen werden kann, mit der er sich nicht zu befassen beabsichtigt.[109] Soweit jedoch eine Pflicht des Dienstherren mit der Befassung mit einer Angelegenheit besteht, wird dieser schon durch die Möglichkeit der einzelnen Bediensteten, eine solche im Wege des Rechtsschutzes durchzusetzen, Rechnung getragen. Dies ergibt sich insbesondere aus der Fürsorgepflicht des Dienstherren, die diesen zu entsprechenden Maßnahmen verpflichtet. Ein Bedarf für die kollektive Durchsetzung solcher Maßnahmen besteht somit nicht.[110] Wenn sich dann der Dienstherr mit der Angelegenheit befassen sollte, besteht auch gegebenenfalls wieder ein Beteiligungsrecht der Personalvertretung, sodaß ein Beteiligungsdefizit hier nicht zu erwarten sein wird.
Darüber hinaus ist hier zu beachten, daß durch umfassende Initiativrechte, die ein mehr oder minder stark ausgeprägtes Verfahren bedingen, die Behörde in ihrer Handlungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt werden könnte. Dieser Gesichtspunkt könnte hier ausnahmsweise auch unter dem Gesichtspunkt der Funktionsfähigkeit der Verwaltung Bedeutung erlangen, wenn es z.B. zu einer Blockade durch die Personalverwaltung durch übermäßigen Gebrauch von Initiativrechte käme.[111]
Insofern sind auch umfassende Initiativrechte der Personalvertretung vor dem Hintergrund der Durchbrechung des Demokratie- und des Rechtsstaatsprinzips als verfassungswidrig zu bezeichnen.
C. Strenge Durchhaltung des Gruppenprinzips
Ein eher untergeordnetes Problem im Rahmen der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst dürfte die Frage nach der Notwendigkeit des Gruppenprinzips oder der Trennung der einzelnen Gruppen (Beamte, Angestellte und Arbeiter) sein.[112]
Ein dahingehender hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums dürfte wohl mit den gleichen Argumenten, wie schon das Bestehen des Grundsatzes der Pflicht zur Schaffung einer Personalvertretung nicht aus Art. 33 V GG i.V.m. Art. 130 III WRV herzuleiten sein.[113] Wenn schon keine Verpflichtung zur Schaffung der Personalvertretung daraus herzuleiten ist, kann folgerichtig auch keine Verpflichtung zu der Schaffung einer getrennten Vertretung bestehen. Ebenso fragwürdig scheint der Rückriff auf Art. 33 IV GG, der eine Pflicht zur Durchhaltung des Gruppenprinzips damit begründet, daß es sonst zu einer Majorisierung des als Regeldienstverhältnis vorgesehenen Beamtentums durch Angestellte und Arbeiter kommen könnte.[114] Die Tatsache, daß in verfassungsrechtlich bedenklichem Maße Art. 33 IV GG umgangen wird, kann nicht als Begründung dienen. Wenn das Erfordernis des Beamten als Regeldienstverhältnis jedoch eingehalten würde, kann es denklogisch schon gar nicht zu einer Majorisierung der Beamten durch die anderen Bediensteten kommen.
Eine verfassungsrechtliche Verpflichtung zur Einhaltung des Gruppenprinzips ist daher zu verneinen.[115]
D. Zusammenfassung
Zusammenfassend läßt sich folgendes feststellen:
- Jede Form der Beteiligung der Personalvertretung stellt eine Form der Ausübung von Staatsgewalt dar.
- Die Personalvertretung ist nicht hinreichend demokratisch vom Volk legitimiert und stellt eine Durchbrechung des Demokratieprinzips dar.
- Personalvertretung ist durch die Interessenvertretung der Bediensteten eine Durchbrechung des Rechtsstaatsprinzips dergestalt, daß die durch Einzelinteressen beeinflußte Entscheidung nicht neutral ist.
- Ein Verstoß gegen den Grundsatz der Funktionsfähigkeit der Verwaltung läßt sich nicht generell durch die Personalvertretung begründen, ist aber auch im Einzelfall nicht auszuschließen.
- Die Durchbrechung des Demokratieprinzips und des Rechtsstaatsprinzips durch die Personalvertretung ist nicht durch Grundrechte oder einen hergebrachten Grundsatz des Berufsbeamtentums zu rechtfertigen. Die Personalvertretungen sind jedoch eine Möglichkeit, der aus dem Sozialstaatsprinzip herzuleitenden Verpflichtung des Staates zum Schutz der Interessen der Bediensteten nachzukommen. Wegen der Schwächen des Sozialstaatsprinzips müssen Beteiligungsrechte mit steigender Außenrelevanz von Entscheidungen eingeschränkt werden.
Eine generalklauselartig umschriebene Allzuständigkeit der Personalvertretungen insbesondere bei Mitbestimmungsrechten ist unzulässig, wenn diese nicht durch ausreichende Beispielkataloge ergänzt werden.
Die Mitbestimmung mit Letztentscheidungsbefugnis der Einigungsstelle in Personalangelegenheiten ist grundsätzlich unzulässig. Eine abgeschwächte Form ist jedoch möglich.
Soziale Angelegenheiten, die sich auf die Organisation der Behörde auswirken, sind nur einer abgeschwächten Form der Beteiligung der Personalvertretung zugänglich. Dies muß bei Umschreibung der Mitbestimmungsrechte entsprechend berücksichtigt werden, z.B. durch einen Ausnahmetatbestand. Tlw. möglich könnte auch die Beseitigung des Problems durch eine verfassungskonforme Auslegung der jeweiligen Vorschrift sein.
Die Beteiligung der Gewerkschaften ist mangels einer ausreichenden Legitimation auch von Seiten der Bediensteten und wegen eines Verstoßes gegen die negative Koalitionsfreiheit der nicht organisierten Bediensteten unzulässig.
Umfassende Initiativrechte des Personalrates sind nicht mehr durch das Sozialstaatsprinzip zu rechtfertigen und wegen Verstoßes gegen das Demokratie- und das Rechtsstaatsprinzip unzulässig.
Aus der Verfassung läßt sich keine Pflicht zur Durchhaltung eines strengen Gruppenprinzips in der Personalvertretung herleiten, insbesondere als ein Ausfluß eines hergebrachten Grundsatzes des Berufsbeamtentums.
[...]
[1] Dieser Terminus ist eigentlich ungenau, weil die weitläufig unter dem Begriff „Mitbestimmung im öffentlichen Dienst“ bezeichnete Beteiligung der Personalvertretungen zum einen Mitbestimmungsrechte im engeren Sinne beinhaltet, als auch die abgeschwächten Formen der Mitwirkung, Anhörung und Information.
[2] BVerfGE 9, 268 ff.
[3] VerfGn NRW DVBl 1984, 1196 ff.; HessStGH DVBl. 1986, 936 ff.; VerfGH RhPf ZBR 1994, 272 ff.
[4] BVerfGE 93, 37 ff.
[5] Nähere Nachweise werden im Verlaufe dieser Arbeit geführt werden.
[6] Siehe unten unter B. der Arbeit.
[7] Siehe unten unter C. der Arbeit.
[8] Zur Rechtslage in den Bundesländern s. Battis/Caspary PersV 1995, 145 ff. und zur Rechtslage in auf Bundesebene Kossens RiA 1996, 66 ff.
[9] BVerfGE 93, 37 (68).
[10] Altvater u.a. BPersVG § 104 Rn. 13 f.; Bryde in Thieme-FS, S. 16; Wendeling-Schröder ArbuR 1987, 381 (383).
[11] Plander S. 129; ders. in ArbuR 1987, 1 (5); im Ergebnis auch Ratayczak PersR 1999, 1 (3).
[12] Benecke S. 115 ff.; Rob S. 100; Schenke JZ 1991, 581 (583).
[13] Benecke a.a.O.; Rob S. 103; Ossenbühl S. 37; ders. PersV 1989, 409 (411).
[14] Bryde PersR 1994, 1 (7); Plander, S. 165.
[15] Schenke JZ 1991, 581 (585).
[16] VerfGHRhPf ZBR 1994, 272 (274); Ossenbühl PersV a.a.O.; Schenke JZ 1991, 581 (583); ders. PersV 1992, 289 (293); im Ergebnis auch Böckenförde in HbdStR I § 22 Rn. 12f.; Pfohl 1996, 82 (83).
[17] Siehe auch Lecheler NJW 1986, 1079 (1083), der auf die Praxis des Arrangements zwischen Dienstherren und Personalrat hinweist, um in weiten Bereichen eine Blockade durch den Personalrat zu vermeiden.
[18] BVerfGE 93, 37 (66); VerfGH NRW DVBl. 1986, 1196 (1197); VerfGH RhPf ZBR 1994, 272 (274); Böckenförde in HbdStR I § 22 Rn. 14; Herzog in Maunz/Dürig/Herzog/Scholz Art. 20 Rn. 53; Ossen- bühl S. 37.
[19] BVerfGE 93, 37 (66f.); Lecheler NJW 1986, 1079 (1080); ders. in HbdStR III § 72 Rn. 29; Ossenbühl, S. 40; Schenke PersV 1992, 289 (293); ähnlich Herzog in Maunz/Dürig/Herzog/ Scholz Art. 20 Rn. 60.
[20] So z.B. Bryde Thiele-FS, S. 17 f. m.w.N.
[21] Ossenbühl S. 42; Rob S. 115; Schenke PersV 1992, 289 (293).
[22] Lecheler in HbdStR III § 72 Rn. 128.
[23] Schenke PersV 1992, 289 (293).
[24] Plander ArbuR 1987, 1 (6).
[25] Plander a.a.O. (2).
[26] Rob S. 141.
[27] BVerfGE 93, 37 (66 ff.).
[28] Lecheler NJW 1986, 1079 (1083); Ossenbühl PersV 1989, 409 (415); s.a. HessStGH DVBl. 1986, 936 (938).
[29] Schenke JZ 1991, 581 (584).
[30] Schenke a.a.O.; Die damit zusammenhängende Frage der Zulässigkeit der Schaffung solcher ministerialfreier Räume kann in diesem Referat jedoch auch aus Platzgründen nicht weiter verfolgt werden.
[31] Benda HbdVerfR § 17 Rn. 26 f.; Ossenbühl PersV 1989, 409(415); Schenke PersV 1992, 289 (294). Dem entspricht auch die Verpflichtung im Falle der Beamten zur neutralen, gesetzmäßigen Beamten als hergebrachter Grundsatz gem. Art. 33 V GG; s. Isensee in HbdVerfR § 32 Rn. 65.
[32] Plander S. 237 f.
[33] S.o. Fn. 47.
[34] Lecheler HbdStR III § 72 Rn. 131; ders. NJW 1986, 1079 (1080); Ossenbühl PersV 1989, 409 (417); Schenke JZ 1991, 581 (584).
[35] Leisner S. 507.
[36] Kossens RiA 1996, 66 (68); Wendeling-Schröder ArbuR 1987, 381 (384).
[37] Ebd.
[38] Battis DÖV 1987, 1 (3); Ossenbühl PersV 1989, 409 (414); Rob S. 187.
[39] So im Ergebnis auch Lecheler HbdStR III § 72 Rn. 126.
[40] Battis DÖV 1987, 1 (3); Lecheler in HbdStR III § 72 Rn. 126; ders. PersV 1981, 1 (2); Leisner S. 486 ff.; Schenke PersV 1989, 409 (414).
[41] Schenke JZ 1991, 581 (583); vgl. auch VerfGH NW NVwZ 1987, 211 (212); StGH Hessen DVBl. 1986, 936 (940).
[42] Fischer/Goeres in GKÖD K § 1 Rn. 3.
[43] Kossens RiA 1996, 66 (68) m.w.N.
[44] Isensee in HbdVerfR § 32 Rn. 51 ff.; Fischer/Goeres in GKÖD K § 1 Rn. 3; Lecheler PersV 1981, 1 (4).
[45] Fischer/Goeres in GKÖD Anhang zu K § 1 Rn. 6.
[46] So z.B. die Privatisierung der baden-württembergischen Feuerversicherung, s. Darstellung der Problematik bei Blanke PersR 1999, 197 (206).
[47] Kossens RiA 1996, 66 (69).
[48] Ausführlich bei Blanke a.a.O. (198f.).
[49] Blanke a.a.O. (203f.).
[50] So. Blanke a.a.O.
[51] BAG PersR 1999, 223 ff.
[52] Altvater u.a. BPersVG § 104 Rn. 13 f.; Bryde in Thieme-FS, S. 16; Kempen ArbuR 1987, 9 (16); Wendeling-Schröder ArbuR 1987, 381 (383).
[53] Benecke S. 118; im Ergebnis auch Schenke JZ 1991, 581 (582) und Ossenbühl S. 30.
[54] Fischer/Goeres in GKÖD K §1 Rn. 6 f.; Lecheler PersV 1981, 1 (2).
[55] Grabendorff u.a. Einleitung Rn. 24; Maunz in Maunz/Dürig/Herzog/Scholz Art. 33 Rn. 76; Lecheler in HbdStR III § 72 Rn. 59; Leuze JZ 1995, 1014 (1014); Pfohl ZBR 1996, 82 (84); Schenke JZ 1991, 581 (583).
[56] BVerfGE 3, 58 (137); Isensee in HbdVerfR § 32 Rn. 62f.; Maunz a.a.O. Rn. 70f.; Schnapp ZBR 1999, 397 (401).
[57] Siehe auch die Darstellung der geschichtlichen Entwicklung bei Kossens RiA 1996, 66 (67) und Rob
S. 11 ff.
[58] So aber die Befürworter dieser Ansicht, die sich nur auf das tatsächliche Bestehen von solchen Beamtenausschüssen weitgehend als ausreichend ansehen wollen, s.o. Fn. 55.
[59] Maunz a.a.O. (Fn. 55) Rn. 70f; Schnapp ZBR 1999, 397 (399); ähnlich Isensee in HbdVerfR § 32 Rn. 25.
[60] Isensee in HbdVerfR § 32 Rn. 65; ähnlich auch Lecheler in HbdStR III § 72 Rn. 40 ff.
[61] Ausdrücklich so auch Maunz a.a.O. (Fn. 55) Rn. 76.
[62] Leisner S. 519 f.; ähnlich auch Schenke JZ 1991, 581 (583), der den von ihm behaupteten hergebrachten Grundsatz ebenfalls für wenig aussagekräftig erachtet.
[63] So z.B. Wendeling-Schröder ArbuR 1987, 381 (386).
[64] Battis DÖV 1987, 1 (4); Isensee in HbdVerfR § 32 Rn. 24; Lecheler NJW 1986, 1079 (1081); Leisner
S. 496; Schenke JZ 1991, 581 (582); im Ergebnis auch VerfGHRhPf ZBR 1994, 272 (273).
[65] So z.B. im Ansatz Wendeling-Schröder a.a.O.
[66] Fischer/Goeres in GKÖD K §1 Rn. 6 f.; Lecheler PersV 1981, 1 (2).
[67] S.o. C. I. 2.
[68] BVerfGE 59, 231 (268) m.w.N.
[69] Ossenbühl PersV 1989, 409 (414); Schenke PersV 1992, 289 (294).
[70] Battis DÖV 1987, 1 (3).
[71] BVerfGE 93, 37 (69); Benecke S. 119; Schenke PersV 1992, 289 (294).
[72] So zum Beispiel BVerfGE 59, 231 (263) bezogen auf Grundrechte; s.a. Lecheler PersV 1981, 1 (3); Ossenbühl PersV 1989, 409 (414); Schenke JZ 1991, 281 (282).
[73] Dies entspricht im Wesentlichen dem Ansatz von Schenke PersV 1992, 289 (294) bzw. JZ 1991, 581 (585). Zu einem ähnlichen Ergebnis wird Ossenbühl PersV 1989, 409 (418) kommen, der eine verfassungsrechtliche Balance zwischen Eingriff in das Demokratieprinzip und der Verwirklichung des Sozialstaatsprinzips fordert. Vergl. auch Fischer/Goeres in GKÖD K § 1 Rn. 3 und 6b f.
[74] Ähnlich auch Schenke JZ 1991, 581 (585).
[75] Fehlendes allgemeinpolitisches Mandats der Personalvertretung: BVerfG 93, 37 (81); Schenke JZ 1991, 581 (589); Pfohl ZBR 1996, 82 (91).
[76] Vergleiche Maunz in Maunz/Dürig/Herzog/Scholz Art. 33 Rn. 59.
[77] Sog. ”Drei-Stufen-Lehre” die zwischen drei verschiedenen Formen der personalvertretungsrechtlichen Entscheidungen differenziert (BVerfG ZBR 1996, 15 (17)):
a) innerdienstliche Maßnahmen, die keine oder nur unerhebliche Auswirkung auf die Amtsführung haben; können der Mitbestimmung gänzlich unterworfen werden
b) innerdienstliche Maßnahmen, die die Amtsführung regelmäßig in nicht nur unerheblichem Maße beeinflussen; ein Letztentscheidungsrecht muß bei dem Dienstherren verbleiben, und
c) innerdienstliche Maßnahmen, die schwerpunktmäßig eine Außenwirkung aufweisen; keine substantielle Einschränkung der Entscheidung des Dienstherren, d.h. nur geringe Form der Beteiligung des Personalrates.
[78] Schenke JZ 1991, 281 (282); Ossenbühl PersV 1989, 409 (418); vergl. auch Pfohl ZBR 1996, 82 (87), der kritisch anmerkt, daß das BVerfG in seiner Entscheidung zum schleswig-holsteinischen MBG nicht auf andere Beteiligungsrechte eingegangen sei.
[79] Eine umfassende Diskussion aller einzelner Beteiligungsvarianten kann angesichts der Fülle der Regelungen in diesem Rahmen nicht erfolgen.
[80] So zum Beispiel in § 52 I BremPersVG, § 64 I NdsPersVG, § 2 schlesw.-holst. MBG.
[81] So z.B. für das schlesw.-holst. MBG vertreten von Schenke PersV 1992, 289 (296).
[82] BVerfGE 93, 37 (75) im Bezug auf das schlesw.-holst. MBG; ähnlich auch VerfGHRhPf ZBR 1994, 272 (276); a.A. aber Bryde PersR 1994, 4 (5), der eine Beschränkung auf innerdienstliche Maßnahmen behauptet, aber deren Außenwirkung dabei ignoriert.
[83] Vergleiche z.B. §§ 58-61 BremPersVG und §§ 65-67 NdsPersVG.
[84] Rob PersR 1999, 382 (385).
[85] BVerfGE 9, 268 (287); BVerfGE 93, 37 (76); Schenke JZ 1991, 581 (588); Pfohl ZBR 1996, 82 (87); ähnlich auch Lecheler in HbdStR III § 72 R. 131.
[86] BVerfGE 9, 268 (287); Isensee HbdVerfR § 32 Rn. 25; Lecheler a.a.O.
[87] BVerfGE a.a.O. (284)
[88] BVerfGE a.a.O.; s.a. Dietz/Richardi § 104 Rn. 9.
[89] Lecheler PersV 1981, 1 (8).
[90] So auch VerfGH RhPf ZBR 1994, 272 (276); HessStGH DVBl. 1986, 936 (942); Pfohl ZBR 1996, 82 (87); Schenke JZ 1994, 1025 (1030), der aber mit beachtlichen Gründen eine Ausweitung der Rechtsprechung auf Arbeiter anzweifelt.
[91] S.a. Pfohl a.a.O., der sich als einer der wenigen dazu äußert, in welchem Umfang Beteiligungsrechte noch bestehen bleiben sollen, während sich die meisten Meinungen in Literatur und Rechtsprechung auf die Feststellung der Unzulässigkeit der Mitbestimmungsrechte beschränken.
[92] So zum Beispiel für Beamte das Disziplinarverfahren und für die Arbeitnehmer das Kündigungsschutzverfahren. Auf nähere Einzelheiten kann hier jedoch nicht eingegangen werden.
[93] Wegen der Problematik der daraus resultierenden Unmöglichkeit Umdeutung der fristlosen in die fristgerechte Kündigung, kann hier aus Platzgründen nur auf die einschlägige Kommentarliteratur verwiesen werden.
[94] Palandt-Putzo § 626 Rn. 1.
[95] Palandt-Putzo § 626 Rn. 28.
[96] Vergl. Pfohl ZBR 1996, 82 (89).
[97] Z.B. in § 81 BerlPersVG.
[98] BVerfGE 92, 37 (78); Pfohl a.a.O.; a.A. Bryde PersR 1994, 4 (7), der allerdings die faktischen Bedeutung der Entscheidung der Einigungsstelle verkennt.
[99] Ossenbühl S. 79; vergleiche auch Schenke JZ 1994, 1025 (1030).
[100] Wobei umstritten ist, inwieweit die Dauer der Arbeitszeit mit umfaßt ist, vergleiche Dietz/Richardi § 75 Rn. 225 und Grabendorff u.a. § 75 Rn. 80 ff.
[101] Vergleiche auch das bei Ossenbühl PersV 1989, 409 (413) genannte Beispiel der Öffnung einer Bibliothek am Wochenende.
[102] Grabendorff u.a. § 75 Rn. 89.
[103] Vergleiche z.B. die für verfassungswidrig erklärten Regelungen der § 86 LPersVG PhPf, § 59 I 1 schlesw.-holst. MBG.
[104] VerfGHRhPf PersV 1994, 307 (331); Pfohl ZBR 1996, 82 (89).
[105] Vergl. VerfGH RhPf PersV 1994, 307 (333); Pfohl a.a.O.; Schenke PersV 1992, 289 (304f.).
[106] Pfohl a.a.O. (90); Schenke a.a.O.
[107] So z.B. in § 56 I 1 schlesw.-holst. MBG, §§ 70, 72 III 2 NdsPersVG.
[108] BVerfGE 92, 37 (80); Schenke JZ 1991 581 (590f).
[109] Schenke a.a.O.
[110] Ossenbühl S. 94; Schenke a.a.O.
[111] Schenke a.a.O.
[112] Das dieses Problem auch im Hinblick auf § 104 II BPersVG nicht nur rein theoretischer Natur ist, zeigt sich jedoch auch daran, daß es öfter Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen war, so z.B. im Vorlagebeschluß des OVG Bremen ZBR 1984, 275 ff.; OVG Münster PersV 1988, 537 ff.; BVerfG JZ 1995, 1011 ff.
[113] S.o. B.II.2.; a. A. aber z.B. Lecheler HbdStR III § 72 Rn. 59, der schon die Personalvertretung als solche von Art. 33 V GG umfaßt sieht.
[114] Lecheler NJW 1986, 1079 (1080).
Häufig gestellte Fragen zu "Zulässigkeit und Umfang der Beteiligung der Personalvertretung"
Was sind die verfassungsrechtlichen Schranken der Mitbestimmung im öffentlichen Dienst?
Die Mitbestimmung im öffentlichen Dienst unterliegt verfassungsrechtlichen Schranken, insbesondere durch das Demokratieprinzip, das Rechtsstaatsprinzip und das Prinzip der Funktionsfähigkeit der Verwaltung. Diese Prinzipien können durch die Beteiligung der Personalvertretung potenziell durchbrochen werden.
Inwiefern durchbricht die Personalvertretung das Demokratieprinzip?
Die Personalvertretung durchbricht das Demokratieprinzip, da sie als Vertretung von Interessen agiert, die nicht direkt durch das Volk legitimiert sind. Zudem kann ein Konflikt mit dem Erfordernis der Einheit von Entscheidungsmacht und Entscheidungsverantwortung entstehen.
Wie wird die demokratische Legitimation staatlichen Handelns im Zusammenhang mit der Personalvertretung diskutiert?
Es wird diskutiert, ob die Tätigkeit der Personalvertretung im Rahmen der Personalvertretungsgesetze die Ausübung von Staatsgewalt darstellt, was eine demokratische Legitimation erfordern würde. Die fehlende direkte Wahl der Personalvertretung durch das Volk wird als Problem gesehen.
Inwiefern durchbricht die Personalvertretung das Rechtsstaatsprinzip?
Die Personalvertretung durchbricht das Rechtsstaatsprinzip, weil sie als Interessenvertretung der Bediensteten nicht zur Neutralität verpflichtet ist, die von der Verwaltung gefordert wird.
Wie beeinflusst die Personalvertretung die Funktionsfähigkeit der Verwaltung?
Es wird befürchtet, dass die Personalvertretung die Funktionsfähigkeit der Verwaltung beeinträchtigen kann, insbesondere wenn sie Entscheidungen blockiert oder verzögert. Dies ist allerdings im Einzelfall oft schwer nachzuweisen.
Wie kann die Durchbrechung von Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip gerechtfertigt werden?
Es wird diskutiert, ob die Durchbrechung von Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip durch Grundrechte, hergebrachte Grundsätze des Berufsbeamtentums, die "Demokratisierung der Verwaltung", die rechtsstaatliche Kontrolle der Verwaltung oder das Sozialstaatsprinzip gerechtfertigt werden kann. Allerdings reichen diese Rechtfertigungen oft nicht aus.
Welche Rolle spielen Grundrechte bei der Rechtfertigung der Personalvertretung?
Ein Vergleich mit dem BetrVG wird gezogen, um Gleichheitsgründe (Art. 3 I GG) für umfangreiche Beteiligungsrechte zu argumentieren. Jedoch werden die Unterschiede zwischen Arbeitnehmern in der freien Wirtschaft und Bediensteten im öffentlichen Dienst hervorgehoben, die diesen Vergleich erschweren.
Wie wird die kollektive Wahrnehmung von Grundrechten als Rechtfertigung betrachtet?
Die Argumentation, dass die Personalvertretung lediglich die kollektive Ausübung von Grundrechten darstellt, wird abgelehnt, da der Personalrat nicht als Träger kollektiver Grundrechte agiert, sondern lediglich deren Effektuierung dienen kann.
Was ist die Bedeutung des Art. 33 V GG i.V.m. Art. 130 III WRV für die Personalvertretung?
Es wird diskutiert, ob Art. 33 V GG i.V.m. Art. 130 III WRV eine Pflicht zur Schaffung der Personalvertretung begründet, da dies ein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums sein könnte. Die historischen Hintergründe und die Frage, ob die Beamtenvertretung tatsächlich ein prägender Bestandteil des Beamtentums war, werden kritisch beleuchtet.
Inwiefern ist die "Demokratisierung der Verwaltung" eine tragfähige Rechtfertigung?
Der Ansatz, dass die "Demokratisierung der Verwaltung" die Mitbestimmung rechtfertigt, wird kritisiert, da er im Widerspruch zum festgestellten Verstoß gegen das Demokratieprinzip durch mangelnde Legitimation steht.
Wie kann das Sozialstaatsprinzip zur Rechtfertigung der Personalvertretung beitragen?
Das Sozialstaatsprinzip (Art. 20 I, 28 I GG) verpflichtet den Gesetzgeber zur Schaffung einer gerechten Sozialordnung, die auch den Schutz der Bediensteten umfasst. Daraus kann eine Pflicht zur Schaffung einer Personalvertretung abgeleitet werden, allerdings nur in begrenztem Umfang.
Wie werden die Grenzen der Beteiligung auf bestehende und mögliche Beteiligungsrechte angewendet?
Es wird betont, dass jedes einzelne Beteiligungsrecht geprüft werden muss, um festzustellen, ob und in welchem Umfang die Personalvertretung an einzelnen Entscheidungen beteiligt werden kann. Einige in Rechtsprechung und Literatur diskutierte Regelungen werden genauer untersucht.
Was ist das Problem mit der Allzuständigkeit der Personalvertretungen durch Generalklauseln?
Generalklauseln in einigen Landespersonalvertretungsgesetzen, die die beteiligungspflichtigen Angelegenheiten umschreiben, können problematisch sein, da sie die Grenzen der Mitbestimmung verwischen. Es wird gefordert, dass diese Klauseln durch Beispielkataloge eingeschränkt werden müssen.
Welche Probleme ergeben sich bei der Beteiligung an Personalentscheidungen?
Die Beteiligung des Personalrates an Personalentscheidungen ist problematisch, da Personalmaßnahmen eine starke Außenwirkung haben. Es wird argumentiert, dass ein echtes Mitbestimmungsrecht hier einen unverhältnismäßig starken Eingriff in das Demokratieprinzip darstellt.
Inwieweit ist eine Ausweitung der Personalentscheidungen auf Angestellte und Arbeiter zulässig?
Es wird argumentiert, dass auch bei Angestellten und Arbeitern im öffentlichen Dienst die Durchbrechung des Demokratie- und Rechtsstaatsprinzips nicht mehr zu rechtfertigen ist, insbesondere angesichts der Tendenz, verstärkt Angestellte bei der Erfüllung hoheitlicher Aufgaben einzusetzen.
Welchen Umfang haben mögliche verbleibende Beteiligungsrechte?
Nachdem festgestellt wurde, dass eine echte Mitbestimmung bei Personalentscheidungen abzulehnen ist, wird diskutiert, in welcher Weise der Personalrat dennoch an der Entscheidung beteiligt werden kann. In Betracht kommen insbesondere eine eingeschränkte Mitbestimmung, Mitwirkung oder Anhörung.
Wie sieht die Beteiligung an Organisationsangelegenheiten aus?
Bei organisatorischen Maßnahmen kommt eine echte Mitbestimmung nicht in Frage. Problematisch ist z.B. die Einführung der Datenverarbeitung, die einen sozialen Bezug hat, der Mitbestimmung zu unterstellen.
Wie bewertet man die Beteiligung der Gewerkschaften?
Die Beteiligung von Gewerkschaften an Personalvertretungsmaßnahmen wird als problematisch angesehen, da die Gewerkschaften nicht demokratisch durch das Volk legitimiert sind und die nicht gewerkschaftlich organisierten Bediensteten gegen die negative Koalitionsfreiheit verstoßen würden.
Wie sieht es mit den Initiativrechten der Personalvertretung aus?
Umfassende aktive Beteiligungsrechte durch Initiativrechte werden als problematisch angesehen, da sie die Durchbrechung des Demokratieprinzips wesentlich verstärken und die Behörde in ihrer Handlungsfähigkeit beeinträchtigen könnten.
Was ist zur strengen Durchhaltung des Gruppenprinzips zu sagen?
Es wird argumentiert, dass es keine verfassungsrechtliche Verpflichtung zur Einhaltung des Gruppenprinzips (Trennung der einzelnen Gruppen Beamte, Angestellte und Arbeiter) gibt.
- Citation du texte
- Jan Rudolph (Auteur), 2000, Mitbestimmung im Öffentlichen Dienst, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98612