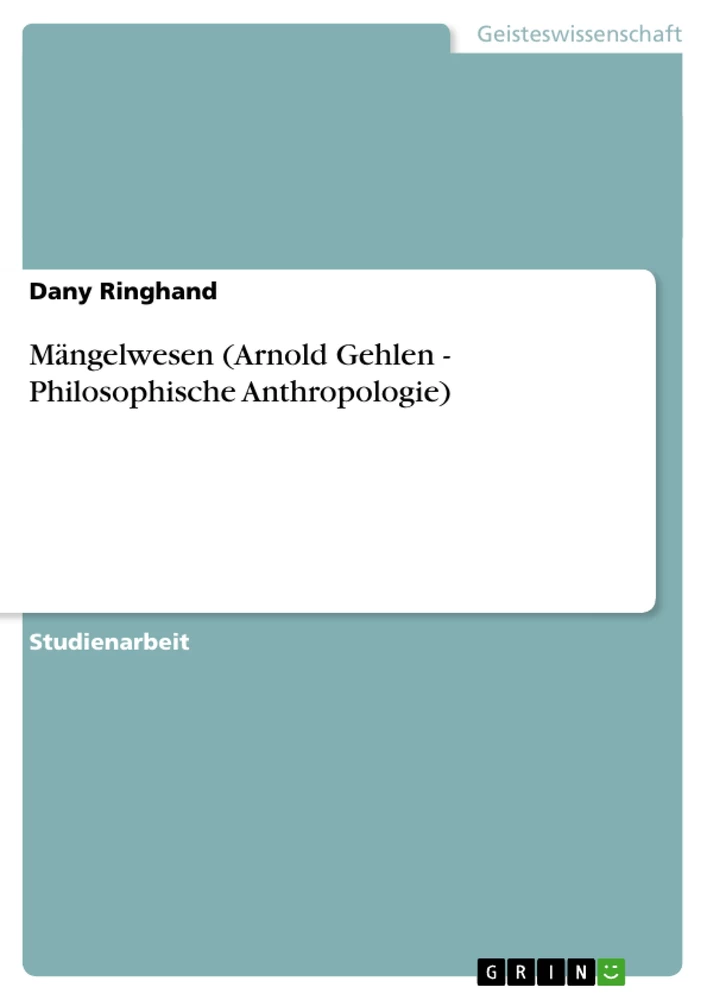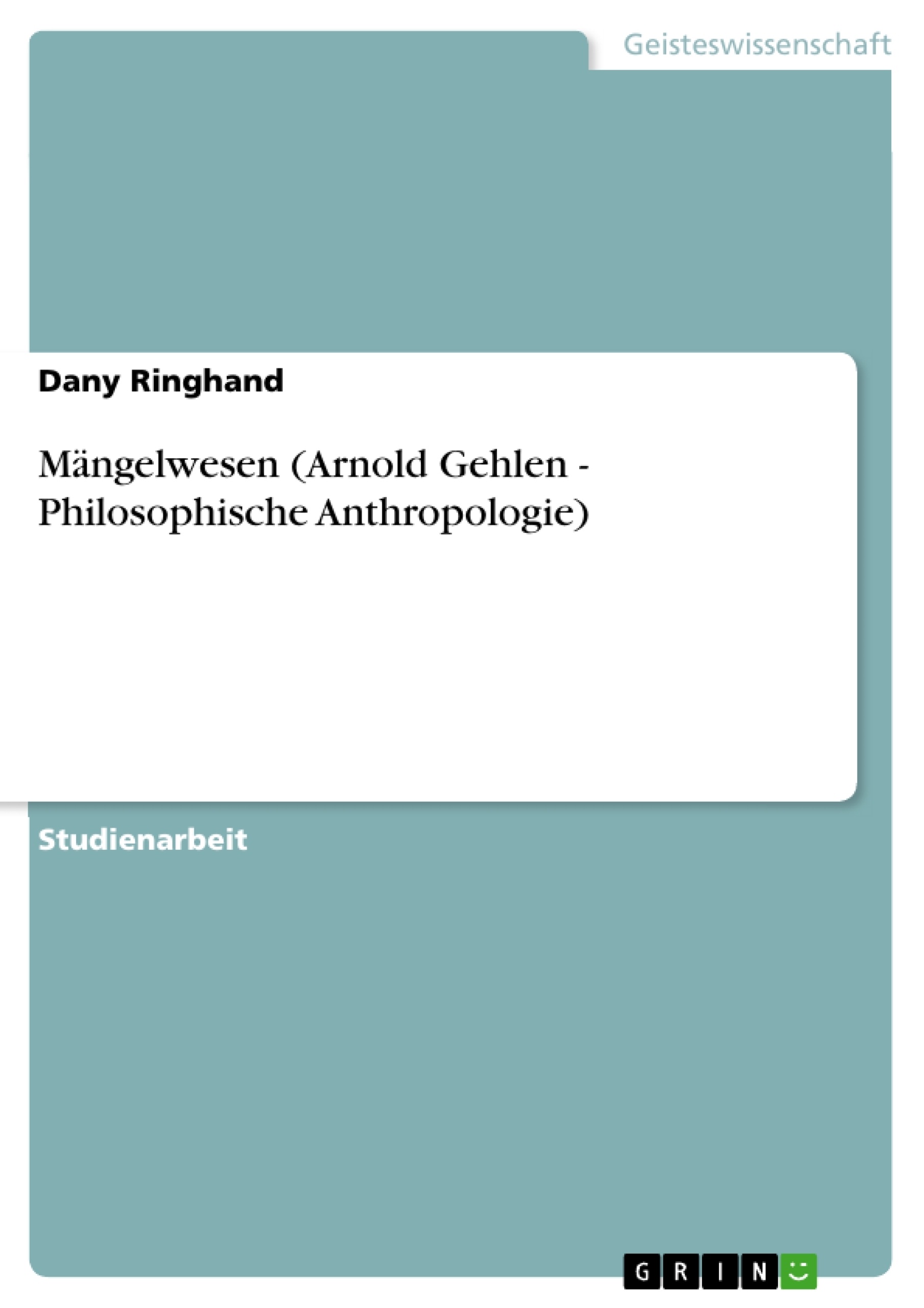Was macht den Menschen zum Menschen? Arnold Gehlen, einer der bedeutendsten Köpfe der philosophischen Anthropologie des 20. Jahrhunderts, wagte eine ebenso provokante wie einflussreiche Antwort: das "Mängelwesen". Doch ist diese viel diskutierte These wirklich haltbar? Entdecken Sie in dieser Auseinandersetzung mit Gehlens Werk "Der Mensch – Seine Natur und seine Stellung in der Welt" eine kritische Analyse seiner zentralen Argumente. Gehlens Anthropologie, die den Menschen in seiner biologischen Unangepasstheit und Unspezialisiertheit verortet, wird hier auf den Prüfstand gestellt. Die Untersuchung beleuchtet, wie Gehlen den Menschen als ein Wesen der Zucht, der Selbstgestaltung und der Entlastung von Reizüberflutung konzipiert. Dabei wird insbesondere die Frage aufgeworfen, ob der Begriff "Mängelwesen" angesichts der einzigartigen Fähigkeiten des Menschen, wie Sprache, Denken und Religionsausübung, tatsächlich zutreffend ist. Die Argumentation entkräftet die Vorstellung eines mangelhaften Wesens und stellt ihr die schöpferische Kraft und die geistige Dimension des Menschen entgegen. Diese Abhandlung lädt dazu ein, die Grundlagen der philosophischen Anthropologie neu zu denken und ein differenziertes Bild des Menschen jenseits von vermeintlichen Defiziten zu entwickeln. Es ist eine Reise durch die Philosophie des 20. Jahrhunderts, die den Leser dazu anregt, über die eigene Natur und die Stellung des Menschen in der Welt zu reflektieren. Tauchen Sie ein in eine Welt der philosophischen Auseinandersetzung und entdecken Sie neue Perspektiven auf die Conditio humana. Dieses Buch ist unverzichtbar für alle, die sich für Anthropologie, Philosophie, Geisteswissenschaften und die Frage nach dem Wesen des Menschen interessieren. Ergründen Sie die Tiefen der menschlichen Existenz und hinterfragen Sie tradierte Denkmuster.
1 Einleitung
Gehlens Buch "Der Mensch" ist eine der wichtigsten Schriften der philosophischen Anthropologie des 20. Jahrhunderts. Die deutsche Philosophische Anthropologie, zu der auch Gehlen gehört, versucht das übergreifend Universale des Menschen zu ergründen. In seinem Buch verwendet Gehlen den Terminus Mängelwesen
und meint damit den Menschen. Die Gehlensche These besagt, dass der Mensch aufgrund seiner im Vergleich zum Tier mangelhaften Organ- und Instinktausstattung in seiner Existenz bedroht ist
(Schülerduden). Ich werde im 3. Abschnitt zeigen, dass der Begriff Mängelwesen
für den Menschen nicht zutreffend ist.
2 Gehlens Anthropologie
Als Gehlens Hauptwerk gilt das 1940 erschienene Buch "Der Mensch - Seine Natur und seine Stellung in der Welt". Die hier dargestellte Anthropologie versucht, den Menschen aus sich selbst abzuleiten und zu deuten. Das bedeutet, dass Gehlen außermenschliche Bereiche wie die Schöpfung und Abstammungslehre ausklammert. Eine biologische Betrachtung lehnt Gehlen ab. Diese kann die unbestrittene Sonderstellung des Menschen gegenüber dem Tier nicht erklären. Es fehlen eindeutige Abgrenzungskriterien, wenn der Blick nur auf Einzelmerkmale wie Körperbau und Kommunikation gerichtet ist. Für Gehlen ist der Mensch das noch nicht festgestellte Tier, er ist irgendwie nicht festgerückt
(Gehlen 1997, S. 16). Die Natur hat dem Menschen eine Sonderstellung zugewiesen und es ist schon für ihn eine beträchtliche Leistung, nächstes Jahr noch zu leben. Er ist nicht festgerückt heißt: er verfügt noch über seine eigenen Anlagen und Gaben, um zu existieren; er lebt nicht, wie ich zu sagen pflege, er führt sein Leben
(Gehlen 1997, S. 17).
In dieser biologischen Unangepasstheit, Unspezialisiertheit, erscheint der Mensch als Mängelwesen
. Wie sich so ein schutzloses, bedürftiges und exponiertes Wesen überhaupt halten kann, führt zu folgender Antwort Gehlens:
Wir wollen ein System einleuchtender, wechselseitiger Beziehungen aller wesentlichen Merkmale des Menschen herstellen, vom aufrechten Gang bis zur Moral, sozusagen,denn alle Merkmale bilden ein System, in dem sie sich gegenseitig voraussetzen: ein Fehler, eine Abweichung würde das Ganze lebensunfähig machen
(Gehlen 1997, S. 17)
Der Mensch ist ein handelndes Wesen in Gehlens Anthropologie. Er ist unfertig und bedarf der Zucht in Form von Selbstzucht und Erziehung. Gehlen schreibt auf Seite 32: ...er ist ein Wesen der Zucht: Selbstzucht, Erziehung , Züchtung gehört zu den Existenzbedingungen eines nicht festgestellten Wesens
. Der Mensch ist für Gehlen weltoffen, aufgrund von Reizen und Eindrücken, die eine Belastung darstellen. Dieser Belastung steht das Entlastungsprinzip gegenüber: aus eigenen Mitteln und eigentätig muß der Mensch sich entlasten
(Gelhen 1997, S. 36). Der Mensch kann der Reizüberflutung entgehen; er zieht sich zurück. Ein Tier kann das nicht. Gehlen setzt also das Überleben des Menschen in Szene. Die Menschwerdung ist für ihn eine große Leistung, im Gegensatz zu den Überlebenschancen. Da die menschliche Spezies unspezialisiert ist, sichert sie ihr Überleben aufgrund ihrer Fähigkeit zum Handeln
(Pieper 1998, S.22).
3 Die Unzutreffendheit des Begriffs "Mängelwesen"
Im 3. Abschnitt werde ich Argumente gegen die Bezeichnung Mängelwesen
vorstellen. Beginnen will ich mit einer kritischen Betrachtung der Anthropologie Gehlens. Gehlens Ansatz berücksichtigt kaum, dass der Mensch nicht allein ist, sondern mit anderen Menschen aufwächst. In diesem Gebilde von Menschen erwirbt der Mensch Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen. Wichtig ist der Körper mit seiner spezifischen Form
(Pieper 1998, S. 25).Aber das ist noch nicht alles; sie ist fähig, Erfahrungen des Weltumgangs abzulagern, Werkzeuge zu formen und eine neue und höhere Form des Sprachlichen anzulegen. Im biologischen Bereich lassen sich auch Argumente finden. Merkmale, die den Menschen vom Tier unterscheiden, sind schon im Erbgang genetisch festgelegt. Der Mensch lernt stündlich Neues hinzu. Die Sprache wiederum ermöglicht den Austausch menschlicher Erfahrungen von Individuum zu Individuum. Beim Tier ist das nicht nötig. Das durch Instinktordnung geregelte Sozialleben überwiegt
(Roth 1966, S. 131).
Gehlen sieht das folgendermaßen; weil der Mensch keinen Instinkt hat, hat er das Denken nötig. Roth (1966, S. 149) meint: Weil der Mensch das Denken hat, hat er keinen Instinkt nötig
. Das Denken ist eine wichtige Existenzform des Menschen und gehört zur Geistigkeit des Menschen. Die Religion gehört auch in diesen Bereich. Der Mensch vollzieht Bestattungsriten, kennt Götter. Die Religion kann dem Menschen bei seiner Weltdeutung behilflich sein. Es gibt keinen Menschen, der ohne Weltdeutung leben kann, sei dies auch noch so primitiv.
4 Zusammenfassung
Gehlen greift bei seiner Betrachtung einzelne Details heraus. Der Mensch ist unangepasst und unspezialisiert. Auch seine im Vergleich zum Tier zweifellos vorhandene Instinktreduzierung rechtfertigt trotzdem nicht die Bezeichnung Mängelwesen
. Die Sprache und das Denken kennzeichnen den Menschen. Sie sind Basiskomponenten und stehen gegen diesen Terminus.
Selbst die Religion spricht dagegen. Sie ist ein einmaliger Bereich des Menschen. Im Schöpfungsakt geht der Mensch als Krönung hervor und verdient nicht die Bezeichnung und kann kein Mängelwesen
sein.
5 Literatur
- Gehlen, Arnold "Der Mensch - Seine Natur und seine Stellung in der Welt";
13. Auflage, Wiesbadeb: Quelle & Meyer, 1997 - Pieper, Annemarie "Philosophische Disziplinen" Reclam 1998
- Roth, Heinrich "Pädagogische Anthropologie" Band 1; Herrmann Schroedel Verlag, Hannover 1966
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Hauptfokus von Gehlens Werk "Der Mensch"?
Gehlens Werk "Der Mensch" konzentriert sich auf die philosophische Anthropologie und versucht, das übergreifend Universale des Menschen zu ergründen. Er untersucht die Natur des Menschen und seine Stellung in der Welt, wobei er außermenschliche Bereiche wie Schöpfung und Abstammungslehre ausklammert.
Was bedeutet der Begriff "Mängelwesen" im Kontext von Gehlens Anthropologie?
Gehlen verwendet den Begriff "Mängelwesen", um den Menschen zu beschreiben, da er der Ansicht ist, dass der Mensch aufgrund seiner im Vergleich zum Tier mangelhaften Organ- und Instinktausstattung in seiner Existenz bedroht ist.
Welche Kritik wird an Gehlens Verwendung des Begriffs "Mängelwesen" geäußert?
Die Kritik richtet sich darauf, dass Gehlens Ansatz kaum berücksichtigt, dass der Mensch nicht allein ist, sondern in einer Gemeinschaft aufwächst, in der er Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen erwirbt. Zudem wird argumentiert, dass Merkmale, die den Menschen vom Tier unterscheiden, wie Sprache und Denken, genetisch festgelegt sind und dass der Mensch stündlich Neues hinzulernt.
Was ist Gehlens Entlastungsprinzip?
Das Entlastungsprinzip besagt, dass der Mensch sich aus eigenen Mitteln und eigentätig von der Reizüberflutung entlasten muss. Er kann sich zurückziehen, was ein Tier nicht kann.
Welche Rolle spielt die Zucht in Gehlens Anthropologie?
Gehlen betont, dass der Mensch ein Wesen der Zucht ist, einschließlich Selbstzucht, Erziehung und Züchtung, da dies zu den Existenzbedingungen eines nicht festgestellten Wesens gehört.
Warum wird argumentiert, dass der Begriff "Mängelwesen" für den Menschen nicht zutreffend ist?
Es wird argumentiert, dass die Sprache, das Denken und die Religion den Menschen kennzeichnen und somit gegen die Bezeichnung "Mängelwesen" sprechen. Die Fähigkeit zur Weltdeutung und der Schöpfungsakt, der den Menschen als Krönung sieht, widersprechen ebenfalls diesem Begriff.
Welche anderen Philosophen werden in Bezug auf Gehlens Werk erwähnt?
Annemarie Pieper und Heinrich Roth werden im Kontext der Auseinandersetzung mit Gehlens Anthropologie erwähnt.
Was sind die Hauptquellen, die in der Analyse von Gehlens "Der Mensch" verwendet werden?
Die Hauptquellen sind Gehlens "Der Mensch - Seine Natur und seine Stellung in der Welt", Annemarie Piepers "Philosophische Disziplinen", Heinrich Roths "Pädagogische Anthropologie" und der Schülerduden "Philosophie".
- Quote paper
- Dany Ringhand (Author), 2000, Mängelwesen (Arnold Gehlen - Philosophische Anthropologie), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98637