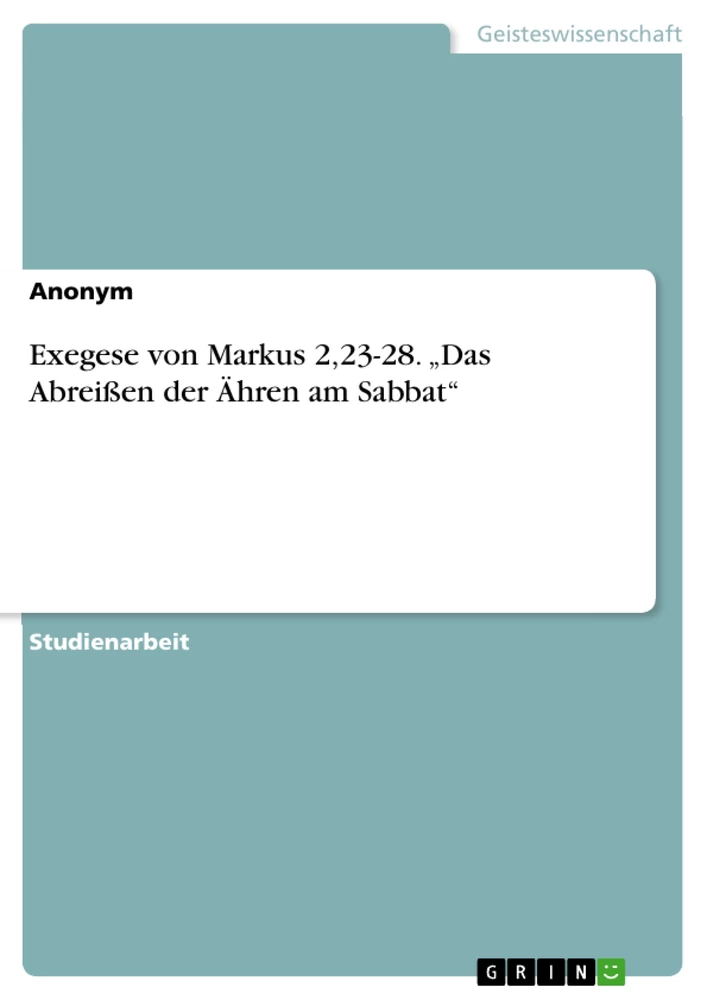In dieser Arbeit wird die Bibelstelle "Das Abreißen der Ähren am Sabbat" aus dem Markusevangelium exegiert.
Die Erzählung spielt sich an einem Sabbat in Staatsfeldern ab. Alle beteiligten Personen werden schon im zweiten Satz genannt. Die Akteure sind zum einen Jesus mit seinen Jüngern und zum anderen die Pharisäer.
Das vorherige Streitgespräch "Die Frage nach dem Fasten" (Mk 2,18 – 22), in welchem es um die Fastenfrage geht, ist eng mit der zu analysierenden Perikope verbunden. Hierbei geht es darum, dass die Jünger von Jesus, im Gegensatz zu denen von Johannes und den Pharisäern, nicht am Fasten sind. Mit der Antwort Jesu: "Niemand näht ein Stück neuen Stoff auf ein altes Kleid; denn der neue Stoff reißt doch vom alten ab und es entsteht ein noch größerer Riss. Auch füllt niemand neuen Wein in alte Schläuche; der Wein ist verloren und die Schläuche sind unbrauchbar. Neuer Wein gehört in neue Schläuche" (Mk 2, 21f.) wird ausgesagt, dass neue Zeiten auch neues Handeln fordern.
Genau diese Aussage ist auch Thema in Mk 2, 23 – 28. Für eine ursprüngliche Verbindung beider Perikopen spricht außerdem, dass Jesus in der Erzählung über den Sabbat nicht mit Namen genannt wird. Der Name Jesus fällt hier kein einziges Mal. Die Rede ist nur von "er" (V. 23).
Inhaltsverzeichnis
- Abschrift des zugrunde gelegten Textes
- Analyse des Textes
- Abgrenzung und Kontext
- Ausformulierte Gliederung des Textes
- Abgrenzung von Tradition und Redaktion
- Gattungsbestimmung der vormarkinischen Überlieferung
- Begriffsbestimmung bzw. religionsgeschichtliche Analyse
- Interpretation
- Interpretation der vormarkinischen Überlieferung
- Interpretation des markinischen Textes
- Interpretation des Textes an sich
- Interpretation des Textes im theologischen Gesamtrahmen des Mk
- Synoptischer Vergleich
- Interpretation der mt. Parallele
- Interpretation der lk. Parallele
- Zusammenfassung und Bündelung
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es, die Perikope Markus 2, 23-28, „Das Abreißen der Ähren am Sabbat“, exegetisch zu analysieren und zu interpretieren. Dabei steht die Frage im Vordergrund, wie die Perikope im Kontext des Markusevangeliums zu verstehen ist und welche theologischen Aussagen sie beinhaltet.
- Sabbatgesetz und seine Auslegung
- Jesus und seine Jünger im Konflikt mit den Pharisäern
- Die Autorität Jesu über den Sabbat
- Der Menschensohn als Herr über den Sabbat
- Die Bedeutung der Perikope im Kontext der Passion und Todes Jesu
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Abschnitt der Arbeit widmet sich der Abschrift des zugrunde gelegten Textes aus dem Markusevangelium. Im zweiten Abschnitt wird die Perikope analysiert, wobei die Abgrenzung und der Kontext des Textes, die Gliederung, die Abgrenzung von Tradition und Redaktion sowie die Gattungsbestimmung der vormarkinischen Überlieferung und die religionsgeschichtliche Analyse behandelt werden. Der dritte Abschnitt konzentriert sich auf die Interpretation, sowohl der vormarkinischen Überlieferung als auch des markinischen Textes. Im vierten Abschnitt wird ein synoptischer Vergleich mit den entsprechenden Parallelstellen in Matthäus und Lukas gezogen. Der fünfte Abschnitt beinhaltet eine Zusammenfassung der gewonnenen Erkenntnisse und eine Bündelung der Ergebnisse. Abschließend werden das Literaturverzeichnis und der Anhang aufgeführt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter für diese Arbeit sind: Markusevangelium, Exegese, Sabbat, Pharisäer, Jesus, Menschensohn, Tradition, Redaktion, Interpretation, Synoptik, Theologie.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Exegese von Markus 2,23-28. „Das Abreißen der Ähren am Sabbat“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/987264