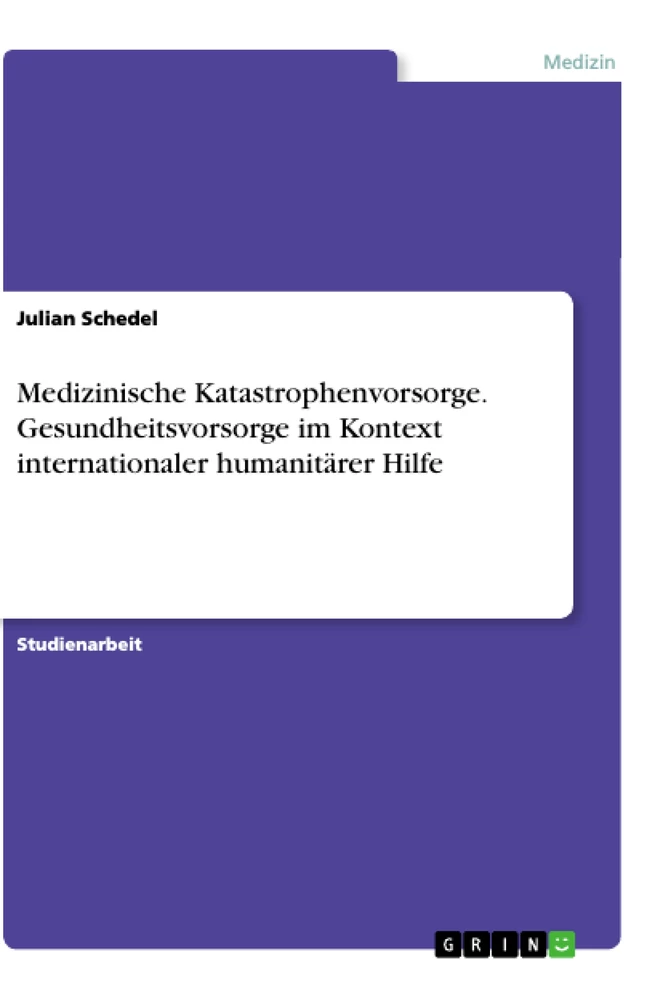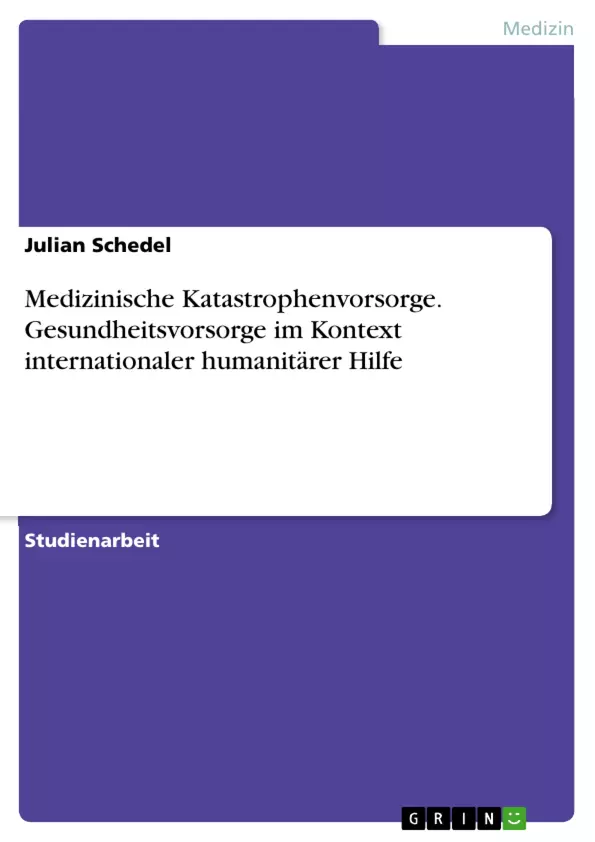Die Studienarbeit setzt sich mit ausgewählten Themen aus der medizinischen Katastrophenvorsorge und dem Gesundheitswesen auseinander. Im ersten Kapitel wird die Psychosoziale Notfallvorsorge (PSNV) näher betrachtet. Dazu werden anhand eines Szenarios Belastungsfaktoren und die Gründe für mögliche krankheitswertigen Folgen beschrieben. Diese akuten, mittel- und langfristigen Folgen werden näher betrachtet und sowohl die Ansätze als auch die Zielsetzung der PSNV in Bezug auf die Minderung dieser Folgen fokussiert.
Der Abschnitt Public Health beschäftigt sich zunächst mit den gesundheitlichen Risiken, die mit einem mehrwöchigen großflächigen Stromausfall in Mitteleuropa verbunden wären. Anhand dieses Szenarios werden für den Ausbruch einer Cholera-Epidemie aufgrund verunreinigten Trinkwassers die Grundzüge der deskriptiven Epidemiologie näher beleuchtet. Im dritten Kapitel setzt sich der Autor mit den Vorteilen und Schwierigkeiten der "Community-led Humanitarian Response in Sudden-onset Disastern" auseinander und wägt dabei mögliche institutionelle Barrieren und Möglichkeiten ab.
Das vierte Kapitel beschreibt anhand der Entwicklung der letzten Jahre, die Herausforderungen für das Krisenmanagement der medizinischen Versorgung der nächsten zehn Jahre. Exemplarisch werden her Rettungs- und Sanitätsdienst, die Vorsorge bei einem Massenanfall von Verletzten oder Erkrankten und die Vorsorgeplanung für das Krisenmanagement in einem Krankenhaus betrachtet. Dabei werden verschiedene Defizite, aber auch positive Entwicklungen aufgezeigt und verschiedene Lösungsansätze für den Bereich des Rettungsdienstes genannt.
Inhaltsverzeichnis
1. Psychosoziale Notfallvorsorge
2. Public Health
3. Planung, Organisation und Standards der Gesundheitsvorsorge in der internationalen humanitären Hilfe
4. Vorsorge und Krisenmanagement der medizinischen Versorgung
5. Fazit
Abkürzungsverzeichnis
CBRN Chemisch, biologisch, radiologisch und nuklear
GO Governmental organization (Regierungsorganisation)
IKRK Internationales Komitee vom Roten Kreuz
KAEP Krankenhausalarm- und -einsatzplanung
KRITIS Kritische Infrastruktur
MANV Massenanfall von Verletzten und Erkrankten
NGO Non-governmental organization (Nichtregierungsorganisation)
PSNV Psychosoziale Notfallvorsorge
RD Rettungsdienst
SEG Schnelleinsatzgruppe
1. Psychosoziale Notfallvorsorge
Im nachfolgenden werden der Bedarf und die Grundzüge der PSNV näher erläutert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Betroffenen sind verschiedenen potenziellen Belastungsfaktoren ausgesetzt, welche sich in interne und externe physiologische (Abb. 1), sowie in sozial- und individualpsychologische Belastungsfaktoren unterteilen lassen. (Gasch u. Lasogga 2011) Die intern physiologischen Belastungsfaktoren wirken sich primär nur auf die direkt Betroffenen des Unfalls aus und sind insbesondere von der Verletzungssymptomatik und dem Grad der Bewegungseinschränkung abhängig. (Gasch u. Lasogga 2011)
Die verschiedenen extern physiologischen Belastungsfaktoren können sich potenziell je nach Exposition, auf die direkt und indirekt Betroffenen auswirken. Selbst interpersonell Betroffene können durch eine unzensierte mediale Berichterstattung durch optisch und akustisch Wahrnehmungen belastet werden. (Karutz u. Armgart 2015)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Beispiele für physiologische Belastungsfaktoren (Karutz u. Armgart 2015; Helmerichs et al. 2016; Karutz et al. 2018)
Individualpsychologische Belastungsfaktoren können sich in unterschiedlicher Ausprägung auf alle genannten Betroffenen auswirken. So kann die subjektiv wahrgenommene Neuheit der unbekannten und irritierenden Situation, wie auch die Unsicherheit über die möglichen Bedrohungen infolge des Unfallgeschehens und der Rettungsmaßnahmen belastend wirken. Informationsmangel über den gesundheitlichen Status und Verbleib ihrer beteiligten Angehörigen stellt vor allem bei den interpersonell Betroffenen einen hohen Belastungsfaktor dar. Die beginnende Einschränkung des Bewusstseins, lange Wartezeiten der Verletzten, das Verwehren des Zugangs der Angehörigen zur Unfallstelle, ein unverhältnismäßig hoher Ressourcenmangel bei der Verletztenversorgung und ein hoher Zeitdruck für die Einsatzkräfte können zu einem belastenden Gefühl der Hilfslosigkeit bzw. des Kontrollverlustes führen (Helmerichs et al. 2016; Karutz u. Armgart 2015). Unter den direkt Betroffenen nehmen gerade Kinder den Verlust eines persönlichen Bezugsgegenstandes, die (vorübergehende) Trennung von einer Bezugsperson oder verschiedene Vorgänge aufgrund der mangelnden Lebenserfahrung als besonders belastend wahr. Gerade bei Einsatzkräften kann der persönliche Bezug zu einem Betroffenen bzw. zur eigenen Lebenssituation eine besondere Belastung darstellen. (Karutz u. Armgart 2015)
Das im Mittelpunkt stehen, vor allem in einem Zustand völliger Hilflosigkeit und äußerlicher Indisponiertheit wirkt sich oft auf die direkt Betroffenen belastend aus (Karutz u. Armgart 2015). Daher ist das voyeuristische Verhalten von Zuschauern und Medienvertretern an der Einsatzstelle ein hoher psychologischer Belastungsfaktor für alle Betroffenen vor Ort (Helmerichs et al. 2016). Ferner können auch das falsche Verhalten der Einsatzkräfte, eine Störung des eigens entwickelten sozialen Hierarchiesystems durch die Unterordnung gegenüber den Anweisungen der Einsatzkräfte oder das Vorziehen anderer Verletzen bei der Versorgung als Belastungsfaktoren gewertet werden (Gasch u. Lasogga 2011).
Ob ein Ereignis bei einem Betroffenen zu psychosozialen oder gar krankheitswertigen Folgen führt, ist individuell von verschiedenen Faktoren abhängig. Neben den Risikofaktoren und dem Ereignis selbst ist die Wirkung von den personenbezogenen Moderatorvariablen abhängig, welche in Form von Risikovariablen die Anfälligkeit für belastende Folgen erhöhen und als protektive Variablen die Resilienz des Betroffenen steigern und einem soziokulturellen, individualpsychologischen oder biologischen Ursprung zugeordnet werden können. (Gasch u. Lasogga 2011) Das Risiko von psychosozialen oder -somatischen Folgen wird insbesondere durch ein Defizit an protektiven Moderatorvariablen und Bewältigungsstrategien verstärkt. Daraus können je nach zeitlichem Verlauf verschiedene belastende Reaktionen resultieren (Abb. 2). Die Symptome und Reaktionen der Betroffenen können dabei sehr unterschiedlich ausfallen. (Helmerichs et al. 2016; WHO 2011)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Zeitliche Unterscheidung der Belastungsreaktionen. Verändert nach (Helmerichs et al. 2016)
Besitzt der Betroffene ein breites Portfolio an funktionalen Coping-Strategien, ein stabiles soziales Netzwerk, Vorerfahrungen mit Notsituationen, eine starke psychische Struktur, gute körperliche Konstitution und einen gehobenen Bildungsstand, so wird er potenziell eher nur akute bzw. kurzfristige psychosoziale Folgen erleiden. (Antonovsky 1987; Schnyder u. Sauvant 2000)
Eine erhöhte Prädisposition für mittel-/ langfristige psychosoziale Folgen besteht u.a. durch Risikovariablen, wie einem niedrigen soziökonomischen Status, Alkoholmissbrauch, einem defizitären sozialen Rückhalt oder negativen Erfahrungen im privaten Umfeld. Aber auch Faktoren in der Entwicklung, wie eine gestörte Bindung zu den Eltern, schlechtem Kontakt zu gleichaltrigen sowie einer unglücklichen Kindheit können das Risiko länger anhaltender psychosozialer Folgen verstärken. (Abueg u. Fairbank 2001; Brewin et al. 2000)
Dysfunktionale Copingstrategien, wie die Verleugnung oder Verdrängung können ebenfalls zu mittel- bzw. langfristigen belastenden Folgen führen (Greis 1992). Letztendlich sind auch die Magnitude, die Dauer und die Lebensbedrohlichkeit eines Ereignisses für das Auftreten psychosozialer Spätfolgen relevant (Gasch u. Lasogga 2011).
Der Verlauf und Eintritt psychosozialer Folgen ist stets individuell unterschiedlich ausgeprägt. Dabei greift der Mensch zunächst auf die biologisch angeborenen archaischen Verhaltensmuster zurück um anschließend die individuell erworbenen protektiven Moderatorvariablen und Abwehrmechanismen zu nutzen (Hobfoll et al. 2007; Gasch u. Lasogga 2011) Im Falle eines Mangels oder eines (zeitweisen) Fehlens dieser Variablen bedarf es möglichst zielgruppenspezifischer Maßnahmen der PSNV zur Steigerung der psychosozialen Abwehrfähigkeiten. Die PSNV zielt dabei sowohl auf die Vorbeugung belastender Reaktionen durch primär präventive Maßnahmen, die Früherkennung möglicher Belastungsfolgen, als auch auf die Verminderung und Substitution psychosozialer oder gar krankheitsbedingter Folgen ab. (BBK 2012)
Der Grundstein zur Verminderung möglicher Belastungsfolgen wird zunächst mit der psychischen Ersten Hilfe durch den sozial kompetenten Umgang der Einsatzkräfte mit den Betroffenen gesetzt (BBK 2012; Helmerichs et al. 2016). Dies kann beispielsweise durch die schnelle Abschirmung und den Abtransport vom Ereignisort, das aktive Einbinden oder das Stillen der individuellen Bedürfnisse der Betroffenen ermöglicht werden (Karutz u. Armgart 2015).
Die ereignisnahe, psychosoziale Akuthilfe ergänzt mit sekundärpräventiven Maßnahmen wie der psychischen Stabilisierung der Betroffenen (z.B. durch Reaktivierung der persönlichen Bewältigungsstrategien und Vermittlung eines Sicherheitsgefühl) und der anschließenden psychisch bedarfsgerechten Vermittlung an das soziale Umfeld. Mittel- und langfristige psychosoziale Hilfsangebote in Form von Fachstellen der psychosozialen Krisenintervention, der sozial-psychiatrischen Unterstützung und der heilkundlichen, therapeutischen Intervention runden dieses Portfolio ab. (Helmerichs 2010; BBK 2012)
2. Public Health
Die mitteleuropäische Gesellschaft zeichnet sich durch ihre große Abhängigkeit von einer intakten Versorgungsinfrastruktur aus. Ein Zusammenbruch dieser Infrastruktur bedingt durch einen Blackout würde zahlreiche kaskadierende Effekte nach sich ziehen und in Abhängigkeit der Größe des betroffenen Raums die medizinische Versorgung gefährden. (Petermann et al. 2011)
Durch den Ausfall der Verkehrssteuerung und technischer Sicherheitsvorkehrungen wird schon in der Anfangsphase die Zahl der Unfälle rapide Ansteigen und es zu einer starken Bindung von Kapazitäten des Gesundheitswesens kommen.
Bedingt durch ein Kollabieren der Wasserversorgung, kann es zu einer erhöhten Ingestion von verunreinigtem Wasser aus offenem Gewässer kommen, welche zunehmend mit Fäkalien und Toxinen aus dem kollabierten Abwassersystem kontaminiert wird. Hier besteht insbesondere die Gefahr der Infektion mit bakteriellen Erkrankungen wie Cholera, Typhus/ Paratypus oder Escherichia coli (Schaal 2002; Ullmann u. Wundt 2002; Seitz u. Maier 2002). Auch durch Protozoen können über diesen Weg Infektionen wie die Amöbenruhr, Giardiasis oder Kryptosporidiose hervorgerufen werden (Seitz u. Maier 2002; RKI 2019). Bedingt durch den Mangel an sauberem Wasser und einem daraus resultierenden hygienischem Defizit in der Bevölkerung besteht eine erhöhte Gefahr des Befalls durch Räudemilben, Tierläuse oder Hautpilze (Watson et al. 2007).
Durch Verunreinigungen, Fäulnis und Verwesung als Folge des Zusammenbruchs des Abfallentsorgungs- und Abwassersystems wird es zu einer enormen Zunahme von Schädlingen kommen, welche die Gefahr von Zoonosen, wie Salmonellen oder Leptospirosis erheblich erhöhen. Durch unterbrochene Kühlmittelketten, verdorbene Lebensmittel und fehlenden Strom zum Erhitzen von Speisen besteht das Gesundheitsrisiko durch infektiöse Agenzien, wie Staphylokokken, E. coli, Campylobacter, Salmonellen oder deren und andere Toxine (Graevenitz 2002; Brandis 2002). Gerade Notunterkünfte bergen in einer solchen Lage ein hochkontagiöses Potential für die Übertragung verschiedenste Infektionskrankheiten wie beispielsweise durch Viren (Hepatitis A, Influenza, Masern, Meningokokken etc.) oder Bakterien (Cholera) (Deinhardt 2002; Henkel 2002).
Dem Kollabieren des Gesundheitswesens und der pharmazeutischen Versorgung durch ein massiv zunehmendes Defizit medizinischer Ressourcen und ein exorbitant höherer Mehrbedarf an Behandlungskapazitäten, steht einer Immungeschwächten und Multimorbiden Bevölkerung gegenüber.
Die Grundzüge der deskriptiven Epidemiologie werden am Beispiel der Cholera anhand des Blackout für den Landkreis Landsberg am Lech erläutert. Als Bezugszeitraum wird ein 7-Tage Zeitraum Rückblickend vom Bezugszeitpunkt X gewählt. Die Berechnungsformeln beruhen auf Mayr in (Mayr 2002).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Zur Ermittlung weiterer Risikofaktoren bietet sich die retrospektive Fall-Kontrollstudie an, welche die Wahrscheinlichkeit ermittelt, mit der eine Person, gegenüber einem bestimmten Expositionsfaktor in einem festgelegten Beobachtungszeitraum an Cholera erkrankt (Ressing et al. 2010). Mögliche Risikofaktoren, die von der Forschung zu berücksichtigen sind, sind in Hinblick auf Cholera, die Ingestion von Wasser aus verschiedenen Quellen, wie stehenden Gewässern oder Fließgewässern. Aus den Ergebnissen könnten Verhaltensweisen für das beschriebene Szenar „Blackout“ in Hinblick auf die Cholera-Prophylaxe getroffen werden. Ein wesentlicher Vorteil dieses Forschungsansatzes ist, dass er im Vergleich zur Kohortenstudie zeit- und kostensparend ist und sich eine Vielzahl an Expositionen bzw. Risikofaktoren verhältnismäßig einfach identifizieren lassen. Aufgrund der retrospektiven Betrachtungsweise ist eine Ermittlung von Risikofaktoren schnell möglich. Der große Vorteil dieser Methode liegt allerdings darin, dass anhand von Cholera-Ausbrüchen der letzten Jahre bereits vor dem Szenario-Eintritt Risikofaktoren erhoben werden können. Einen Nachteil stellt die Gefahr der Verzerrung (Bias) dar, welche gerade bei schlechter Studienplanung zunehmend steigt. (Hammer et al. 2009) Durch die falschen Zuordnungen von Fall- und Kontrollgruppen besteht gerade bei mildem Krankheitsverlauf oder in Folge einer Multimorbidität in Hinblick auf die verschiedenen Erkrankungen mit ähnlichen Symptomatiken die Gefahr der Verfälschung. Ein weiterer Nachteil ist, dass sich das relative Risiko durch die Fall-Kontroll-Studie nicht wie bei der Kohortenstudie genau errechnen lässt, sondern nur über die Odds Ratio geschätzt werden kann (Scheidt-Nave 2001).
Im Sinne der Public Health können die beschriebenen Gesundheitsrisiken durch verschiedene Maßnahmen verringert oder gar verhindert werden.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zweck dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Schlüsselthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter enthält.
Was beinhaltet das Inhaltsverzeichnis?
Das Inhaltsverzeichnis listet die folgenden Kapitel auf: Psychosoziale Notfallvorsorge, Public Health, Planung, Organisation und Standards der Gesundheitsvorsorge in der internationalen humanitären Hilfe, Vorsorge und Krisenmanagement der medizinischen Versorgung, Fazit.
Welche Abkürzungen werden im Dokument verwendet?
Das Dokument listet folgende Abkürzungen auf: CBRN, GO, IKRK, KAEP, KRITIS, MANV, NGO, PSNV, RD, SEG.
Was ist Psychosoziale Notfallvorsorge (PSNV)?
PSNV wird im ersten Kapitel detailliert behandelt und beinhaltet die Grundzüge und den Bedarf an psychosozialer Unterstützung in Notfallsituationen.
Welche Belastungsfaktoren können Betroffene in Notfallsituationen ausgesetzt sein?
Das Dokument unterteilt Belastungsfaktoren in interne und externe physiologische sowie sozial- und individualpsychologische Faktoren.
Welche Rolle spielen Moderatorvariablen bei der Bewältigung von belastenden Ereignissen?
Moderatorvariablen, sowohl Risiko- als auch Schutzvariablen, beeinflussen, ob ein Ereignis zu psychosozialen oder krankheitswertigen Folgen führt.
Was sind einige protektive Variablen, die die Resilienz erhöhen?
Funktionale Coping-Strategien, ein stabiles soziales Netzwerk, Vorerfahrungen mit Notsituationen, eine starke psychische Struktur, gute körperliche Konstitution und ein gehobener Bildungsstand tragen zur Resilienz bei.
Was sind einige Risikovariablen, die die Anfälligkeit für Belastungen erhöhen?
Ein niedriger soziökonomischer Status, Alkoholmissbrauch, ein defizitärer sozialer Rückhalt oder negative Erfahrungen im privaten Umfeld erhöhen das Risiko für psychosoziale Folgen.
Was beinhaltet die Public Health Betrachtung in diesem Dokument?
Das Dokument untersucht die Auswirkungen eines Blackouts auf die Gesundheitsversorgung und die potenziellen gesundheitlichen Risiken, die durch den Zusammenbruch der Infrastruktur entstehen können, wie z.B. die Ausbreitung von Infektionskrankheiten.
Welche Gesundheitsrisiken werden im Zusammenhang mit einem Blackout genannt?
Genannt werden unter anderem die Gefahr von bakteriellen Erkrankungen durch verunreinigtes Wasser, die Zunahme von Schädlingen, das Risiko von Zoonosen und die Übertragung von Infektionskrankheiten in Notunterkünften.
Wie wird deskriptive Epidemiologie im Dokument angewendet?
Die Grundzüge der deskriptiven Epidemiologie werden am Beispiel der Cholera im Kontext eines Blackouts für den Landkreis Landsberg am Lech erläutert.
Welche epidemiologischen Studien werden zur Risikobewertung vorgeschlagen?
Die retrospektive Fall-Kontrollstudie wird zur Ermittlung von Risikofaktoren für Cholera vorgeschlagen.
- Citation du texte
- Julian Schedel (Auteur), 2020, Medizinische Katastrophenvorsorge. Gesundheitsvorsorge im Kontext internationaler humanitärer Hilfe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/987602