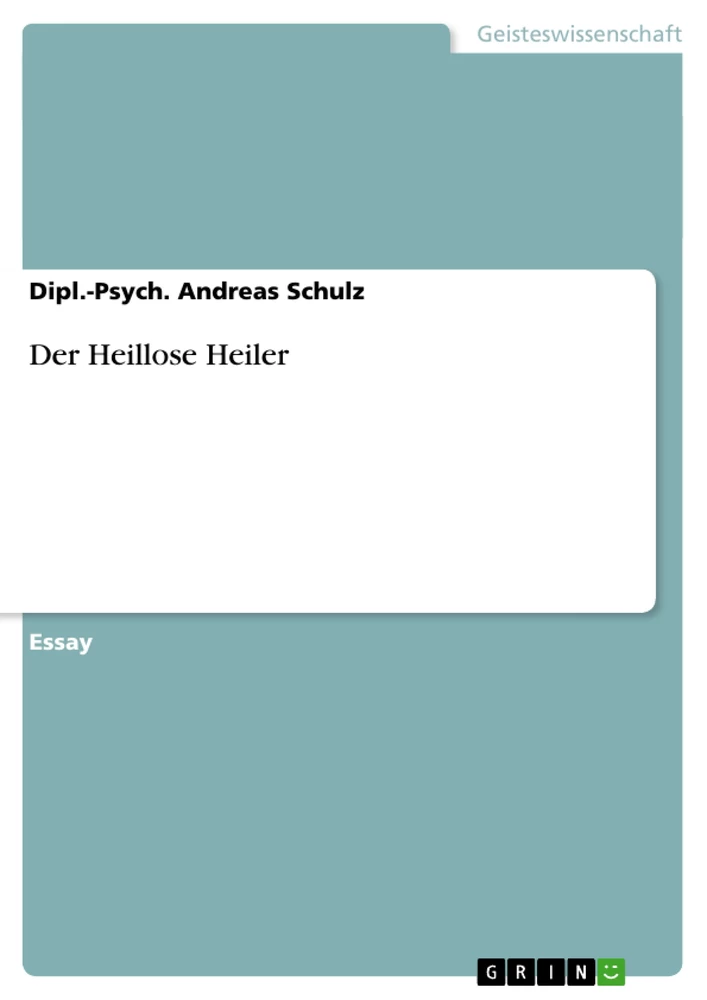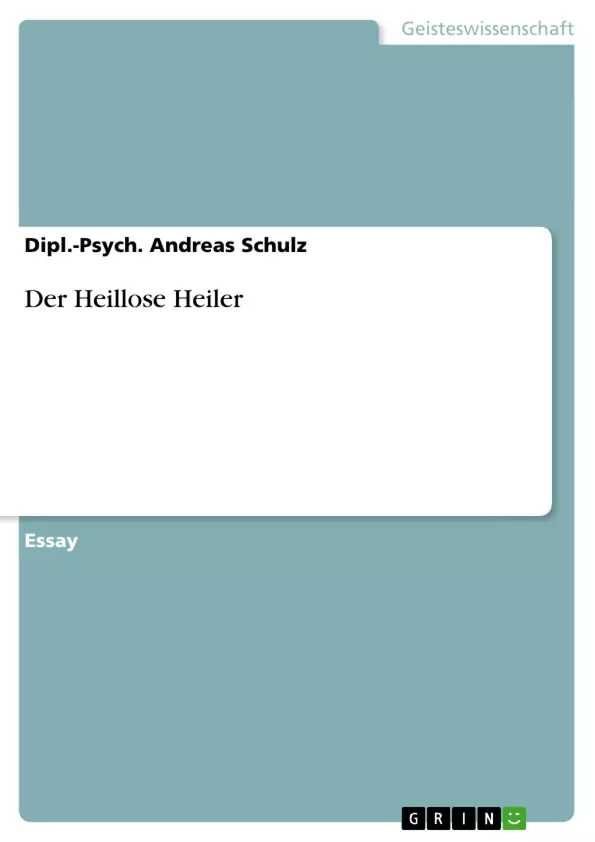Im Rahmen der Ausbildung zum Psychotherapeuten oder Paar- und Familienberater(in) bedarf es einer intensiven Auseinandersetzung mit der eigenen Person. Dieser Text setzt sich mit Selbstbildern von frisch ausgebildeten Psychotherapeuten und Beratern/ Beraterinnen auseinander. Der Text beruht auf einem Vortrag in der Fachhochule Fulde in einem Seminar über Kommunikation(1984)D
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Heilen gehört zum Selbstverständnis Psychologischer Psychotherapeuten.
- Heilen: Ich weiß nicht, was heilen objektiv bedeutet.
- Das eigene Leben: Ich spreche von mir, aber wie soll ich andere heilen, wenn ich heilen nicht an mir und in mir erlebt habe?
- Wissen um die Geschichten des Lebens: Wenn ich andere heilen soll, so heißt dies für mich erst einmal, ihre Geschichte kennenlernen.
- Sich berühren lassen: Die Suchenden suchen einen Menschen, dem sie sich anvertrauen können, nicht in erster Linie einen Psychologen oder einen Sozialarbeiter.
- Die Geschichte vom Umhang
- Schlecht beraten bin ich, wenn ich mich auf fremde Geschichten verlasse. Mein Leben ist erst einmal mein Leben.
- Der ängstliche Heillose Heiler: Der Heillose Heiler vertraut auf die Heilsprüche anderer, während der Geschichtenerzähler auf Suche ging und eine neue Geschichte erlebte, verlässt sich der Heillose Heiler auf die Weisheiten anderer.
- Zaubertränke: Wachsam ängstlich schaut der Heillose Heiler, der sich nicht kennt, um.
- Das Melonenfeld
- Soviel zum Unterschied zwischen dem Heillosen Heiler und dem hilfreichen Trickser Der hilfreiche Trickser kennt die Hintergründe seiner Geschichte und der Geschichte der anderen.
- Wo endet nun der Heillose Helfer? Saadi, ein persischer Mystiker, sagt:
- Der Heiler, der sich seiner Geschichte stellt, handelt anders.
- Die Geschichte vom Zucker
- Für mich war diese Geschichte u.a. ein Hinweis dar auf was persönliche Autorität bedeutet: nicht Macht aus einer äußerlichen Position heraus sondern Wissen aus eigener Erfahrung.
- Eine ähnliche Geschichte ist die vom Dattelesser:
- Der Dattelesser
- Mir gefällt der Umgang Nasrudins mit dem Jungen besser, denn er lässt ihn weiterhin Zucker essen. In dieser Geschichte kommt ein anderer Aspekt hinzu: nicht nur selber erkennen muss der Rat Gebende, auch den nötigen Abstand zu sich und seinen Handlungen muss er haben.
- Soweit über Heiler und ihre Selbstheilung, ihr Kennen ihrer Geschichte.
- Geschichten heilen: Geschichten lassen sich auf unterschiedliche Art beim Heilen verwenden.
- Die Traumfrau
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Konzept der Heilung aus der Perspektive eines Psychologischen Psychotherapeuten. Der Autor reflektiert seine eigene Reise als Heiler und hinterfragt die Rolle des Therapeuten in der Beziehung zum Klienten. Der Fokus liegt dabei auf der Bedeutung der eigenen Geschichte, der Selbstheilung und dem Umgang mit den Geschichten anderer.
- Die Bedeutung der Selbstheilung für den Heiler
- Die Rolle der Geschichten im Heilungsprozess
- Der Unterschied zwischen dem heillosen Heiler und dem hilfreichen Trickser
- Die Bedeutung von persönlicher Autorität und Erfahrung
- Die Grenzen der therapeutischen Intervention
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Autor stellt die Grundidee des Textes vor, die sich mit der Frage beschäftigt, was es bedeutet, zu heilen und welche Voraussetzungen ein Heiler braucht, um heilen zu können.
- Heilen: Der Autor definiert Heilen aus seiner eigenen Perspektive als Selbstheilung, die sich durch die Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen, der Vergangenheit und dem Wachstum durch Begegnungen mit anderen Menschen vollzieht.
- Das eigene Leben: Der Autor betont, dass es notwendig ist, die eigene Geschichte und die eigene Heilung zu erleben, um anderen Menschen helfen zu können.
- Wissen um die Geschichten des Lebens: Der Autor erklärt, dass das Kennenlernen der Geschichte des Klienten ein wichtiger Bestandteil des Heilungsprozesses ist. Er betont die Notwendigkeit, die Geschichte des anderen aufmerksam und mit Empathie anzuhören.
- Sich berühren lassen: Der Autor betont die Wichtigkeit, sich als Therapeut von den Geschichten der Klienten berühren zu lassen und die eigene Geschichte nicht zu vergessen.
- Die Geschichte vom Umhang: Der Autor präsentiert eine chassidische Geschichte über eine Frau, die einen Umhang als Opfergabe anbietet, um einen Sohn zu bekommen. Die Geschichte soll den Leser auf die Bedeutung der eigenen Geschichte und die Grenzen des Einflusses auf das Leben anderer aufmerksam machen.
- Schlecht beraten bin ich, wenn ich mich auf fremde Geschichten verlasse. Mein Leben ist erst einmal mein Leben: Der Autor betont die Bedeutung der eigenen Geschichte und der eigenen Heilung für den Heilungsprozess.
- Der ängstliche Heillose Heiler: Der Autor beschreibt den "heillosen Heiler", der sich auf die Heilmethoden anderer verlässt und seine eigene Geschichte ignoriert.
- Zaubertränke: Der Autor kritisiert die Überzeugung des "heillosen Heilers", dass er durch seine Ausbildung und seine Methoden in der Lage sei, andere zu heilen.
- Das Melonenfeld: Der Autor erzählt eine Geschichte über einen Mann, der in das Land der Narren kommt und die Angst der Menschen vor einer Wassermelone nicht versteht. Die Geschichte soll den Unterschied zwischen dem "heillosen Heiler" und dem "hilfreichen Trickser" verdeutlichen.
- Soviel zum Unterschied zwischen dem Heillosen Heiler und dem hilfreichen Trickser Der hilfreiche Trickser kennt die Hintergründe seiner Geschichte und der Geschichte der anderen: Der Autor fasst die Unterschiede zwischen dem "heillosen Heiler" und dem "hilfreichen Trickser" zusammen.
- Wo endet nun der Heillose Helfer? Saadi, ein persischer Mystiker, sagt: Der Autor zitiert ein Sprichwort, das den "heillosen Heiler" als jemanden darstellt, der sich selbst in der Rolle des Helfers verliert.
- Der Heiler, der sich seiner Geschichte stellt, handelt anders: Der Autor betont, dass der Heiler, der seine eigene Geschichte annimmt und verarbeitet, anders handelt als der "heillose Heiler".
- Die Geschichte vom Zucker: Der Autor erzählt eine Geschichte über Nasrudin, der einem Jungen verbietet, zu viel Zucker zu essen, nachdem er sich selbst erst seinen eigenen Zuckerkonsum eingeschränkt hat. Die Geschichte soll die Bedeutung von eigener Erfahrung und persönlicher Autorität im Heilungsprozess verdeutlichen.
- Eine ähnliche Geschichte ist die vom Dattelesser: Der Autor erzählt eine Geschichte über Ali, der einem Jungen verbietet, zu viele Datteln zu essen, nachdem er selbst die Süße der Datteln gekostet hat. Die Geschichte soll die Bedeutung des eigenen Erlebens und des Abstands zum eigenen Handeln im Heilungsprozess verdeutlichen.
- Mir gefällt der Umgang Nasrudins mit dem Jungen besser, denn er lässt ihn weiterhin Zucker essen. In dieser Geschichte kommt ein anderer Aspekt hinzu: nicht nur selber erkennen muss der Rat Gebende, auch den nötigen Abstand zu sich und seinen Handlungen muss er haben: Der Autor erklärt, warum ihm die Geschichte von Nasrudin besser gefällt als die Geschichte von Ali.
- Soweit über Heiler und ihre Selbstheilung, ihr Kennen ihrer Geschichte: Der Autor fasst den bisher behandelten Teil des Textes über die Bedeutung der Selbstheilung und die Rolle der Geschichte im Heilungsprozess zusammen.
- Geschichten heilen: Geschichten lassen sich auf unterschiedliche Art beim Heilen verwenden: Der Autor erklärt, dass Geschichten auf unterschiedliche Weise im Heilungsprozess eingesetzt werden können.
- Die Traumfrau: Der Autor erzählt eine Geschichte über einen Mann, der sein Versprechen, sich nach dem Tod seiner Frau nicht mit einer anderen Frau einzulassen, bricht. Die Geschichte soll die Bedeutung der Loslösung von einer ehelichen Symbiose und die Rolle des Therapeuten als "Trickser" verdeutlichen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes sind die Rolle des Heilers, die Bedeutung der eigenen Geschichte, die Selbstheilung, die Geschichte als Werkzeug im Heilungsprozess, der Umgang mit Klienten und die Grenzen therapeutischer Intervention. Wichtige Konzepte sind der "heillose Heiler", der "hilfreiche Trickser", die persönliche Autorität und das Erleben eigener Erfahrungen im Heilungsprozess. Der Text bezieht sich auf verschiedene Geschichten und Beispiele aus unterschiedlichen Kulturen, darunter chassidische Geschichten, Geschichten aus 1001 Nacht und Geschichten über Nasrudin.
- Citar trabajo
- Dipl.-Psych. Andreas Schulz (Autor), 2011, Der Heillose Heiler, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/98796