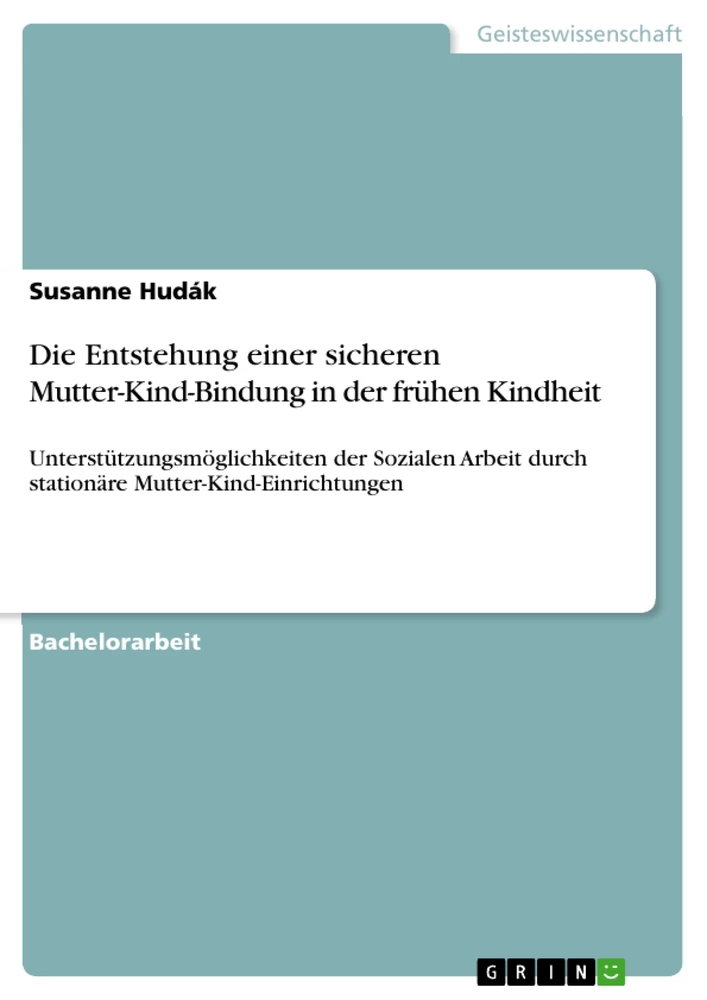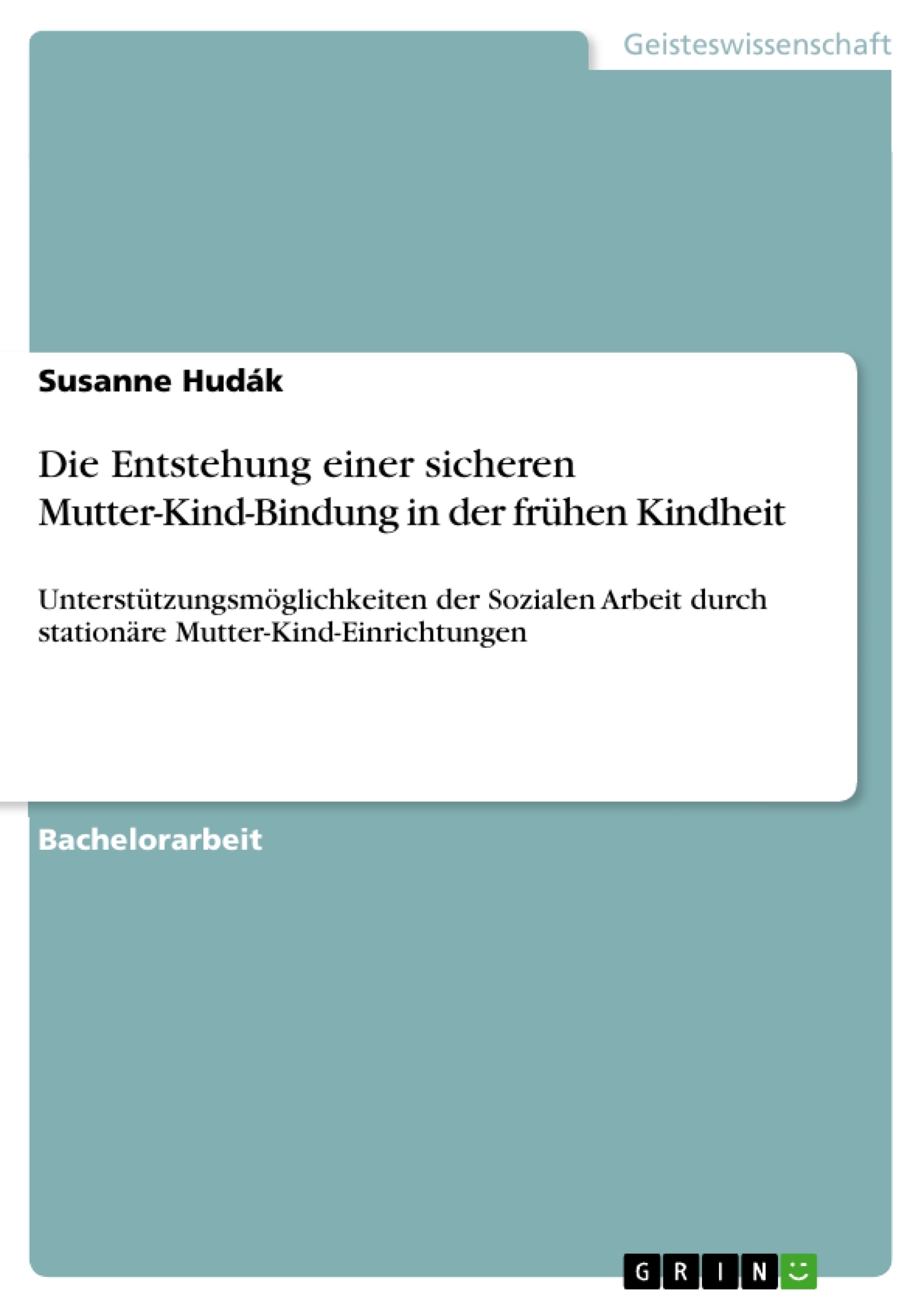Wie kann die Soziale Arbeit zur Entwicklung einer sicheren Mutter-Kind-Bindung im Kontext stationärer Mutter-Kind-Einrichtungen beitragen? Um dies klären zu können, wird zunächst die Bindungstheorie erläutert und dabei auf die untergeordnete Fragestellung dieser Arbeit eingegangen, welche Faktoren eine sichere Bindungsbeziehung zwischen Mutter und Kind beeinflussen. Anschließend werden die Folgen unsicherer Bindungsmuster in der frühen Kindheit benannt. Das Aufgabenspektrum sowie gesetzliche Grundlagen stationärer Mutter-Kind-Einrichtungen werden im nächsten Schritt vorgestellt und abschließend folgt der Kernpunkt dieser Arbeit: Es werden Möglichkeiten beleuchtet, wie die Soziale Arbeit die Entstehung einer sicheren Mutter-Kind-Bindung im Rahmen stationärer Mutter-Kind-Einrichtungen unterstützen kann.
Die Gestaltung der Arbeitsbeziehung zwischen Fachkraft und Klientin und die Auseinandersetzung mit bereits vorhandenen Interventionsprogrammen dienen als theoretische Vorüberlegungen, die in einem von der Autorin entwickelten, theoretischen Konzept münden. Dieses Konzept, welches als Basis die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Bindungstheorie nutzt, stellt einen Entwurf für die Umsetzung in stationären Mutter-Kind-Einrichtungen dar.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Mütter ihr eigenes Bindungsmuster an ihre Kinder weitergeben, liegt bei bis zu 85 %. Da bei unsicheren Bindungsstilen nachhaltige Folgen wie emotionale oder soziale Störungen nicht selten vorkommen, ist der Anteil an unsicher gebundenen Mutter-Kind-Dyaden in klinischen und sozialen Arbeitsbereichen dementsprechend hoch. Wenn die Beziehung der Dyade schwerwiegend gestört ist und die Versorgung des Kindes nicht mehr sichergestellt werden kann, ist eine Trennung oftmals unumgänglich. In solchen Fällen müssen die betroffenen Kinder außerhäuslich untergebracht werden. 2016 gab es in Deutschland rund 230000 Kinder, die in Pflegefamilien, Kinderheimen oder sonstigen betreuten Wohnformen untergebracht werden mussten. Eine Hilfeleistung in Form einer stationären Mutter-Kind-Einrichtung kann die Möglichkeit bieten, eine Trennung zu vermeiden und die Mütter beim Aufbau einer sicheren Bindung zu ihrem Kind zu unterstützen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Bindung zwischen Mutter und Kind
- Bindungstheorie
- Determinanten einer sicheren Mutter-Kind-Bindung
- Folgen unsicherer Bindungsbeziehungen im frühen Kindesalter
- Stationäre Mutter-Kind-Einrichtungen
- Rechtliche Grundlagen
- Auftrag und Leistungsspektrum
- Einflussmöglichkeiten der Sozialen Arbeit auf die Mutter-Kind-Bindung
- Arbeitsbeziehung zwischen Bezugsbetreuerin und Klientin
- Handlungsoptionen
- Vorhandene Programme
- Konzeptualisierung in stationären Mutter-Kind-Einrichtungen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entstehung einer sicheren Mutter-Kind-Bindung in der frühen Kindheit und beleuchtet die Rolle der Sozialen Arbeit in stationären Mutter-Kind-Einrichtungen. Ziel ist es, die Unterstützungsmöglichkeiten durch die Soziale Arbeit in diesem Kontext zu analysieren und konkrete Handlungsansätze aufzuzeigen.
- Die Bindungstheorie und ihre Relevanz für die Mutter-Kind-Beziehung
- Faktoren, die eine sichere Bindungsbeziehung zwischen Mutter und Kind beeinflussen
- Folgen unsicherer Bindungsbeziehungen in der frühen Kindheit
- Aufgaben und Leistungen stationärer Mutter-Kind-Einrichtungen
- Möglichkeiten der Sozialen Arbeit zur Unterstützung der Mutter-Kind-Bindung in stationären Einrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz einer sicheren Mutter-Kind-Bindung für die Entwicklung des Kindes heraus und erläutert die Notwendigkeit, Mütter in diesem Prozess zu unterstützen. Das zweite Kapitel widmet sich der Bindungstheorie, untersucht die Determinanten einer sicheren Mutter-Kind-Bindung und beschreibt die Folgen unsicherer Bindungsbeziehungen. Im dritten Kapitel werden stationäre Mutter-Kind-Einrichtungen im Hinblick auf ihre rechtlichen Grundlagen, ihren Auftrag und ihr Leistungsspektrum beleuchtet. Das vierte Kapitel fokussiert auf die Einflussmöglichkeiten der Sozialen Arbeit auf die Mutter-Kind-Bindung in stationären Einrichtungen. Hier werden die Arbeitsbeziehung zwischen Bezugsbetreuerin und Klientin sowie konkrete Handlungsoptionen und Interventionsprogramme untersucht.
Schlüsselwörter
Mutter-Kind-Bindung, Bindungstheorie, Soziale Arbeit, stationäre Mutter-Kind-Einrichtungen, Interventionsprogramme, sichere Bindung, unsichere Bindung, Unterstützungsmöglichkeiten.
- Quote paper
- Susanne Hudák (Author), 2019, Die Entstehung einer sicheren Mutter-Kind-Bindung in der frühen Kindheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/988208