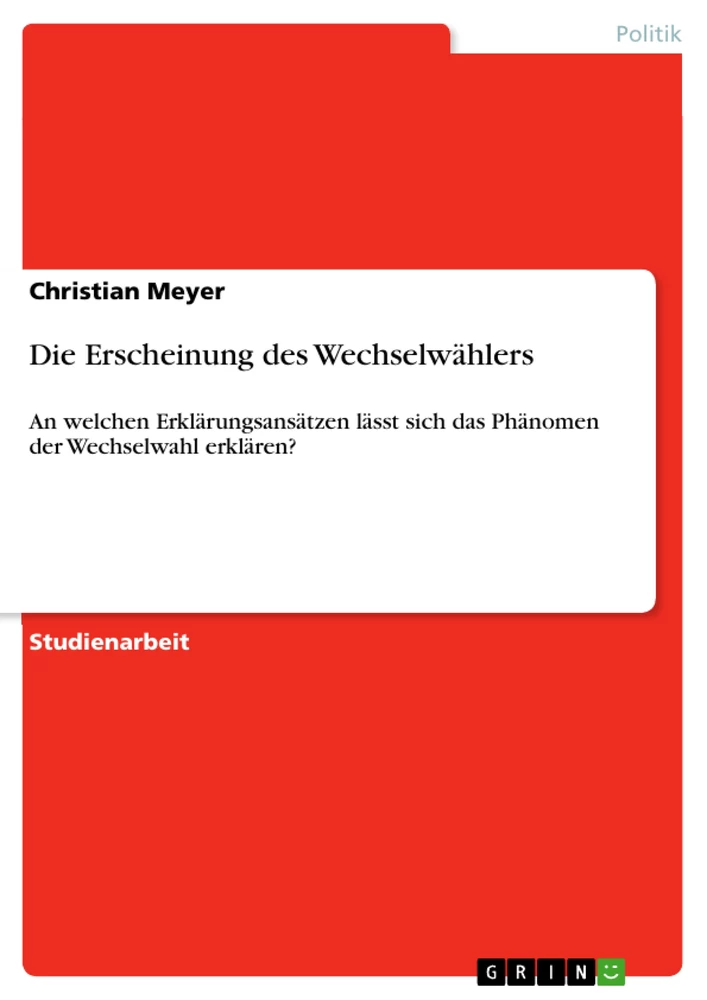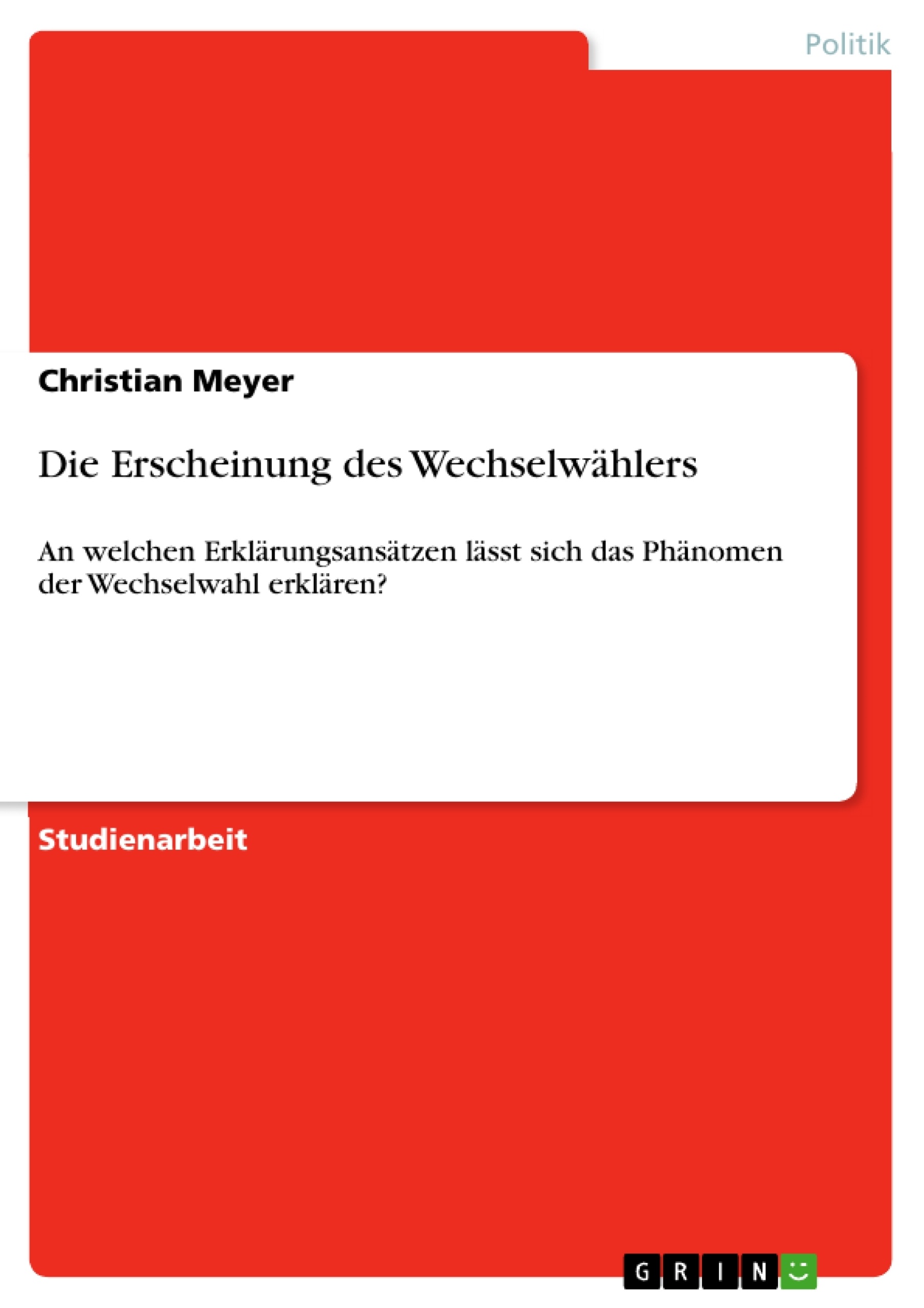Die vorliegende Analyse untersucht, unter welchen Bedingungen von einer Wechselwahl gesprochen wird und inwiefern ein Wechselwähler genauer zu definieren ist. Um dies zu ermöglichen, wird auf drei voneinander abweichende Typologien von Max Kaase zurückgegriffen, die den Begriff „Wechselwähler“ enger definiert und dadurch plastischer gestaltet.
Die Volatilität der Wähler wird unter einzelnen Beispielen erläutert, sodass die Schwankungen bezüglich der Parteibindungen sichtbar werden. Hierzu werden zwei Beispiele der zurückliegenden Bundestagswahlen 2013 und 2017 herangezogen, um die abweichenden Stimmanteile zu verdeutlichen.
Es ist vorwegzugreifen, dass keine umfassende Theorie angewandt werden kann, sondern lediglich auf unterschiedliche Forschungsdesigns zurückgegriffen wird, die im Rahmen der Politikwissenschaft ausgearbeitet wurden. Auf deren Grundlage sollen dem Leser die wichtigsten Erkenntnisse nähergebracht werden, um ein unterschiedliches Wahlergebnis zu begründen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wählerwanderung
- Begriffserklärung: Wie definiert sich der Wechselwähler?
- Erklärungsansätze des Wahlverhaltens
- Soziologischer Erklärungsansatz
- Mikrosoziologischer Ansatz
- Makrosoziologischer Ansatz
- Ann-Arbor-Modell
- Rational-Choice-Ansatz
- Soziologischer Erklärungsansatz
- Grenzen der Erklärungsansätze
- Soziologischer Ansatz
- Ann-Arbour-Modell
- Rational Choice Ansatz
- Zunahme der Volatilität und zeitliche Abnahme von Parteipräferenzen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit dem Phänomen der Wechselwahl und untersucht, warum es zu einem sprunghaften Wahlverhalten der Wählerschaft kommt. Im Zentrum der Analyse stehen die Wähler, die bei aufeinanderfolgenden Wahlterminen eine andere Partei wählen.
- Definition des Wechselwählers
- Typologien von Max Kaase zur Unterscheidung von Wechselwählern
- Analyse der Volatilität des Wahlverhaltens anhand von Beispielen
- Erklärungsansätze für Wahlverhalten in der Politikwissenschaft
- Grenzen der Erklärungsansätze
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema Wechselwahl ein und erläutert die Bedeutung von Wahlentscheidungen in einer Demokratie. Sie stellt die Forschungsfrage der Hausarbeit und den Fokus auf das wechselhafte Wahlverhalten der Wählerschaft dar.
- Das Kapitel "Wählerwanderung" definiert den Begriff des Wechselwählers und stellt die verschiedenen Typologien von Max Kaase vor, die das Wechselwählerprofil genauer differenzieren.
- Im Kapitel "Erklärungsansätze des Wahlverhaltens" werden drei Ansätze aus der politikwissenschaftlichen Wahlforschung vorgestellt: der soziologische Ansatz, der Rational-Choice-Ansatz und der sozialpsychologische Ansatz.
- Das Kapitel "Grenzen der Erklärungsansätze" beleuchtet die Grenzen der vorgestellten Ansätze in Bezug auf die Erklärung des Wechselwahlverhaltens.
- Das Kapitel "Zunahme der Volatilität und zeitliche Abnahme von Parteipräferenzen" behandelt die steigende Volatilität des Wahlverhaltens und die Abnahme von Parteipräferenzen im Laufe der Zeit.
Schlüsselwörter
Wechselwahl, Wechselwähler, Wahlverhalten, Volatilität, Parteipräferenz, Soziologischer Ansatz, Rational-Choice-Ansatz, Politikwissenschaft, Demokratie, Wahlentscheidung.
Häufig gestellte Fragen
Was definiert einen Wechselwähler?
Ein Wechselwähler ist eine Person, die bei aufeinanderfolgenden Wahlen für unterschiedliche Parteien stimmt oder zwischen Wahlbeteiligung und Nichtwahl schwankt.
Was ist das Ann-Arbor-Modell?
Dies ist ein sozialpsychologischer Ansatz, der die langfristige Parteidentifikation als wichtigsten Faktor für das Wahlverhalten ansieht, ergänzt durch kurzfristige Faktoren wie Kandidaten oder aktuelle Themen.
Warum nimmt die Volatilität bei Wahlen zu?
Gründe sind die abnehmende Bindung an soziale Milieus (Entkirchlichung, Auflösung der Arbeitermilieus) und eine generelle Abnahme der langfristigen Parteipräferenzen.
Was besagt der Rational-Choice-Ansatz?
Wähler entscheiden sich wie ein 'Homo Oeconomicus' für die Partei, von deren Programm sie sich den größten persönlichen Nutzen oder die beste Lösung für aktuelle Probleme versprechen.
Was sind die Typologien nach Max Kaase?
Max Kaase unterscheidet verschiedene Formen der Wechselwahl, um das Phänomen plastischer darzustellen, wobei er zwischen engen Definitionen (Parteiwechsel) und weiteren Definitionen (inkl. Nichtwahl) differenziert.
- Quote paper
- Christian Meyer (Author), 2019, Die Erscheinung des Wechselwählers, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/988372