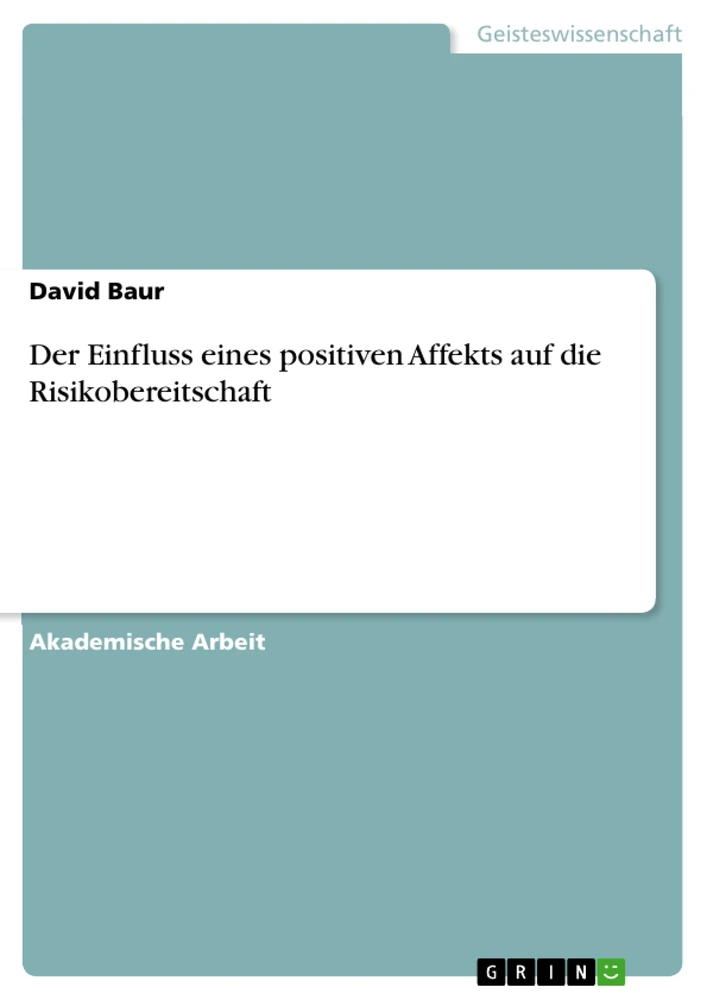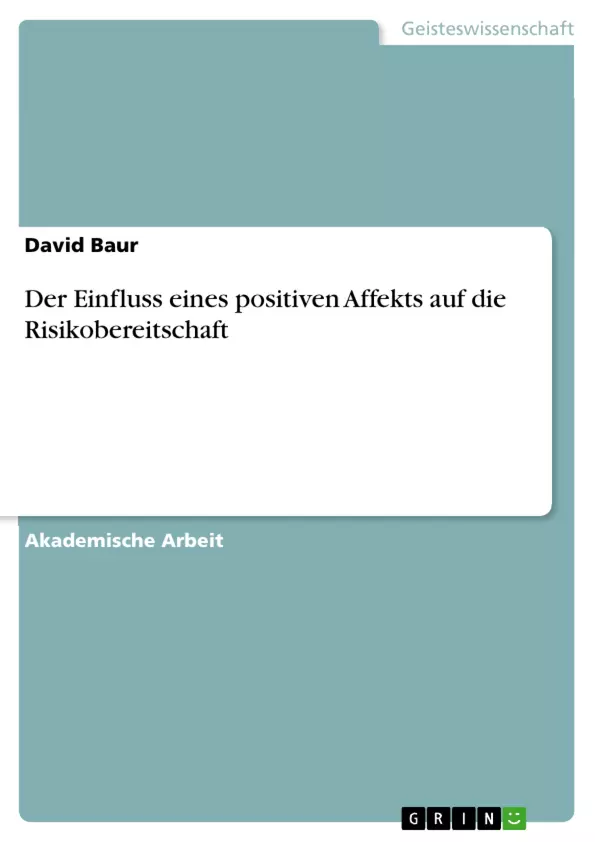In dieser Arbeit sollen folglich neben persönlichen Eigenschaften wie dem Alter oder dem jeweiligen Kontext, der Einfluss des Affekts auf die Risikobereitschaft untersucht werden. Hierzu erfolgen zunächst einige theoretische Erläuterungen zu den relevanten Begrifflichkeiten und Modellen. In Kapitel 3 wird das methodische Vorgehen erklärt. Kapitel 4 präsentiert anschließend die Ergebnisse der durchgeführten online-Befragung. Abschließend erfolgt in Kapitel 5 eine Analyse der durchgeführten Studie, in der die gefundenen Ergebnisse diskutiert und limitiert werden.
Die Risikobereitschaft wird von einer Vielzahl an Faktoren beeinflusst. Ob bewusst oder nicht, ziehen unterschiedliche Tendenzen im Umgang mit Unsicherheiten zahlreiche Konsequenzen nach sich. Das Ziel dieser Untersuchung ist es, drei Faktoren zu analysieren, die möglicherweise eine Beeinflussung der Risikobereitschaft zur Folge haben. Hierzu wurden insgesamt 133 Probanden untersucht und randomisiert einer Primingaufgabe unterzogen oder der Kontrollgruppe zugewiesen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Hintergrund
- 2.1 Risikobereitschaft
- 2.1.1 Persönlichkeit
- 2.1.2 Kontext
- 2.1.3 Stimmung
- 2.2 Priming
- 2.3 Positiver Affekt
- 2.4 Affekt-Priming-Model
- 2.5 Mood-as-Information Model
- 2.6 Affect-Infusion-Model
- 2.7 Forschungsstand und Ableitung der Forschungsfragen/-hypothesen
- 2.1 Risikobereitschaft
- 3 Methode
- 3.1 Stichprobe
- 3.2 Untersuchungsdesign
- 3.3 Untersuchungsdurchführung
- 3.4 Erhebungsinstrumente und —material
- 3.4.1 Positives Priming und Kontrollfrage
- 3.4.2 Dospert-G
- 3.4.3 R1-Risikoskala
- 3.4.4 Soziodemografische Daten
- 3.5 Datenaufbereitung und statistische Verfahren
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Deskriptivstatistische Auswertung
- 4.2 Inferenzstatistische Auswertung
- 4.2.1 Ergebnisse zur H1
- 4.2.2 Ergebnisse zur H2
- 4.2.3 Ergebnisse zur H3
- 5 Diskussion
- 5.1 Diskussion der Studienergebnisse
- 5.2 Limitationen dieser Studie
- 5.3 Implikationen für die zukünftige Forschung
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss eines positiven Affekts auf die Risikobereitschaft. Ziel ist die Analyse von Faktoren, die die Risikobereitschaft beeinflussen, mittels einer Online-Befragung von 133 Probanden. Es werden der Einfluss von induziertem positivem Affekt, das Alter und die Führungsposition betrachtet.
- Einfluss des positiven Affekts auf die Risikobereitschaft
- Korrelation zwischen Alter und Risikobereitschaft
- Unterschiedliche Risikobereitschaft bei Führungskräften mit und ohne Personalverantwortung sowie bei Nicht-Führungskräften
- Analyse verschiedener Modelle zur Erklärung des Zusammenhangs von Affekt und Risikobereitschaft (Affekt-Priming-Model, Mood-as-Information Model, Affect-Infusion-Model)
- Methodische Vorgehensweise und Limitationen der Studie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Risikobereitschaft ein und beschreibt, dass diese nicht nur von individuellen Persönlichkeitsmerkmalen abhängt, sondern auch von oft unbewusst wahrgenommenen Kontextfaktoren beeinflusst wird. Sie hebt die Bedeutung der Erforschung solcher Effekte hervor und nennt ein Beispiel, in dem die Höhe des Stockwerks den Risikobereich von Managern beeinflusst, obwohl dieser eigentlich keinen Zusammenhang haben sollte. Die Arbeit konzentriert sich auf den Einfluss des Affekts, des Alters und der Führungsposition auf die Risikobereitschaft. Es wird die Struktur der Arbeit skizziert: Theoretischer Hintergrund, Methode, Ergebnisse und Diskussion.
2 Theoretischer Hintergrund: Dieses Kapitel liefert den theoretischen Rahmen für die Untersuchung. Es werden die Konzepte Risikobereitschaft (unter Berücksichtigung von Persönlichkeit, Kontext und Stimmung), Priming, positiver Affekt sowie relevante Modelle wie das Affekt-Priming-Model, das Mood-as-Information Model und das Affect-Infusion-Model erläutert. Es werden bereits bestehende Forschungsarbeiten zum Thema zusammengefasst und daraus die Forschungsfragen und Hypothesen abgeleitet, die im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht werden. Das Kapitel dient der Begründung der gewählten Forschungsmethodik und der Formulierung überprüfbarer Hypothesen.
3 Methode: Das Kapitel beschreibt detailliert die methodische Vorgehensweise der Studie. Es wird die Stichprobengröße und -zusammensetzung (133 Probanden) erläutert sowie das Untersuchungsdesign, die Durchführung der Online-Befragung und die verwendeten Erhebungsinstrumente (positives Priming, Kontrollfrage, Dospert-G, R1-Risikoskala, soziodemografische Daten) vorgestellt. Die Datenaufbereitung und die angewandten statistischen Verfahren werden ebenfalls detailliert beschrieben. Der Fokus liegt auf der Transparenz und Reproduzierbarkeit der Studie.
4 Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Online-Befragung. Es werden sowohl deskriptive als auch inferenzstatistische Auswertungen vorgestellt. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die im theoretischen Hintergrund formulierten Hypothesen interpretiert. Es werden die Ergebnisse zu den Einflüssen von positivem Affekt, Alter und Führungsposition auf die Risikobereitschaft detailliert dargestellt und gegebenenfalls mit Tabellen visualisiert.
5 Diskussion: Die Diskussion analysiert die Ergebnisse der Studie kritisch. Die gefundenen Ergebnisse werden in Bezug auf die theoretischen Modelle und den Forschungsstand diskutiert und interpretiert. Es werden Limitationen der Studie aufgezeigt und der Einfluss dieser Limitationen auf die Gültigkeit der Ergebnisse betrachtet. Abschließend werden Implikationen für die zukünftige Forschung abgeleitet und mögliche Forschungsansätze aufgezeigt, die die vorliegende Studie ergänzen oder erweitern könnten.
Schlüsselwörter
Risikobereitschaft, positiver Affekt, Priming, Alter, Führungsposition, Online-Befragung, Dospert-G, R1-Risikoskala, Affekt-Priming-Model, Mood-as-Information Model, Affect-Infusion-Model, statistische Auswertung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Einfluss des positiven Affekts auf die Risikobereitschaft
Was ist das Thema der Studie?
Die Studie untersucht den Einfluss eines positiven Affekts auf die Risikobereitschaft. Dabei werden Faktoren wie Alter und Führungsposition zusätzlich berücksichtigt.
Welche Methoden wurden verwendet?
Die Studie basiert auf einer Online-Befragung mit 133 Probanden. Es wurden verschiedene Erhebungsinstrumente eingesetzt, darunter ein positives Priming, eine Kontrollfrage, der Dospert-G, die R1-Risikoskala und Fragen zu soziodemografischen Daten. Die Daten wurden deskriptiv und inferenzstatistisch ausgewertet.
Welche theoretischen Modelle wurden betrachtet?
Die Studie stützt sich auf verschiedene Modelle zur Erklärung des Zusammenhangs zwischen Affekt und Risikobereitschaft, darunter das Affekt-Priming-Model, das Mood-as-Information Model und das Affect-Infusion-Model.
Welche Hypothesen wurden untersucht?
Die Studie untersucht den Einfluss des positiven Affekts auf die Risikobereitschaft, die Korrelation zwischen Alter und Risikobereitschaft sowie Unterschiede in der Risikobereitschaft zwischen Führungskräften (mit und ohne Personalverantwortung) und Nicht-Führungskräften.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Studie werden im Kapitel 4 detailliert dargestellt, inklusive deskriptiver und inferenzstatistischer Auswertungen. Die Ergebnisse beziehen sich auf die zuvor formulierten Hypothesen und werden durch Tabellen visualisiert (genaue Ergebnisse sind im Originaldokument nachzulesen).
Welche Limitationen weist die Studie auf?
Die Limitationen der Studie werden im Kapitel 5 kritisch diskutiert. Diese Einschränkungen betreffen die Gültigkeit der Ergebnisse und werden im Kontext des methodischen Vorgehens erläutert (genaue Limitationen sind im Originaldokument nachzulesen).
Welche Implikationen ergeben sich für zukünftige Forschung?
Kapitel 5 leitet aus den Ergebnissen und den Limitationen der Studie Implikationen für zukünftige Forschung ab. Es werden mögliche Forschungsansätze vorgeschlagen, die die vorliegende Studie ergänzen oder erweitern könnten (genaue Vorschläge sind im Originaldokument nachzulesen).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie?
Schlüsselwörter sind: Risikobereitschaft, positiver Affekt, Priming, Alter, Führungsposition, Online-Befragung, Dospert-G, R1-Risikoskala, Affekt-Priming-Model, Mood-as-Information Model, Affect-Infusion-Model, statistische Auswertung.
Wie ist die Studie strukturiert?
Die Studie ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Theoretischer Hintergrund, Methode, Ergebnisse, Diskussion und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Studie, beginnend mit der Einführung in das Thema und endend mit der Zusammenfassung der Ergebnisse und ihrer Interpretation.
- Quote paper
- David Baur (Author), 2020, Der Einfluss eines positiven Affekts auf die Risikobereitschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/988707