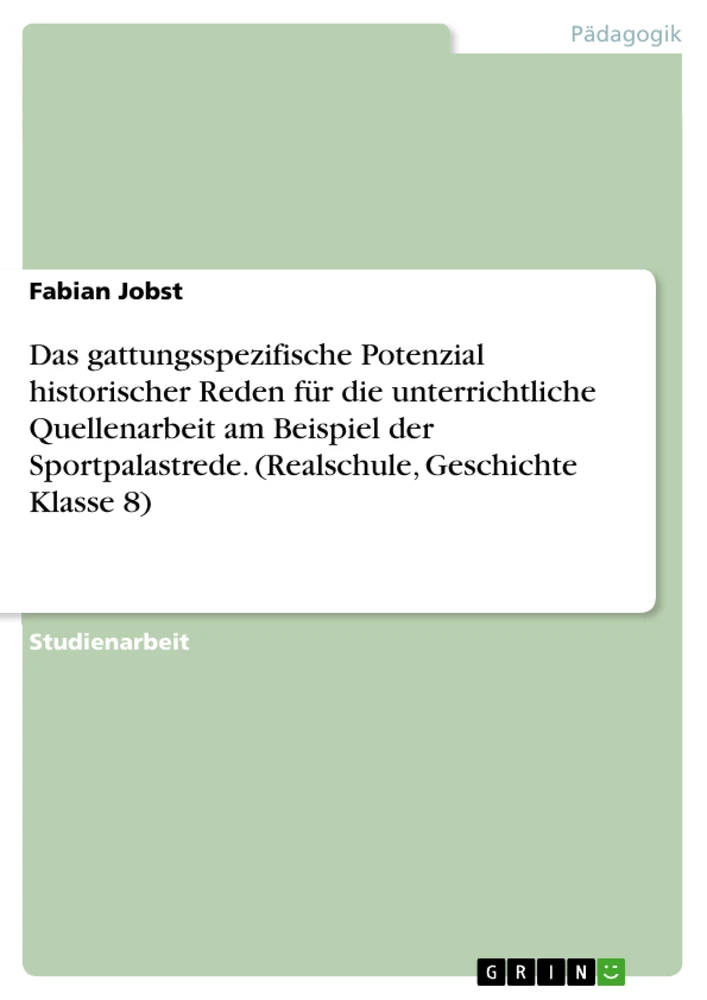In dieser Hausarbeit wird die "legendäre" Sportpalastrede aus geschichtsdidaktischer Perspektive analysiert und für den Geschichtsunterricht aufbereitet.
Der Begriff "Geschichte" bezweckt nicht nur die Beschreibung von etwas Vergangenem geschweige denn des Unterrichtsfaches, welches sich mit mehr oder minder weit zurückliegenden, die Menschheitsgeschichte prägenden Ereignissen, Werken, Personen oder ähnlichem beschäftigt. Das, was Geschichte - losgelöst von der Betrachtung als historisch-analysierende Disziplin - ist, ist die Erzählung. Wenn wir Kindern etwas erzählen, dann ist das immer eine Geschichte. Sowohl Baumgärtner als auch Barricelli verwenden die Bezeichnung "narrativ" beziehungsweise "Narrativität", womit sie den Quellen, um die es schließlich sowohl in der unterrichtlichen als auch in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Geschichte geht, die Intention des Erzählens/Vermittelns diagnostizieren, sie schaffen so gesehen die Symbiose aus dem Aspekt des Vergangenen, der Geschichte, und dem erzählenden Charakter der Informationsweitergabe durch Geschichten. Die Narration beschreibt allerdings nicht nur die bloße Berichterstattung über "Vergangenes", sondern drückt - wie Barricelli fordert - aus, "dass das aus der Vergangenheit Erwähnte […] mit Sinn […] versehen werden soll […]".
Inhaltsverzeichnis
- Fundament und Zielsetzung zugleich: Narrative Bewusstheit
- Geschichte als perspektivische Erzählung
- Narrativität als kritisch-reflexiv angelegter Vergleich
- Gattungsbestimmung und Besonderheiten der Rede als Quelle
- Das Fundament der Aufbereitung - die Sportpalastrede
- Demagogie oder nur parteigebundene Zustimmung?
- Die Aufbereitung der Quelle
- Mehr Kompetenzen als Stunden? - Einführung in die Problematik
- Das audiovisuell gestützte Rollenspiel
- Digitalisierung - Chance oder Risiko?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Verwendung von historischen Reden im Geschichtsunterricht. Sie untersucht die Narrative Bewusstheit, die durch den Einsatz von Reden gefördert werden kann, und analysiert die Besonderheiten der Rede als Quelle.
- Narrative Bewusstheit als Ziel im Geschichtsunterricht
- Die Rolle der Perspektivität und Selektivität in der historischen Erzählung
- Analyse der Sportpalastrede von Joseph Goebbels als Beispiel für eine historische Rede
- Didaktische Potenziale und Herausforderungen des Einsatzes von Reden im Unterricht
- Die Bedeutung von Multimodalität in der Auseinandersetzung mit historischen Quellen
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel führt den Begriff der Narrativen Bewusstheit ein und erläutert, wie Geschichte als perspektivische Erzählung verstanden werden kann. Es werden die Bedeutung von Multiperspektivität und die Notwendigkeit einer kritisch-reflexiven Auseinandersetzung mit historischen Quellen betont.
- Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Rede als Quellengattung. Es wird die Sportpalastrede von Joseph Goebbels als Beispiel einer politischen Rede analysiert. Die Kapitel beleuchtet die Intention, den Kontext und die Besonderheiten der Rede, die sie zur Analyse und für den Einsatz im Unterricht geeignet machen.
- Das dritte Kapitel widmet sich der Aufbereitung von historischen Reden für den Unterricht. Es werden verschiedene didaktische Möglichkeiten, wie beispielsweise das audiovisuell gestützte Rollenspiel, vorgestellt, die die Narrative Bewusstheit bei Schülern fördern können.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Themen wie Narrative Bewusstheit, historische Quellen, Redeanalyse, didaktische Potenziale, Perspektivität, Multimodalität, und Joseph Goebbels' Sportpalastrede. Sie behandelt die Bedeutung des Einsatzes von Reden im Geschichtsunterricht und die Möglichkeiten, diese für eine lebendige und kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu nutzen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist "Narrative Bewusstheit" im Geschichtsunterricht?
Narrative Bewusstheit beschreibt das Verständnis, dass Geschichte nicht nur aus Fakten besteht, sondern eine perspektivische Erzählung ist, die mit Sinn versehen wird.
Warum eignet sich die Sportpalastrede als historische Quelle?
Sie dient als Musterbeispiel für politische Demagogie und ermöglicht es Schülern, die Wirkung von Sprache, Kontext und Intention in einer historischen Quelle zu analysieren.
Welche didaktischen Methoden werden für die Quellenarbeit vorgeschlagen?
Vorgestellt wird unter anderem das audiovisuell gestützte Rollenspiel, um die narrative Bewusstheit und kritische Reflexion der Schüler zu fördern.
Welche Rolle spielt die Digitalisierung in dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Digitalisierung als Chance oder Risiko für die moderne Aufbereitung historischer Quellen im Unterricht.
Wer hielt die Sportpalastrede und was war ihr Ziel?
Die Rede wurde von Joseph Goebbels gehalten. Sie zielte darauf ab, durch Demagogie die Zustimmung der Bevölkerung zum "totalen Krieg" zu mobilisieren.
- Quote paper
- Fabian Jobst (Author), 2020, Das gattungsspezifische Potenzial historischer Reden für die unterrichtliche Quellenarbeit am Beispiel der Sportpalastrede. (Realschule, Geschichte Klasse 8), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/990113