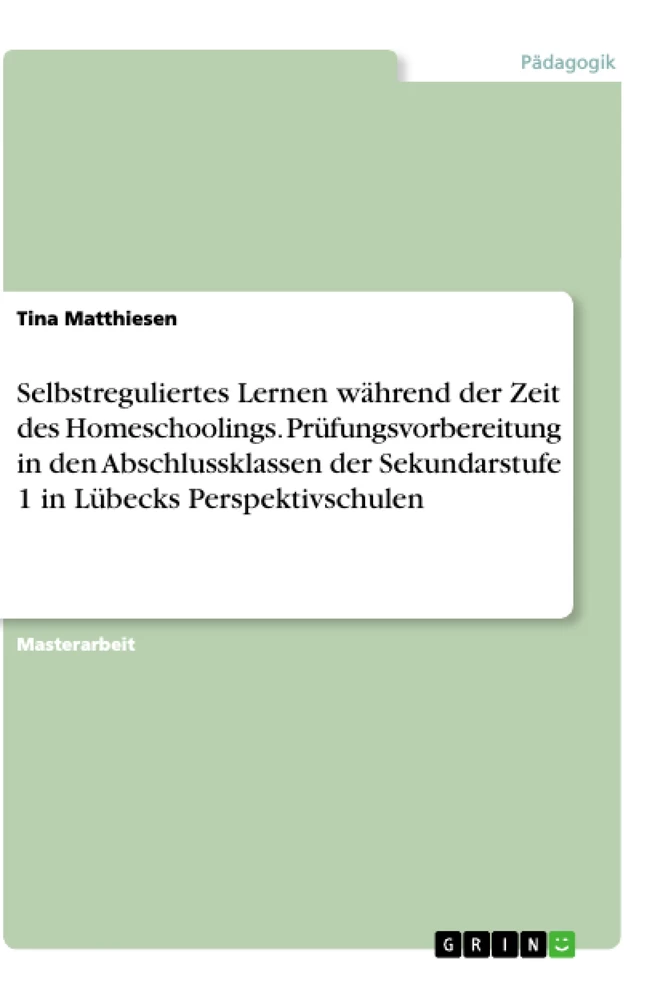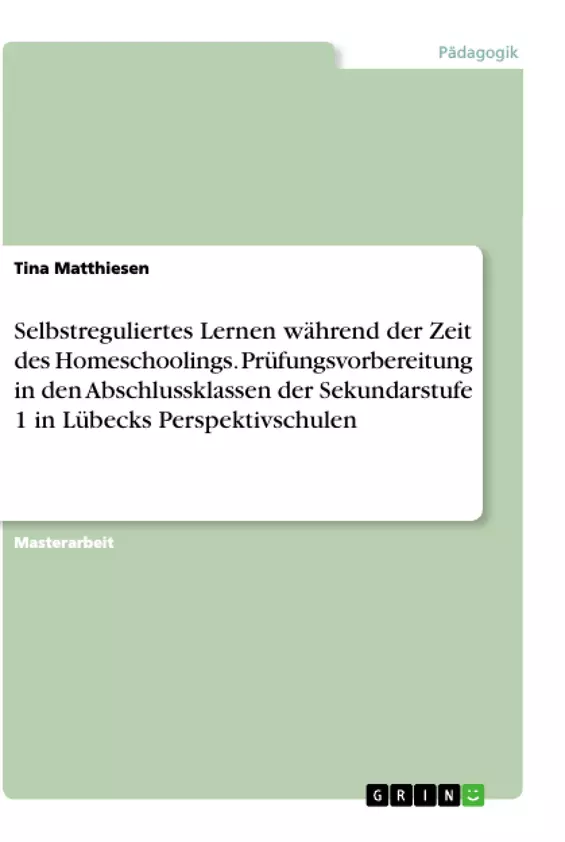Welche Faktoren beeinflussten das selbstregulierte Lernen der Schülerinnen und Schüler aus Perspektivschulklassen in der Zeit des Homeschoolings? Auf welche Kompetenzen hinsichtlich des selbstregulierten Lernens konnte die genannte Schülerschaft zurückgreifen? War diesbezüglich eine vertrauensstiftende Lehrer-Schüler-Beziehung in der Zeit des Homeschoolings aufrechtzuerhalten? Und hatten Lehrer oder weitere Personen einen Einfluss auf das Lernverhalten, aber auch auf Unsicherheiten, Ängste sowie auf das Fähigkeitsselbstkonzept der Schülerinnen und Schüler? Zur Beantwortung der aufgeführten Fragestellungen wurde für den empirischen Teil eine qualitative Schülerbefragung in den Abschlussklassen 9 und 10 in den insgesamt fünf Perspektivschulen im Bereich der Sekundarstufe 1 in Lübeck im Mai 2020 unmittelbar nach den zentralen Abschlussarbeiten vorgenommen.
Im Frühjahr 2020 wurde das Lehren und Lernen mit dem (Homeschooling) Virus zum geflügelten Begriff im Bildungssektor Schule und zugleich zur neuen, unerwarteten Herausforderung für alle Beteiligten. Von heute auf morgen waren die Schulen geschlossen und ganze Jahrgänge von Schülerinnen und Schülern vom Bildungsort Schule abgeschnitten, fortan im häuslichen Bereich auf ein überwiegend unbekanntes Lernformat, dem längerfristig angelegten Homeschooling, im Lernprozess insbesondere in der Aneignung neuen Wissens im Kontext von schulischem Wissensaufbau überwiegend auf sich allein gestellt.
Ängste und Unsicherheiten, aber auch klare Überforderungstendenzen auf Seiten der Schülerinnen und Schüler wurden aus schulischer Sicht bemerkt und so gut es möglich war durch geeignetes Lehrerhandeln versucht zu kompensieren. Hier wurden sehr schnell größere Diskrepanzen innerhalb unterschiedlicher Schularten hinsichtlich digitaler Ressourcennutzung und Erfahrungswerten im Blended Learning deutlich. Sichtbar wurde aber auch zum wiederholten Male, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler nun insbesondere im Hoomeschooling vergleichbare Zugriffe auf Lernangebote der Schulen für sich nutzbar machen konnten. Diese Erkenntnis wurde in der vorliegenden Arbeit mit dem Blick auf die Schülerschaft sogenannter Brennpunktschulen (Perspektivschulen in Schleswig-Holstein) gelenkt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bedeutung des Themas und Problemstellung
- Ziele dieser Arbeit
- Inhalte und Gliederung der Arbeit
- Theorieteil 1: Selbstreguliertes Lernen
- Definition
- Bedeutsamkeit von Lernstrategien und Metakognitiver Regulation für das selbstregulierte Lernen
- Was sind Lernstrategien?
- Klassifikation von Lernstrategien
- Wie werden Lernstrategien erworben?
- Kognitive Strategien
- Metakognitive Strategien
- Stützstrategien des internen und externen Ressourcenmanagements
- Voraussetzungen für gelingendes selbstreguliertes Lernen
- Theorieteil 2: Konsequenzen der Motivation für den Lernprozess
- Wie Lern- und Leistungsmotivation entsteht
- Wirkungsweisen und zentrale Kompetenzen der Motivation beim selbstregulierten Lernen
- Möglichkeiten der motivationsbezogenen Kompetenzförderung in der Lehrer-Schüler-Interaktion
- Erfolgsmotivierte vs. Misserfolgsängstliche
- Attribuierungsstile
- Theorieteil 3: Lernen mit dem (Homeschooling) Virus - Wie lernbegleitende Emotionen und Volition auf den selbstregulierten Lernprozess wirken
- Volitionale Aspekte beim selbstregulierten Lernprozess
- Welche Relevanz haben Emotionen für die Lernleistung?
- Ich kann das nicht! - Schülerinnen und Schüler aus Schulen in kritischer Lage lernen im coronabedingten Homeschooling
- Empirischer Teil
- Hypothesen
- Inhaltliche Hypothesen
- Statistische Hypothesen
- Methode/Untersuchungsansatz
- Forschungsmethode
- Operationalisierung der Variablen
- Stichprobe
- Durchführung
- Auswertung
- Ergebnisse
- Anmerkungen
- Ergebnisse Hypothese a): Tabelle 1 – 4
- Ergebnisse Hypothese b): Tabelle 5
- Ergebnisse Hypothese c): Tabelle 6
- Interpretationen und Schlussfolgerungen
- Fazit
- Quellen
- Abbildungsverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit befasst sich mit der Untersuchung des selbstregulierten Lernens von Schülerinnen und Schülern aus Perspektivschulen in Lübeck während der Zeit des Homeschoolings im Kontext der Prüfungsvorbereitung. Die Arbeit analysiert, welche Faktoren das selbstregulierte Lernen beeinflussen, welche Kompetenzen in dieser Situation relevant sind und welche Rolle Lehrer-Schüler-Beziehungen und familiäre Bezugspersonen spielen.
- Selbstreguliertes Lernen im Homeschooling-Kontext
- Relevanz von Lernstrategien und Metakognition
- Einfluss von Motivation, Emotionen und Volition
- Rolle der Lehrer-Schüler-Beziehung
- Herausforderungen und Chancen des Lernens in Brennpunktschulen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt das Thema des selbstregulierten Lernens im Homeschooling-Kontext vor, insbesondere für Schülerinnen und Schüler aus Perspektivschulen in Lübeck. Sie beschreibt die Problemstellung und die Ziele der Arbeit, sowie die Inhalte und die Gliederung.
- Theorieteil 1: Selbstreguliertes Lernen: Dieser Teil definiert den Begriff des selbstregulierten Lernens, erläutert die Bedeutung von Lernstrategien und Metakognition und stellt verschiedene Strategietypen sowie die Voraussetzungen für gelingendes selbstreguliertes Lernen dar.
- Theorieteil 2: Konsequenzen der Motivation für den Lernprozess: Dieser Teil behandelt die Entstehung von Lern- und Leistungsmotivation, die Wirkungsweisen und zentralen Kompetenzen der Motivation im selbstregulierten Lernen, sowie Möglichkeiten der motivationsbezogenen Kompetenzförderung in der Lehrer-Schüler-Interaktion. Er beleuchtet außerdem die Unterschiede zwischen erfolgsmotivierten und misserfolgsängstlichen Lernenden und die Bedeutung von Attribuierungsstilen.
- Theorieteil 3: Lernen mit dem (Homeschooling) Virus: Dieser Teil beschäftigt sich mit den Auswirkungen von Emotionen und Volition auf den selbstregulierten Lernprozess im Homeschooling. Er analysiert die Relevanz von Emotionen für die Lernleistung und beleuchtet die besonderen Herausforderungen für Schülerinnen und Schüler aus Schulen in kritischer Lage im Kontext des coronabedingten Homeschoolings.
- Empirischer Teil: Dieser Teil stellt die Hypothesen der Arbeit, die Forschungsmethode, die Operationalisierung der Variablen, die Stichprobe und die Durchführung der Untersuchung vor. Er erläutert den Ansatz der Arbeit und beschreibt die Auswertungsmethode.
- Ergebnisse: Dieser Teil präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung und beleuchtet die Ergebnisse der einzelnen Hypothesen anhand von Tabellen.
- Interpretationen und Schlussfolgerungen: Dieser Teil interpretiert die Ergebnisse der Untersuchung und zieht Schlussfolgerungen hinsichtlich der Fragestellungen der Arbeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen des selbstregulierten Lernens, Homeschooling, Prüfungsvorbereitung, Perspektivschulen, Motivation, Emotionen, Volition, Lehrer-Schüler-Beziehung und digitaler Kompetenz. Der Fokus liegt dabei auf den besonderen Herausforderungen für Schülerinnen und Schüler aus Brennpunktschulen im Kontext der coronabedingten Schulschließungen.
- Quote paper
- Tina Matthiesen (Author), 2020, Selbstreguliertes Lernen während der Zeit des Homeschoolings. Prüfungsvorbereitung in den Abschlussklassen der Sekundarstufe 1 in Lübecks Perspektivschulen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/990344