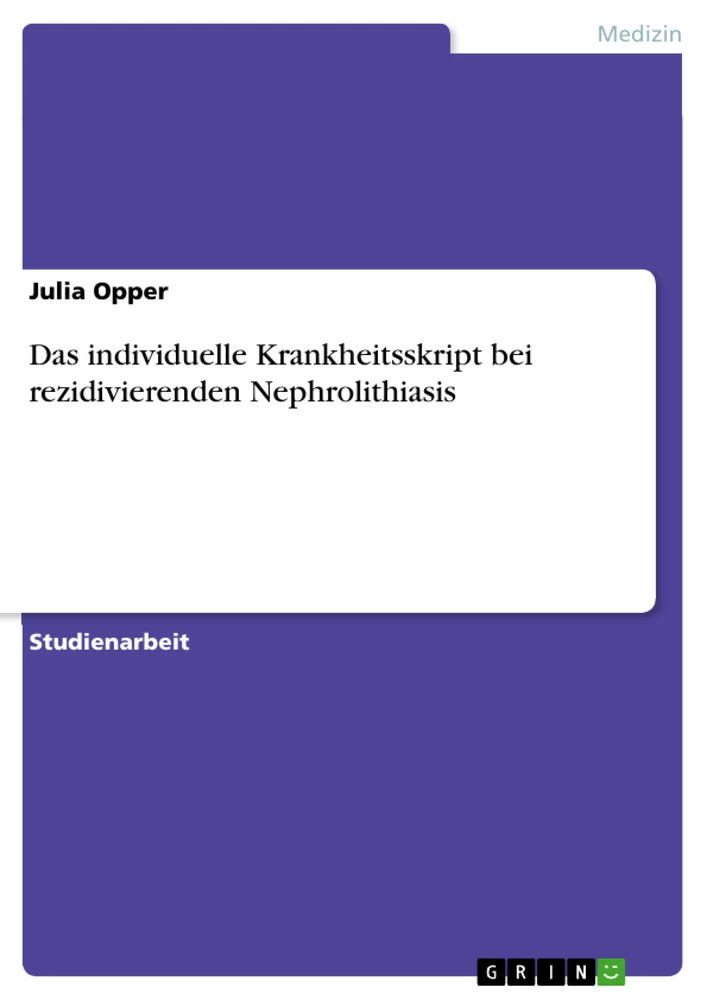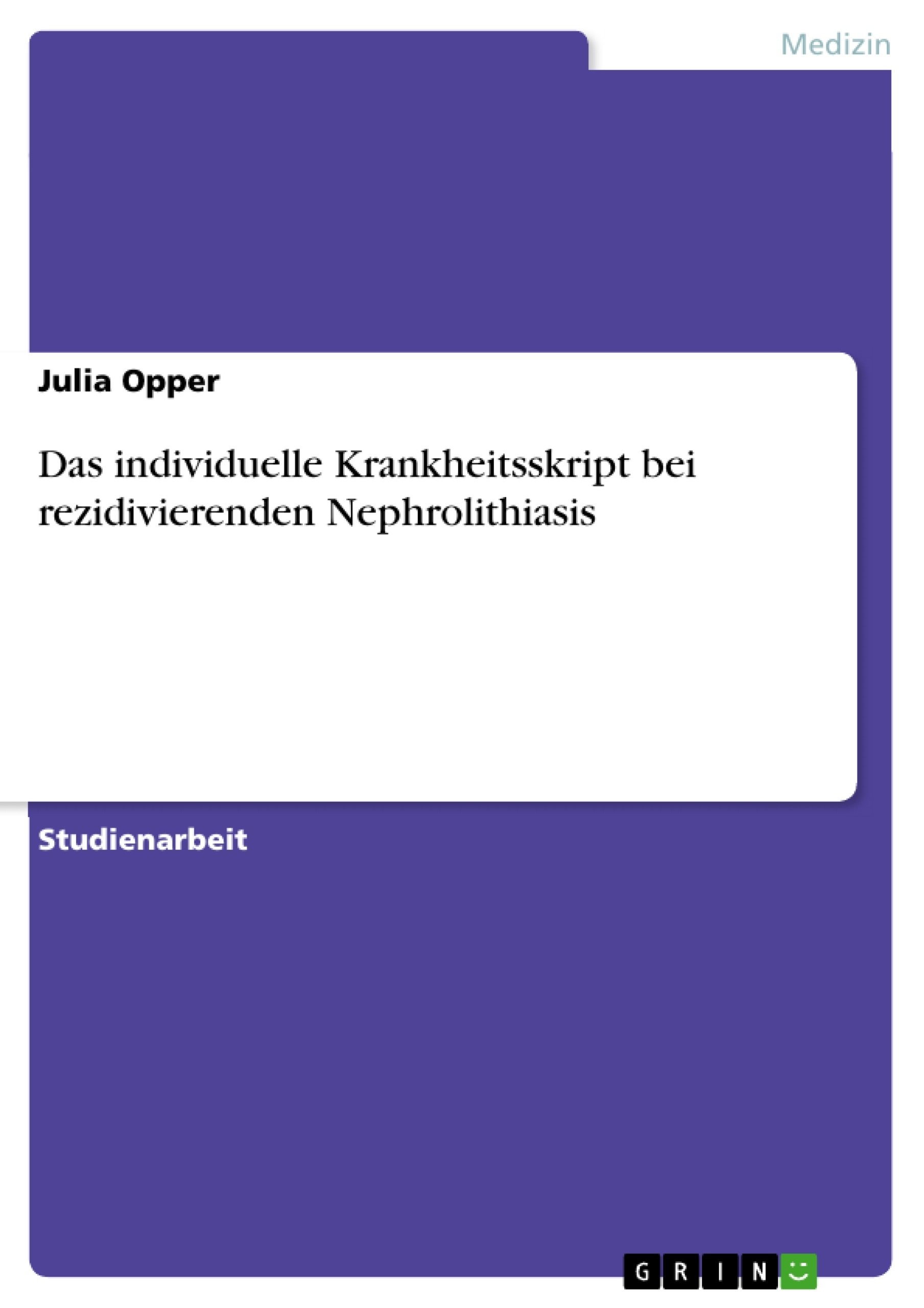Das individuelle Krankheitsskript dient zur vollständigen Erfassung einer Diagnose nach der ICF. Anhand eines fiktiven Falls eines Nephrolithiasispatienten, wird die Notwendigkeit für die Erfassung des individuellen Krankheitsskript dargestellt. Weiterhin werden die Defizite, die bei der Krankheitserfassung nach dem biomedizinischen Konzept entstehen, aufgezeigt. Das Fazit stellt einen kurzen Ausblick dar, wie das individuelle Krankheitsskript integriert werden kann.
Patienten mit rezidivierenden Nephrolithiasis benötigen eine weitere urologische Abklärung, da ein erhöhtes Risiko für Folgekomplikationen besteht. Um Rezidive zu vermeiden, werden die Risikofaktoren ermittelt. Dahingehend werden die Metaphylaxen für den Patienten angepasst. Es wird dargestellt, dass ein klinisches Problem unvollständig durch den Mediziner erfasst wird. Folglich ist die Ermittlung von Risikofaktoren sowie die weitere Therapie und Präventionsplanung unzureichend. Ein gesamtes klinisches Urteil wird durch die Betrachtung des „individuellen Krankheitsskripts“ ermöglicht. Es beinhaltet neben pathophysiologischen Prozessen, die Auswirkung von Symptomen einer Krankheit sowie Bedingungen, die eine Entstehung einer Krankheit, begünstigen oder vermeiden.
Für die Betrachtung nach dem individuellen Krankheitsskript, werden die „Formen des Clinical Reasoning“, die Resilienz mit den Resilienzfaktoren, das Modell der Salutogenese und die Kohärenz sowie die „International Classification of Functioning, Disability and Health“ (ICF) hinzugezogen. Für die anliegende Fallarbeit wird zunächst das Krankheitsbild vorgestellt. Im nächsten Teil wird das Fallbeispiel wiedergegeben und auf die oben genannten Punkte analysiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Definition von Urolithiasis
- 3. Epidemiologie
- 4. Pathogenese
- 5. Harnsteinarten
- 6. Symptomatik und Komplikationen
- 7. Diagnostik
- 8. Therapie
- 9. Metabolische Diagnostik und Rezidivprophylaxe
- 10. Das individuelle Krankheitsskript bei rezidivierenden Nephrolithiasis
- 10.1. Fallbeispiel aus dem Fachbuch:,,Urologie Basiswissen Auflage 7"
- 10.2. Die Formen des Clinical Reasoning
- 10.2.1. Scientific Reasoning
- 10.2.2. Interaktives Reasoning
- 10.2.2.1. Lernfaktor Sinneseindrücke
- 10.2.3. Konditionales Reasoning
- 10.2.3.1. Lernfaktor Vorwissen
- 10.2.4. Narrative Reasoning
- 10.2.4.1. Der Lernfaktor individuelle Prägung
- 10.2.5. Pragmatisches Reasoning
- 10.2.5.1. Der Lernfaktor aktuelle Lebenssituation
- 10.2.6. Ethisches Reasoning
- 10.2.6.1. Der Lernfaktor aktuelle Lebenseinstellung
- 10.3. Resilienz
- 10.3.1. Resilienzfaktoren des Patienten
- 10.4. Salutogenese und Kohärenz
- 10.4.1. Der Verlauf des individuellen Krankheitsskripts am Konzept der Salutogenese
- 10.5. ICF
- 10.5.1. Variablenveränderung in den vier Komponenten der ICF
- 11. Fazit der Hausarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das individuelle Krankheitsskript bei rezidivierender Nephrolithiasis. Ziel ist es, anhand eines Fallbeispiels und verschiedener Clinical-Reasoning-Ansätze das Verständnis für die Erkrankung und die individuelle Bewältigung zu vertiefen. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Resilienz, Salutogenese und dem ICF-Modell im Kontext der Erkrankung.
- Rezidivprophylaxe bei Nephrolithiasis
- Anwendung verschiedener Clinical-Reasoning-Modelle
- Bedeutung von Resilienz und Salutogenese
- Integration des ICF-Modells
- Analyse eines konkreten Fallbeispiels
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Hausarbeit ein, nämlich das individuelle Krankheitsskript bei rezidivierender Nephrolithiasis. Sie umreißt die Bedeutung des Verständnisses der individuellen Erfahrungen von Patienten mit dieser Erkrankung und wie verschiedene klinische Denkmodelle dabei helfen können, eine optimale Versorgung zu gewährleisten. Die Einleitung betont den Fokus auf die Anwendung von Clinical Reasoning und die Einbeziehung von Konzepten wie Resilienz und Salutogenese.
2. Definition von Urolithiasis: Dieses Kapitel bietet eine präzise Definition von Urolithiasis, klärt die Terminologie und legt den Grundstein für das Verständnis der Erkrankung. Es differenziert zwischen verschiedenen Arten von Nierensteinen und deren Vorkommen im Harnsystem. Die Definition dient als essentielle Grundlage für die folgenden Kapitel, die die Epidemiologie, Pathogenese und Symptomatik der Erkrankung detailliert untersuchen.
3. Epidemiologie: Das Kapitel zur Epidemiologie präsentiert statistische Daten zur Häufigkeit von Urolithiasis, beleuchtet Risikofaktoren und betrachtet die Verteilung der Erkrankung in verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Diese Informationen sind wichtig, um das Ausmaß des Problems zu verstehen und präventive Maßnahmen zu entwickeln. Die epidemiologischen Daten liefern den Kontext für die nachfolgenden Kapitel, die sich mit der Pathogenese und Therapie der Urolithiasis auseinandersetzen.
4. Pathogenese: In diesem Kapitel wird die Entstehung und der Verlauf von Nierensteinen auf pathophysiologischer Ebene erläutert. Es werden die komplexen Prozesse beschrieben, die zur Kristallisation und Steinbildung führen, einschließlich der Rolle von Stoffwechselstörungen, genetischen Faktoren und Umweltfaktoren. Das Verständnis der Pathogenese ist entscheidend für die Entwicklung effektiver Behandlungsstrategien, die in späteren Kapiteln behandelt werden.
5. Harnsteinarten: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Arten von Nierensteinen, ihre chemische Zusammensetzung und die damit verbundenen Unterschiede in Entstehung, Symptomatik und Behandlung. Die detaillierte Darstellung der verschiedenen Harnsteinarten ist essentiell, um die Diagnostik und Therapie individuell anzupassen, da die Behandlungsstrategie von der chemischen Zusammensetzung des Steins abhängt. Diese Information ist eng mit dem Verständnis der Pathogenese und der Diagnostik verknüpft.
6. Symptomatik und Komplikationen: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Symptome von Nierensteinen, von leichten Beschwerden bis hin zu schweren Komplikationen, und die möglichen Folgen einer unbehandelten Erkrankung. Die Darstellung der Symptomatik und Komplikationen ist wichtig, um frühzeitige Erkennung und rechtzeitige Behandlung zu ermöglichen und schwerwiegende gesundheitliche Folgen zu vermeiden. Die Beschreibung der Komplikationen unterstreicht die Bedeutung einer effektiven Therapie.
7. Diagnostik: Das Kapitel zur Diagnostik beschreibt die verschiedenen Verfahren zur Erkennung von Nierensteinen, von bildgebenden Verfahren wie Ultraschall und Computertomographie bis hin zu Laboruntersuchungen. Die präzise Diagnose ist die Grundlage für eine zielgerichtete Therapie und Prophylaxe. Die verschiedenen diagnostischen Methoden werden detailliert dargestellt und ihre jeweilige Aussagekraft im Kontext der Urolithiasis erläutert.
8. Therapie: Dieses Kapitel beschreibt die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten von Nierensteinen, von konservativen Maßnahmen bis hin zu operativen Eingriffen. Die Wahl der Therapie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe und Lokalisation des Steins, den Begleitsymptomen und dem allgemeinen Gesundheitszustand des Patienten. Es wird die Bedeutung einer individuellen Therapieplanung hervorgehoben.
9. Metabolische Diagnostik und Rezidivprophylaxe: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Bedeutung der metabolischen Diagnostik zur Identifizierung von Risikofaktoren für die Steinbildung und die Entwicklung von Strategien zur Prävention von Rezidiven. Die Rezidivprophylaxe ist ein zentraler Aspekt der langfristigen Behandlung von Nierensteinen. Das Kapitel unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden Betreuung von Patienten mit rezidivierender Nephrolithiasis.
Schlüsselwörter
Nephrolithiasis, Urolithiasis, Nierensteine, Rezidivprophylaxe, Clinical Reasoning, Scientific Reasoning, Interaktives Reasoning, Konditionales Reasoning, Narrative Reasoning, Pragmatisches Reasoning, Ethisches Reasoning, Resilienz, Salutogenese, Kohärenz, ICF-Modell, Metabolische Diagnostik, Fallbeispiel.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Individuelles Krankheitsskript bei rezidivierender Nephrolithiasis
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das individuelle Krankheitsskript bei rezidivierender Nephrolithiasis. Sie analysiert anhand eines Fallbeispiels und verschiedener Clinical-Reasoning-Ansätze das Verständnis für die Erkrankung und die individuelle Bewältigung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung von Resilienz, Salutogenese und dem ICF-Modell im Kontext der Erkrankung.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt folgende Themen: Definition und Epidemiologie der Urolithiasis, Pathogenese der Steinbildung, verschiedene Harnsteinarten, Symptomatik und Komplikationen, Diagnostik und Therapie, metabolische Diagnostik und Rezidivprophylaxe, verschiedene Clinical-Reasoning-Modelle (Scientific, Interaktiv, Konditional, Narrativ, Pragmatisch, Ethisch), Resilienz, Salutogenese, Kohärenz, und die Anwendung des ICF-Modells. Ein detailliertes Fallbeispiel veranschaulicht die Anwendung der Konzepte.
Welche Clinical-Reasoning-Modelle werden angewendet?
Die Hausarbeit verwendet verschiedene Clinical-Reasoning-Modelle, um das individuelle Krankheitsskript zu analysieren: Scientific Reasoning, Interaktives Reasoning (mit dem Lernfaktor Sinneseindrücke), Konditionales Reasoning (mit dem Lernfaktor Vorwissen), Narrative Reasoning (mit dem Lernfaktor individuelle Prägung), Pragmatisches Reasoning (mit dem Lernfaktor aktuelle Lebenssituation) und Ethisches Reasoning (mit dem Lernfaktor aktuelle Lebenseinstellung).
Welche Rolle spielen Resilienz, Salutogenese und das ICF-Modell?
Resilienz, Salutogenese und das ICF-Modell spielen eine wichtige Rolle bei der Analyse des individuellen Krankheitsskripts. Resilienzfaktoren des Patienten werden betrachtet. Der Verlauf des individuellen Krankheitsskripts wird anhand des Konzepts der Salutogenese analysiert. Schließlich wird die Veränderung der Variablen in den vier Komponenten des ICF-Modells untersucht.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in elf Kapitel gegliedert: Einleitung, Definition von Urolithiasis, Epidemiologie, Pathogenese, Harnsteinarten, Symptomatik und Komplikationen, Diagnostik, Therapie, Metabolische Diagnostik und Rezidivprophylaxe, Das individuelle Krankheitsskript bei rezidivierender Nephrolithiasis (inkl. Fallbeispiel und detaillierter Analyse der Clinical-Reasoning-Modelle, Resilienz, Salutogenese und ICF), und Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Was sind die Schlüsselwörter der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Nephrolithiasis, Urolithiasis, Nierensteine, Rezidivprophylaxe, Clinical Reasoning, Scientific Reasoning, Interaktives Reasoning, Konditionales Reasoning, Narrative Reasoning, Pragmatisches Reasoning, Ethisches Reasoning, Resilienz, Salutogenese, Kohärenz, ICF-Modell, Metabolische Diagnostik, Fallbeispiel.
Wo finde ich ein Fallbeispiel?
Ein detailliertes Fallbeispiel aus dem Fachbuch „Urologie Basiswissen Auflage 7“ wird im Kapitel 10 verwendet, um die Anwendung der verschiedenen Clinical-Reasoning-Modelle, die Bedeutung von Resilienz, Salutogenese und das ICF-Modell im Kontext der rezidivierenden Nephrolithiasis zu veranschaulichen.
Was ist das Ziel der Hausarbeit?
Ziel der Hausarbeit ist es, anhand eines Fallbeispiels und verschiedener Clinical-Reasoning-Ansätze das Verständnis für die Erkrankung und die individuelle Bewältigung von rezidivierender Nephrolithiasis zu vertiefen. Die Bedeutung von Resilienz, Salutogenese und dem ICF-Modell sollen im Kontext der Erkrankung hervorgehoben werden.
- Quote paper
- Julia Opper (Author), 2021, Das individuelle Krankheitsskript bei rezidivierenden Nephrolithiasis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/991116