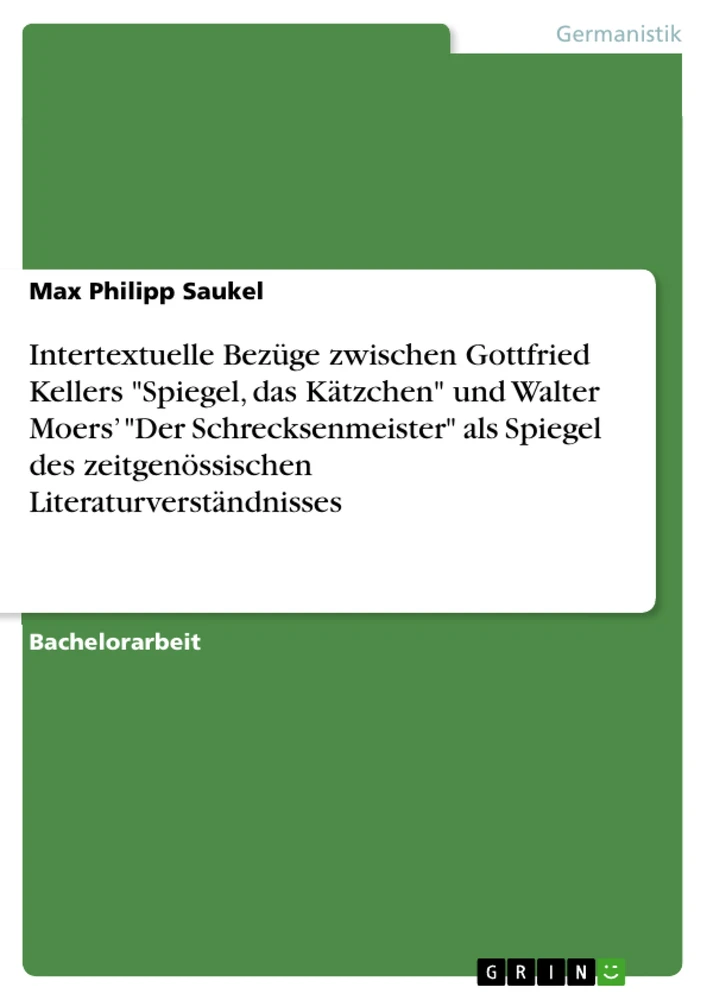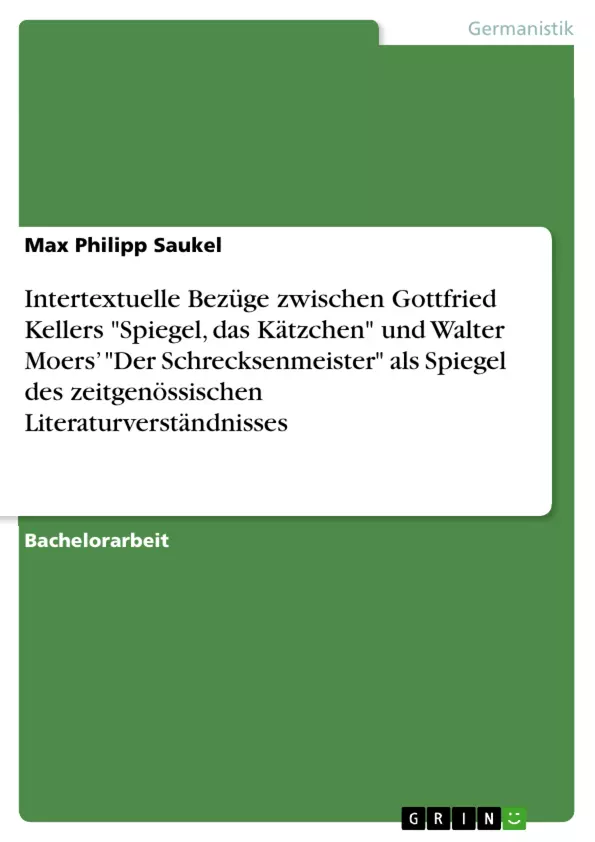Der Schrecksenmeister und der Hexenmeister, Echo und Spiegel, Sledwaya und Seldwyla. Der Roman "Der Schrecksenmeister" von Walter Moers bedient sich strukturell und inhaltlich der Novelle "Spiegel, das Kätzchen" von Gottfried Keller. In dieser Abschlussarbeit wird ein systematischer narratologischer Zugang zu intertextuellen Bezügen zwischen den beiden Werken vollzogen. Das Werk bietet nicht nur eine Übersicht über die aktuelle Forschung zum Werk Walter Moers', sondern macht auch verschiedene Intertextualitätstheorien als Analysewerkzeug nutzbar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Vorbetrachtungen: Intertextualität.
- 2.1. Intertextualitätstheorien und die Schwierigkeit des Konkreten.
- 2.2. Auf dem Weg zur passenden Intertextualitätstheorie – Genette und Pfister/Broich
- 2.3. Exkurs: Bloom – psychologisierte Intertextualität.
- 3. Analyse: Spiegel, das Kätzchen als Folie für den Schrecksenmeister.
- 3.1. Kellers Die Leute von Seldwyla und Moers' Der Schrecksenmeister – Kontext
- 3.2. Palimpseste und Transformation – Handlung und Erzählstruktur.
- 3.3. Figurenkonstellationen
- 3.3.1. Echo und Spiegel.
- 3.3.2. Eiẞpin und Pineiß.
- 3.3.3. Izanuela und die Berghine
- 3.3.4. Fjodor F. Fjodor und die Eule
- 3.3.5. Floria von Eisenstadt und das Frauchen.........
- 3.4. Die Diegesen: Seldwyla und Sledwaya..........\li>
- 3.5. Motiv: Liebe...........
- 3.6. Der Schrecksenmeister – ein Gattungspotpourri? ..
- 3.7. Paratextuelle Autorinszenierung ..
- 4. Intertextualität zwischen Der Schrecksenmeister und Spiegel, das Kätzchen - Ergebnisse ...
- 5. Schluss...
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die intertextuellen Bezüge zwischen Gottfried Kellers "Spiegel, das Kätzchen" und Walter Moers' "Der Schrecksenmeister", um die rezeptionsästhetische Wirkung dieser Bezugnahme zu analysieren und ihre Bedeutung für das zeitgenössische Literaturverständnis zu beleuchten. Dabei steht die Frage im Vordergrund, wie diese Intertextualität die Lektüre beeinflusst und welche Erkenntnisse sie über die postmoderne Autorfigur liefert.
- Intertextualität als analytisches Werkzeug
- Vergleichende Analyse von "Spiegel, das Kätzchen" und "Der Schrecksenmeister"
- Die Rezeption intertextueller Bezüge
- Die postmoderne Autorfigur im Werk von Walter Moers
- Das zeitgenössische Literaturverständnis im Kontext der Intertextualität
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung stellt die Ausgangsthese der Arbeit vor und skizziert die Forschungsfrage, die sich auf die intertextuellen Bezüge zwischen "Spiegel, das Kätzchen" und "Der Schrecksenmeister" konzentriert.
- Kapitel 2: Vorbetrachtungen: Intertextualität beleuchtet verschiedene Ansätze zur Intertextualitätstheorie, um einen geeigneten Rahmen für die Analyse der beiden Werke zu schaffen.
- Kapitel 3: Analyse: Spiegel, das Kätzchen als Folie für den Schrecksenmeister führt eine vergleichende Analyse der beiden Texte durch, wobei Handlung, Figuren, Erzählstruktur, Motive und Diegesen untersucht werden.
Schlüsselwörter
Intertextualität, Gottfried Keller, Walter Moers, "Spiegel, das Kätzchen", "Der Schrecksenmeister", postmoderne Autorfigur, rezeptionsästhetische Wirkung, Literaturverständnis, Zeitgenössische Literatur, Genette, Pfister/Broich, Bloom, Palimpsest, Transformation, Figurenkonstellationen, Diegesen, Motiv.
Häufig gestellte Fragen
Wie hängen Walter Moers und Gottfried Keller literarisch zusammen?
Walter Moers nutzt Kellers Novelle „Spiegel, das Kätzchen“ als strukturelle und inhaltliche Vorlage für seinen Roman „Der Schrecksenmeister“.
Welche Rollen spielen die Orte Seldwyla und Sledwaya?
Sledwaya ist in Moers' Roman die intertextuelle Entsprechung zu Kellers fiktivem Ort Seldwyla, wobei Moers die Gegebenheiten in seine Fantasy-Welt Zamonien transformiert.
Welche Figurenpaare werden verglichen?
Die Analyse vergleicht unter anderem Echo (Moers) mit Spiegel (Keller) sowie den Schrecksenmeister Eißpin mit dem Hexenmeister Pineiß.
Was ist ein "Palimpsest" im Kontext dieser Arbeit?
Nach Genette bezeichnet es einen Text, der einen früheren Text überlagert oder transformiert, so wie Moers Kellers Werk als Folie nutzt.
Welche Intertextualitätstheorien werden angewendet?
Die Arbeit nutzt Theorien von Gérard Genette, Pfister/Broich und den psychologisierten Ansatz von Harold Bloom.
Was sagt die Arbeit über das postmoderne Literaturverständnis aus?
Sie zeigt, wie zeitgenössische Autoren durch bewusste Rückbezüge und Transformationen klassischer Stoffe neue rezeptionsästhetische Wirkungen erzielen.
- Citar trabajo
- Max Philipp Saukel (Autor), 2020, Intertextuelle Bezüge zwischen Gottfried Kellers "Spiegel, das Kätzchen" und Walter Moers’ "Der Schrecksenmeister" als Spiegel des zeitgenössischen Literaturverständnisses, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/991199