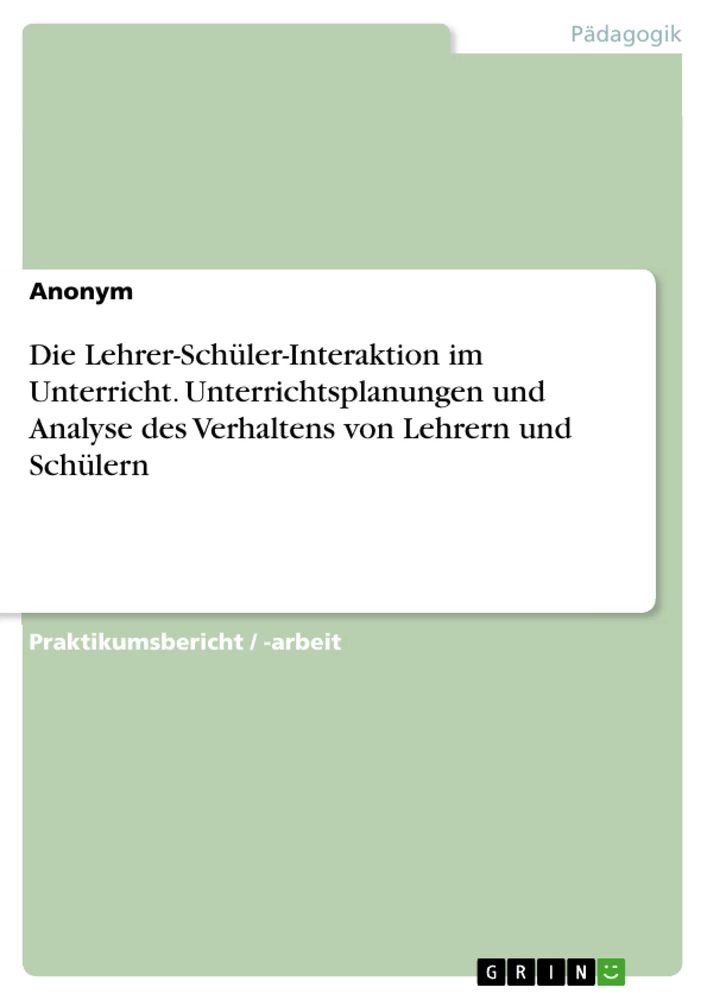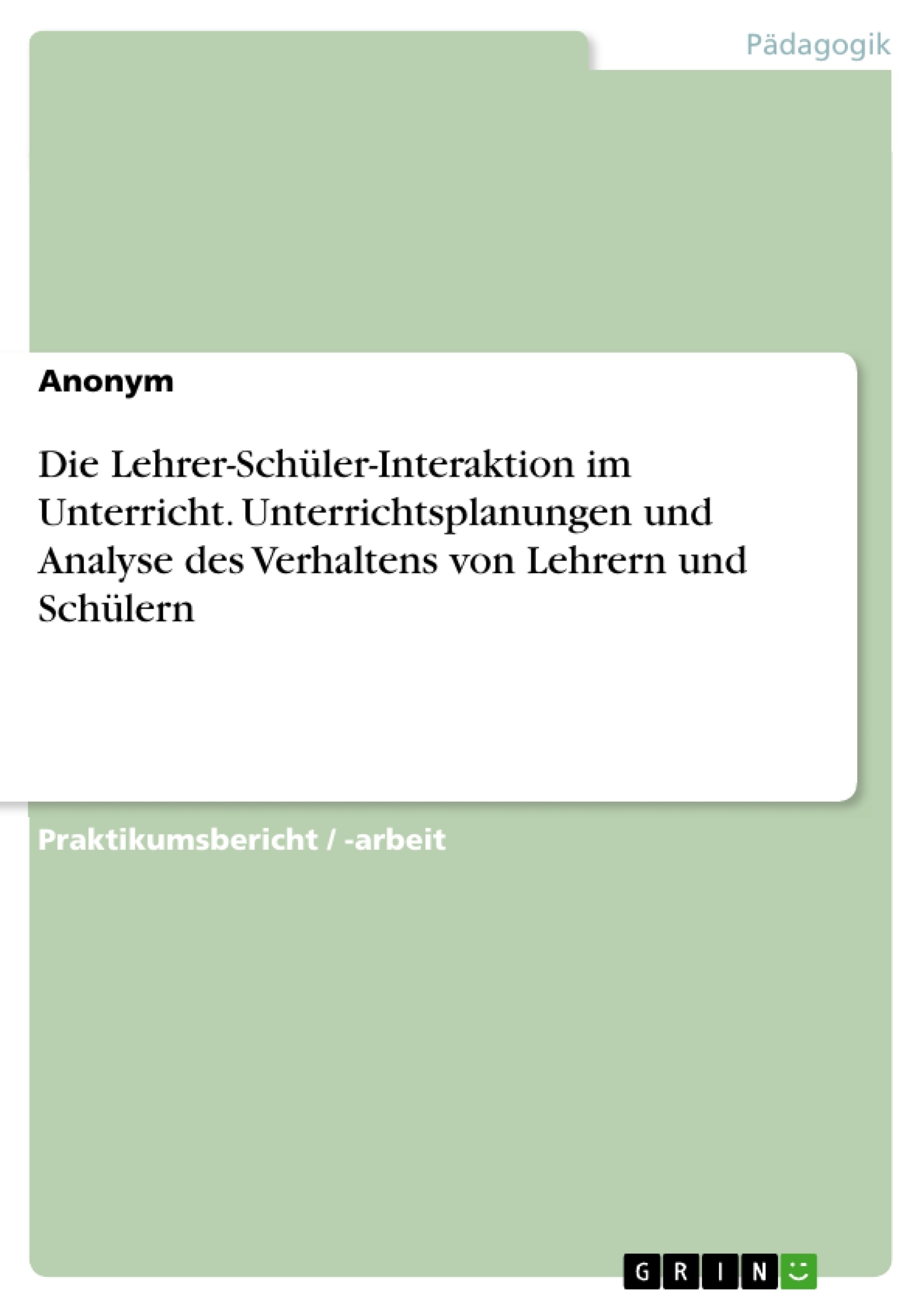Diese Arbeit analysiert die Interaktion zwischen Schüler und Lehrer. In der klassischen Interaktionsanalyse konnten Studien festlegen, dass bestimmte Verhaltensweisen von Lehrkräften in einem signifikanten Verhältnis zur Entwicklung von Schülerleistungen stehen. Die Lehrer-Schüler- Interaktion (L-S-I) stellt ein zentrales Vehikel für positive Ergebnisse wie zum Beispiel Motivation dar, zudem spielen die Lehrkräfte eine der wichtigsten Rollen im Bildungsprozess.
Unter Interaktion ist die Wechselwirkung zu verstehen. In Verbindung mit dem Unterricht, ist mit der Wechselwirkung die durch Kommunikation vermittelten wechselseitigen Beziehungen zwischen Personen und die daraus ergebende wechselseitige Beeinflussung ihrer Einstellungen, Erwartungen und Handlungen gemeint.
Die Praktikantin hat sich für den Beobachtungsschwerpunkt Interaktion entschieden, da sie im Rahmen des Praktikums bereits zu Beginn feststellen konnte, dass das Lehrerverhalten und das Schülerverhalten sich gegenseitig beeinflussen. Sie konnte beobachten, dass der Lehrer, der ein freundschaftliches Verhältnis zu den Schülerinnen und Schülern (SuS) hat, einer deutlich geringeren Lernbereitschaft gegenübersteht, als ein Lehrer, der sich eher distanziert zu seinen SuS verhält. Der Lehrer, der sich Späße mit den SuS erlaubt, als Unterrichtseinstieg etwas von seinem Alltag erzählt, mit den SuS über aktuelle Themen redet und einen guten Zugang zu den SuS hat, kämpft deutlich mehr mit Unterrichtsstörungen, als die Lehrkraft, die sich nur auf den Unterricht fokussiert und nicht vom Unterrichtsstoff abweicht.
Ebenso ist die Beteiligung und das Interesse am Unterricht der Lernenden geringer, die eine freundschaftliche Beziehung zu der Lehrkraft haben. Besonders auffällig ist dabei, dass die SuS versuchen diese Situation auszunutzen, indem sie vom Unterrichtsstoff ablenken und dem Lehrer Fragen stellen, die nicht zum Unterricht gehören. Dabei ist auch zu erwähnen, dass der Lehrer wiederholt mit erhöhter Stimme die SuS auffordern muss leise zu sein. Die SuS, die ein distanziertes Verhältnis zu der Lehrkraft haben, verfolgen den Unterricht mit Interesse und beteiligen sich aktiv am Unterricht. Weiterhin konnte die Praktikantin beobachten, dass sowohl die Persönlichkeit der Lehrer, als auch der Führungsstil einen Einfluss auf die Lernbereitschaft und somit auf das Schülerverhalten hat.
Inhaltsverzeichnis
- Beobachtungsschwerpunkt „Interaktion“
- Auswahl des Beobachtungsschwerpunktes
- Lehrer-Schüler-Interaktion
- Transaktionales Modell der Lehrer-Schüler-Interaktion
- Hospitationsprotokoll
- Bedingungsanalyse
- Synoptische Darstellung
- Reflexion unter Berücksichtigung des Schwerpunktes
- Unterrichtsplanung und -analyse
- Unterrichtsentwurf,,Inventar“
- Bedingungsanalyse
- Didaktische Analyse
- Verlaufsplanung & Methodenbegründung
- Synoptische Planung
- Unterrichtsentwurf,,Bilanz.......
- Bedingungsanalyse
- Synoptische Darstellung der Unterrichtsstunde
- Reflexion der Unterrichtsstunde
- Zusatzauftrag zur Kompensation einer verpassen Seminarsitzung
- Bedingungsanalyse
- Didaktische Analyse
- Verlaufsplanung & Methodenbegründung
- Synoptische Planung
- Fazit
- Analyse der Lehrer-Schüler-Interaktion im Kontext der Unterrichtsgestaltung
- Anwendung des transaktionalen Modells der Lehrer-Schüler-Interaktion
- Reflexion der eigenen Beobachtungen und Lernerfahrungen im Praktikum
- Entwicklung von Unterrichtskonzepten und -materialien
- Bewertung der Wirksamkeit verschiedener Unterrichtsmethoden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Beobachtungsschwerpunkt „Interaktion“ im Rahmen eines Eignungs- und Orientierungspraktikums im Fach Wirtschaftspädagogik. Das Ziel ist es, die Interaktion zwischen Lehrkraft und Schülerinnen und Schülern im Unterricht zu analysieren und zu reflektieren, wobei der Fokus auf dem transaktionalen Modell der Lehrer-Schüler-Interaktion liegt.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Auswahl des Beobachtungsschwerpunktes „Interaktion“ und führt in die Thematik der Lehrer-Schüler-Interaktion ein. Es wird das transaktionale Modell der Lehrer-Schüler-Interaktion von Nickel (1976) vorgestellt, welches als theoretischer Rahmen für die Analyse der Unterrichtsbeobachtungen dient. Das zweite Kapitel beinhaltet ein Hospitationsprotokoll, welches die beobachteten Interaktionen im Unterricht detailliert beschreibt und analysiert. Es werden sowohl die Bedingungen des Unterrichts, wie z.B. die Klassensituation und das Lernklima, als auch die konkrete Interaktion zwischen Lehrkraft und Schülerinnen und Schülern anhand einer synoptischen Darstellung beleuchtet. Im Anschluss erfolgt eine Reflexion der beobachteten Interaktionen unter Berücksichtigung des Schwerpunktes „Interaktion“. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Unterrichtsplanung und -analyse. Es werden zwei Unterrichtsentwürfe, „Inventar“ und „Bilanz“, vorgestellt, die auf Grundlage des transaktionalen Modells der Lehrer-Schüler-Interaktion entwickelt wurden. Die Unterrichtsentwürfe beinhalten eine Bedingungsanalyse, eine didaktische Analyse, eine Verlaufsplanung und eine synoptische Planung. Darüber hinaus werden die einzelnen Unterrichtsphasen reflektiert und die Wirksamkeit der eingesetzten Methoden bewertet. Abschließend wird ein Zusatzauftrag zur Kompensation einer verpassten Seminarsitzung behandelt, der ebenfalls auf der Grundlage des transaktionalen Modells basiert.
Schlüsselwörter
Lehrer-Schüler-Interaktion, Transaktionales Modell, Unterrichtsbeobachtung, Hospitationsprotokoll, Unterrichtsplanung, Unterrichtsanalyse, Bedingungsanalyse, Didaktische Analyse, Synoptische Planung, Unterrichtsmethoden, Wirksamkeit, Reflexion, Lernerfahrungen, Wirtschaftspädagogik.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2021, Die Lehrer-Schüler-Interaktion im Unterricht. Unterrichtsplanungen und Analyse des Verhaltens von Lehrern und Schülern, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/991540