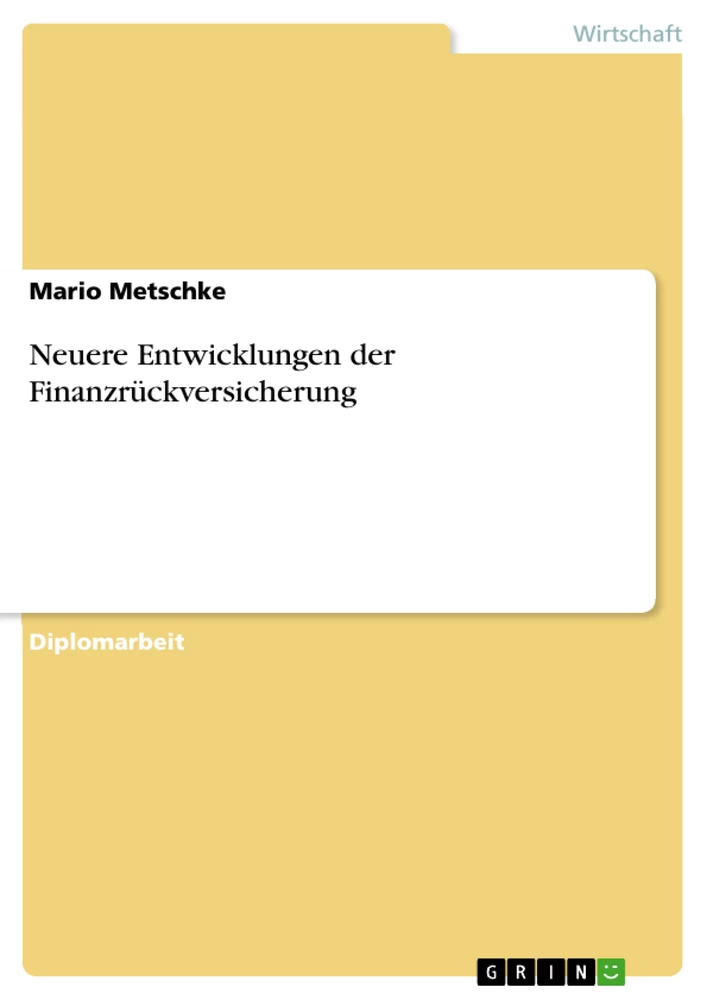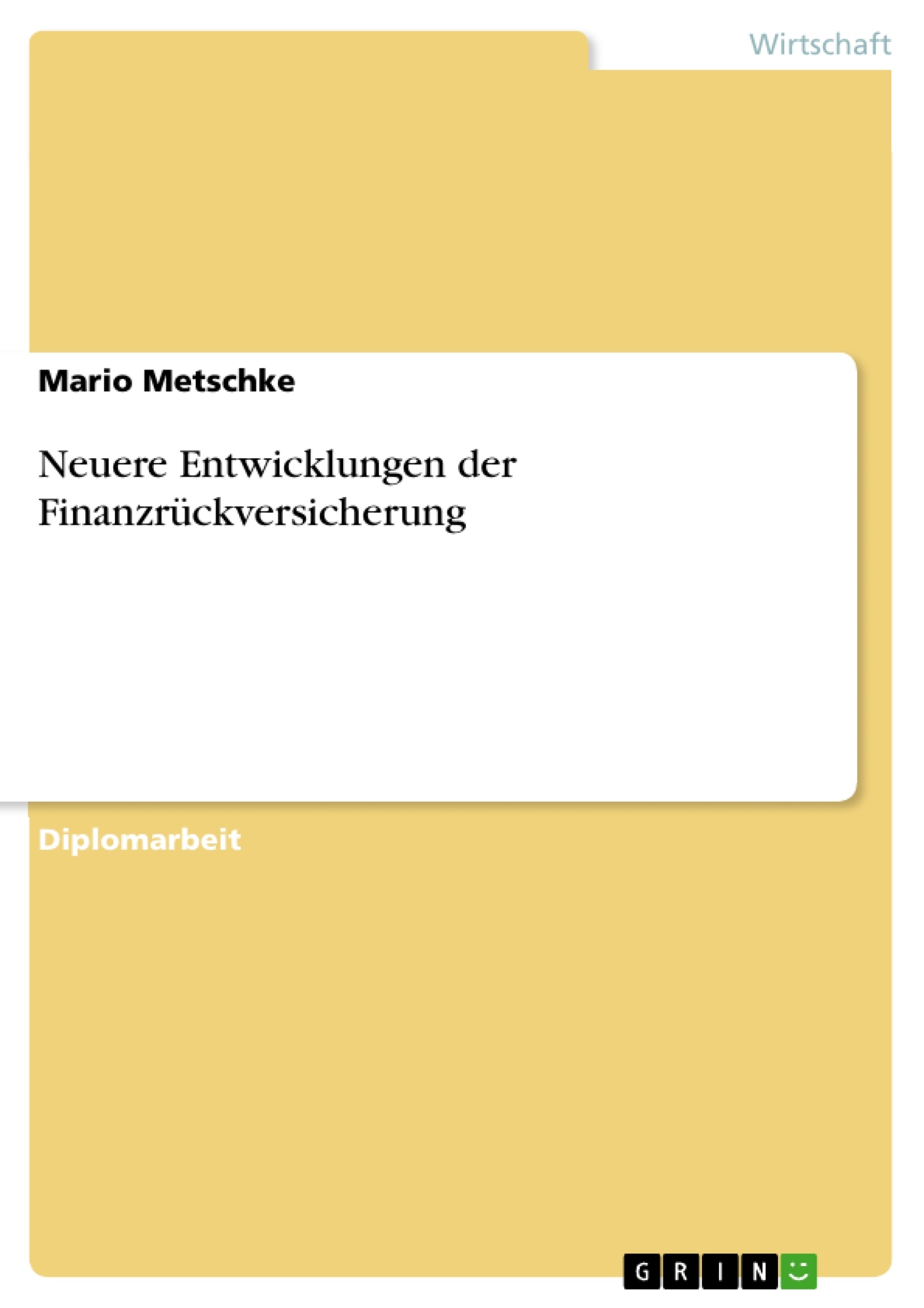Die Aufwendungen für Großschadenereignisse nahmen in den letzten Jahren sowohl für den Erst- als auch für den Rückversicherer zu u.a. bedingt durch weltweite Natur- und Technikkatastrophen sowie Terroranschläge in bisher ungekanntem Ausmaß. So verursachte u.a. der Hurrikan Hugo 1988 einen versicherten Schaden in Höhe von 5,4 Mrd. USD, der Hurrikan Andrew 1992 sogar einen Schaden von 18,3 Mrd. USD. Im Jahr 2000 entstand bei der Explosion einer Feuerwerkfabrik im niederländischen Enschede ein Schaden von ca. 285 Mio. USD. Die Terroranschläge vom 11.September 2001 verursachten Schäden weit über 20 Mrd. USD.1
Eine Deckung derartiger Risiken ist auf Grund der begrenzten Zeichnungskapazitäten und hohen Versicherungsprämien über traditionelle Rückversicherungskonzepte kaum noch realisierbar. Dies zog eine erhöhte Nachfrage nach alternativen Risikotransfer des Erst- und Rückversicherers insbesondere im Haftpflicht- und Naturkatastrophenbereich nach sich. 2 Aber auch im Bereich der Lebensversicherung ist ein steigender Bedarf an alternativen Finanzierungssystemen festzustellen, um so den Auf- und Ausbau des Kundenstammes voranzutreiben. 3
Für einen zusätzlichen Schub bei der Nachfrage nach alternativem Risikotransfer (ART) sorgten Strukturveränderungen auf der Seite der Erstversicherer. Hier gab es einen Konzentrationsprozess, der es ihnen ermöglicht, höhere Selbstbehalte zu tragen. 4 Insgesamt ist eine steigende Individualisierung der Bedürfnisse seitens der Nachfrager festzustellen, d.h. sie richten ihre Nachfrage vermehrt auf Rückversicherungs- und Finanzlösungen aus, die exakt auf ihre jeweilige Unternehmensstruktur und Risikosituation zugeschnitten sind. Mit alternativen Instrumenten der Risikofinanzierung lassen sich die bisherigen Grenzen der Versicherbarkeit aufheben. 5
In dieser Arbeit wird der Entwicklungsprozess und heutige Stand eines wichtigen Instrumentes des alternativen Risikotransfers dargestellt: Die Finanzrückversicherung. Dazu wird wie folgt vorgegangen:
Im Kapitel zwei wird zunächst der Begriff der Finanzrückversicherung mittels möglicher Definitionsansätze erläutert. Darauf aufbauend folgt im nächsten Abschnitt die Erarbeitung der Merkmale. Des Weiteren werden die Motive des Erst- und des Rückversicherers für die Zeichnung einer Finanzrückversicherung dargestellt und abschließend die Finanzrückversicherung von der traditionellen Rückversicherung abgegrenzt [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Aufbau
- 2. Grundlagen der Finanzrückversicherung
- 2.1 Begriff der Finanzrückversicherung
- 2.2 Merkmale der Finanzrückversicherung
- 2.2.1 Begrenzter Risikotransfer auf den Rückversicherer
- 2.2.2 Ergebnisteilung mit dem Erstversicherer
- 2.2.3 Mehrjährige Vertragsdauer
- 2.2.4 Berücksichtigung von Kapitalanlageerträgen
- 2.3 Motive des Erst- und des Rückversicherers
- 2.3.1 Motive des Erstversicherers
- 2.3.2 Motive des Rückversicherers
- 2.4 Abgrenzung zur traditionellen Rückversicherung
- 3. Gesetzliche Rahmenbedingungen
- 3.1 Vereinigte Staaten von Amerika
- 3.1.1 Externe Rechnungslegung
- 3.1.2 Steuerliche Behandlung
- 3.1.3 Aufsichtsrechtliche Vorschriften
- 3.2 Großbritannien
- 3.2.1 Externe Rechnungslegung
- 3.2.2 Steuerliche Behandlung
- 3.2.3 Aufsichtsrechtliche Vorschriften
- 3.3 Deutschland
- 3.3.1 Externe Rechnungslegung
- 3.3.2 Steuerliche Behandlung
- 3.3.3 Aufsichtsrechtliche Vorschriften
- 3.1 Vereinigte Staaten von Amerika
- 4. Bestimmung des versicherungstechnischen Risikos
- 5. Vertragsarten der Finanzrückversicherung
- 5.1 Einteilung der Vertragsformen
- 5.2 Retrospektive Vertragsarten
- 5.2.1 Time & Distance- Verträge
- 5.2.2 Loss Portfolio- Transfers
- 5.2.3 Adverse Development Covers
- 5.3 Prospektive Vertragsarten
- 5.3.1 Financial Quota Share
- 5.3.2 Prospektive Aggregate-Verträge
- 5.3.2.1 Reine Funded Cover
- 5.3.2.2 Reine Spread Loss
- 5.3.2.3 Kombination aus Funded Cover und Spread Loss
- 5.4 Blended Cover
- 6. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Finanzrückversicherung und analysiert deren jüngste Entwicklungen. Sie zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis dieses innovativen Rückversicherungsinstruments zu vermitteln.
- Begriff und Merkmale der Finanzrückversicherung
- Motive von Erst- und Rückversicherern
- Gesetzliche Rahmenbedingungen in verschiedenen Ländern
- Bestimmung des versicherungstechnischen Risikos
- Vertragsarten der Finanzrückversicherung
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung und Aufbau: Dieses Kapitel legt den Fokus auf die Relevanz des Themas Finanzrückversicherung und skizziert den Aufbau der Diplomarbeit.
- Kapitel 2: Grundlagen der Finanzrückversicherung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Begriff, den Merkmalen und den Motiven der Finanzrückversicherung, wobei die Abgrenzung zur traditionellen Rückversicherung ebenfalls betrachtet wird.
- Kapitel 3: Gesetzliche Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen der Finanzrückversicherung in den USA, Großbritannien und Deutschland, wobei die Aspekte der externen Rechnungslegung, der steuerlichen Behandlung und der aufsichtsrechtlichen Vorschriften im Vordergrund stehen.
- Kapitel 4: Bestimmung des versicherungstechnischen Risikos: Dieses Kapitel untersucht die Methoden zur Bestimmung des versicherungstechnischen Risikos im Zusammenhang mit der Finanzrückversicherung.
- Kapitel 5: Vertragsarten der Finanzrückversicherung: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Übersicht über die verschiedenen Vertragsarten der Finanzrückversicherung, sowohl retrospektive als auch prospektive Formen, einschließlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten.
Schlüsselwörter
Finanzrückversicherung, Rückversicherung, Risikotransfer, Ergebnisteilung, Kapitalanlageerträge, externe Rechnungslegung, steuerliche Behandlung, Aufsichtsrechtliche Vorschriften, versicherungstechnisches Risiko, Vertragsarten, Time & Distance, Loss Portfolio Transfer, Adverse Development Covers, Financial Quota Share, Prospektive Aggregate-Verträge, Funded Cover, Spread Loss, Blended Cover.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Finanzrückversicherung?
Ein innovatives Rückversicherungsinstrument, das neben dem versicherungstechnischen Risiko auch finanzielle Aspekte wie Kapitalanlageerträge und Ergebnisteilung berücksichtigt.
Warum stieg die Nachfrage nach alternativem Risikotransfer (ART)?
Zunehmende Großschäden durch Naturkatastrophen und Terrorakte machten traditionelle Deckungen teurer und begrenzten die Zeichnungskapazitäten.
Was sind retrospektive Vertragsarten?
Dazu gehören Time & Distance-Verträge und Loss Portfolio Transfers, die bereits eingetretene, aber noch nicht vollständig abgewickelte Schäden absichern.
Was unterscheidet Finanzrückversicherung von traditioneller Rückversicherung?
Finanzrückversicherung zeichnet sich durch mehrjährige Laufzeiten, begrenzten Risikotransfer und eine stärkere Gewichtung des Zeitwerts des Geldes aus.
Welche Motive haben Erstversicherer für Finanzrückversicherung?
Wesentliche Motive sind die Glättung von Bilanzergebnissen, die Optimierung der Eigenkapitalstruktur und die Erhöhung der Zeichnungskapazität.
- Quote paper
- Mario Metschke (Author), 2002, Neuere Entwicklungen der Finanzrückversicherung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9915