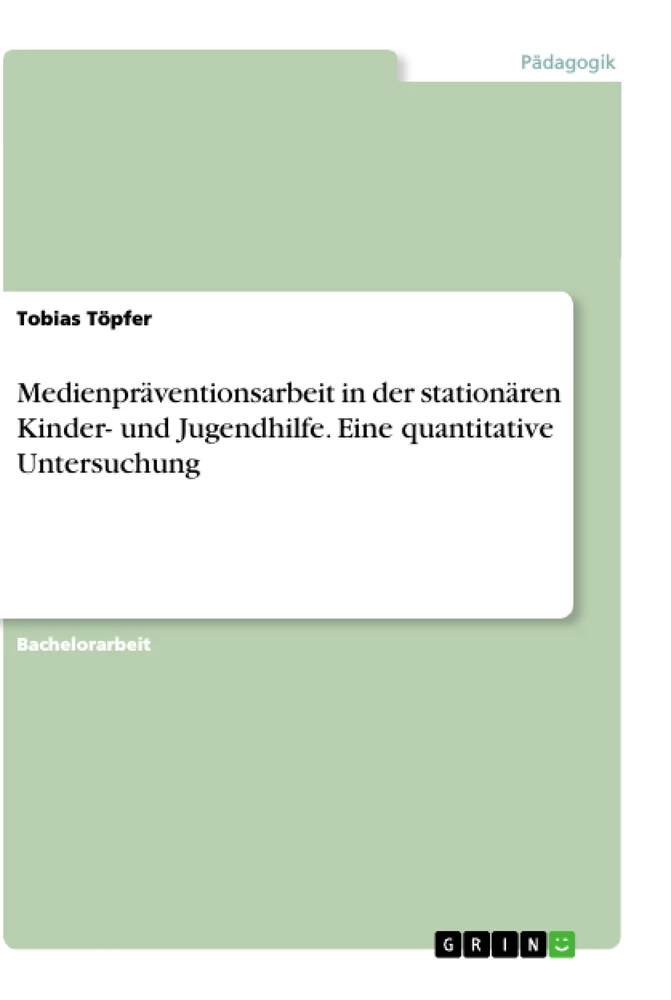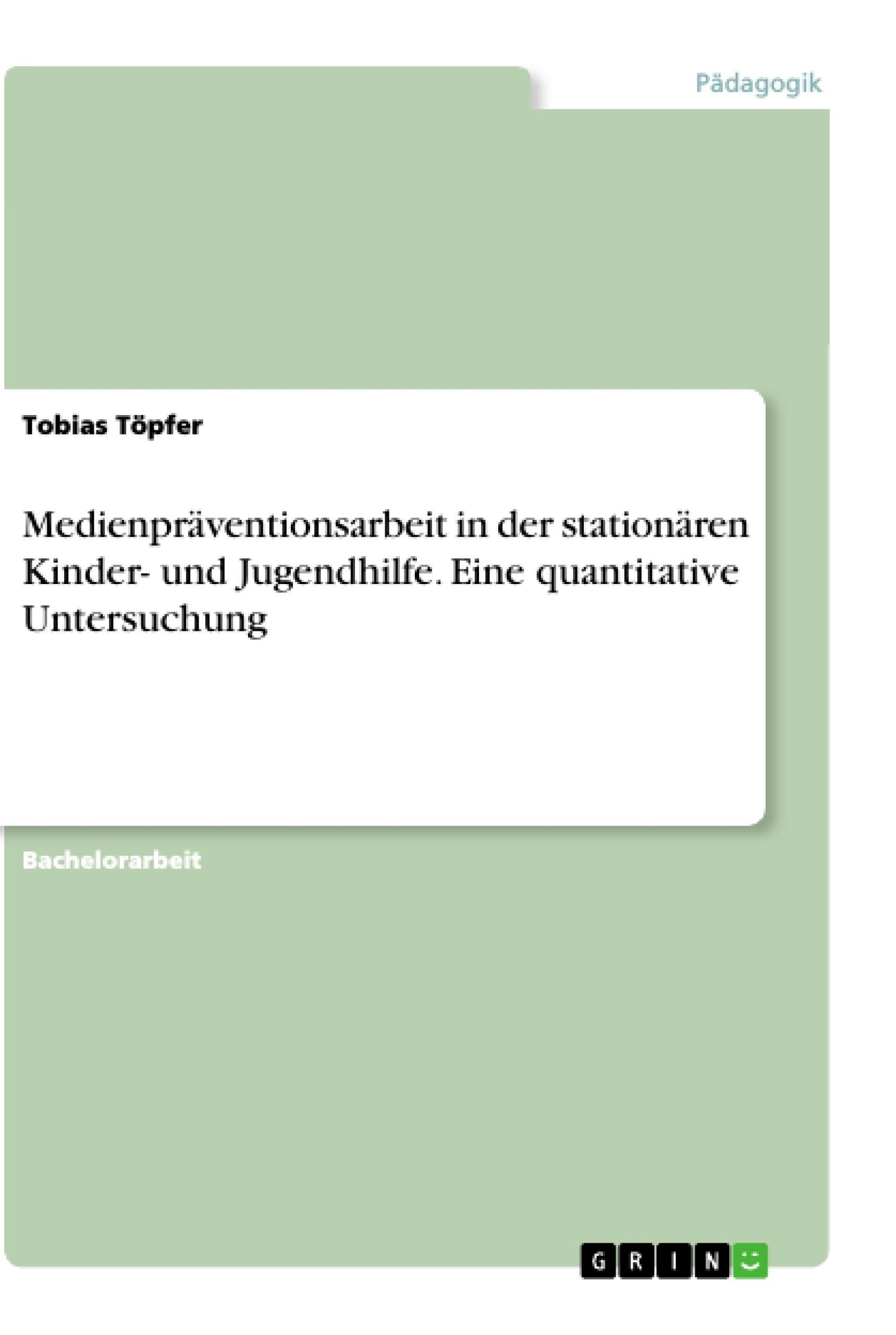Im Wandel der heutigen Gesellschaft sind besonders die digitalen Medien unabdingbar. Deutschland hat hier jedoch großen Nachholbedarf, besonders in den Schulen sowie in Pflege- und Sozialeinrichtungen wie unter anderem der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Es ist ein schwieriger Knotenpunkt mit vielen Fasern. Das pädagogische Fachpersonal kommt an seine Grenzen, da wiederum das Bildungssystem nicht die ausreichenden Medienkompetenzen vermittelt. Um professionell mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, besteht Fortbildungsbedarf.
Das Ziel dieser Forschung ist es zu bestimmen, wo die Probleme im normalen Alltag beginnen, wie in solchen Situationen zu handeln ist und welche Zukunftsperspektiven notwendig sind, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben.
Dazu werden folgende Forschungsfragen gestellt:
1. Inwiefern stehen die digitalen Medien bei Kindern und Jugendlichen im
Alter von 8 bis 16 Jahren im Fokus und mit welchem Hintergrund?
2. Wie kann das Fachpersonal der stationären Kinder- und Jugendhilfe die
Nutzung von digitalen Medien in Bezug zu deren Gefahren sinngemäß realisieren?
Diese werden anhand einer detaillierten Umfrage mittels Fragebögen in stationären Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen untersucht. Die nicht ausreichend Vorhandene Aufklärung über die Gefahr in dem World Wide Web und die dazugehörigen Maßnahmen stellen einen auffallenden Förderbedarf dar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zielsetzung und Fragestellung
- Theoretische Grundlage
- Eingrenzung der Zielgruppe
- Begriffseingrenzung Sucht
- Begriffseingrenzung Medien
- Mediengebundene Sucht
- Begriffseingrenzung Prävention
- Begriffseingrenzung Medien(-pädagogik) –prävention
- Mediennutzungsmotive
- Vorstellung der Medienpräventionsarbeit in stationären Kinder- und Jugendhilfen
- Kinderarmut
- Risikofaktor Mobbing
- Risikofaktor sexuelle Gewalt und Missbrauch
- Forschungsstand
- Empirischer Teil
- Methodisches Vorgehen
- Vorstellung der Stichprobe
- Ergebnisdarstellung und -interpretation
- Auswertung der Fragebögen
- Auswahl des Mediums in Kombination mit dem Internet und deren Gefahren
- Lernen mit den Medien
- Statement der pädagogischen Fachkräfte
- Zusammenfassung
- Methodenkritik
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Forschungsarbeit widmet sich der Medienpräventionsarbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe und zielt darauf ab, die Problematik der digitalen Mediennutzung in diesem Kontext zu beleuchten. Die Arbeit untersucht, wie Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 16 Jahren digitale Medien nutzen und welche Gefahren damit verbunden sind. Sie befasst sich außerdem mit der Frage, wie das pädagogische Fachpersonal die Nutzung digitaler Medien in Bezug auf deren Gefahren sinnvoll gestalten kann.
- Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen in der stationären Kinder- und Jugendhilfe
- Gefahren der digitalen Mediennutzung
- Medienpräventionsarbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe
- Kompetenzen des pädagogischen Fachpersonals im Umgang mit digitalen Medien
- Möglichkeiten der sinnvollen Gestaltung der Mediennutzung in der stationären Kinder- und Jugendhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Medienpräventionsarbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe ein und beleuchtet die aktuelle Situation der Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen. Sie hebt die Relevanz des Themas im Kontext der digitalen Gesellschaft hervor und zeigt die Notwendigkeit einer gezielten Medienpräventionsarbeit auf.
Das Kapitel "Theoretische Grundlage" definiert wichtige Begriffe wie Sucht, Medien, Mediengebundene Sucht, Prävention und Medien(-pädagogik)-prävention. Es grenzt die Zielgruppe der Arbeit ein und erläutert die Mediennutzungsmotive von Kindern und Jugendlichen.
Das Kapitel "Vorstellung der Medienpräventionsarbeit in stationären Kinder- und Jugendhilfen" beleuchtet die Problematik der Kinderarmut und ihre Auswirkungen auf die Mediennutzung. Es geht außerdem auf die Risikofaktoren Mobbing und sexuelle Gewalt und Missbrauch im Zusammenhang mit der Mediennutzung ein.
Das Kapitel "Forschungsstand" bietet einen Überblick über die aktuelle Forschung zum Thema Medienpräventionsarbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Es analysiert bestehende Studien und Forschungsarbeiten und identifiziert relevante Erkenntnisse und Forschungslücken.
Der "Empirische Teil" beschreibt das methodische Vorgehen der Forschung und stellt die Stichprobe vor. Es werden die Ergebnisse der durchgeführten Erhebung dargestellt und interpretiert.
Das Kapitel "Auswertung der Fragebögen" analysiert die Ergebnisse der Umfrage in Bezug auf die Auswahl des Mediums, die Nutzung digitaler Medien zum Lernen und die Aussagen der pädagogischen Fachkräfte.
Die "Zusammenfassung" fasst die wichtigsten Ergebnisse der Forschungsarbeit zusammen und zieht Schlüsse aus den gewonnenen Erkenntnissen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Medienprävention, digitale Medien, stationäre Kinder- und Jugendhilfe, Kinderarmut, Mobbing, sexuelle Gewalt und Missbrauch, Medienkompetenz, pädagogisches Fachpersonal, Mediennutzung, Gefahren der Mediennutzung, Präventionsmaßnahmen und Forschungsstand.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Medienprävention in der Jugendhilfe so wichtig?
Digitale Medien sind im Alltag von Jugendlichen allgegenwärtig, bergen aber Risiken wie Sucht, Mobbing und den Kontakt mit ungeeigneten Inhalten.
Welche Gefahren drohen Kindern im Internet besonders?
Zu den Hauptgefahren zählen Cybermobbing, sexuelle Gewalt (Grooming) sowie die Entwicklung einer mediengebundenen Sucht.
Wie kompetent ist das Fachpersonal im Umgang mit Medien?
Die Forschung zeigt oft einen Nachholbedarf bei der Medienkompetenz und einen Wunsch nach gezielten Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte.
Welche Rolle spielt Kinderarmut bei der Mediennutzung?
Kinderarmut kann den Zugang zu hochwertiger Hardware einschränken, führt aber oft zu einer intensiven Nutzung von Smartphones als primärem Internetzugang.
Wie kann Mediennutzung pädagogisch sinnvoll gestaltet werden?
Durch aktive Begleitung, Aufklärung über Risiken und die Förderung von Lernangeboten mit digitalen Medien statt reiner Verbote.
- Citation du texte
- Tobias Töpfer (Auteur), 2020, Medienpräventionsarbeit in der stationären Kinder- und Jugendhilfe. Eine quantitative Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/991933