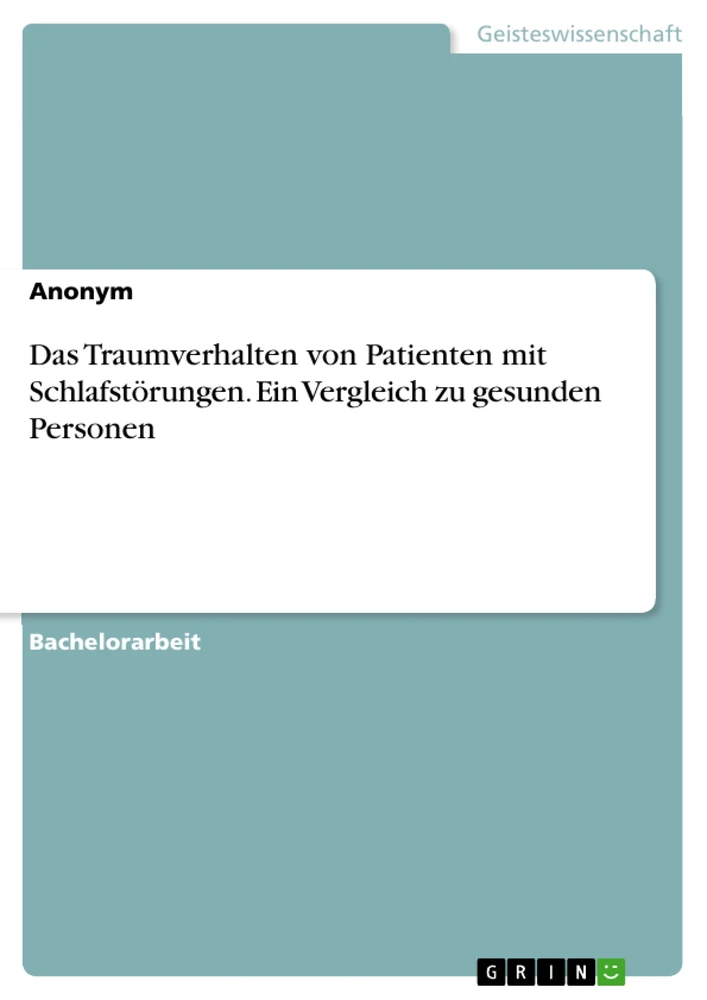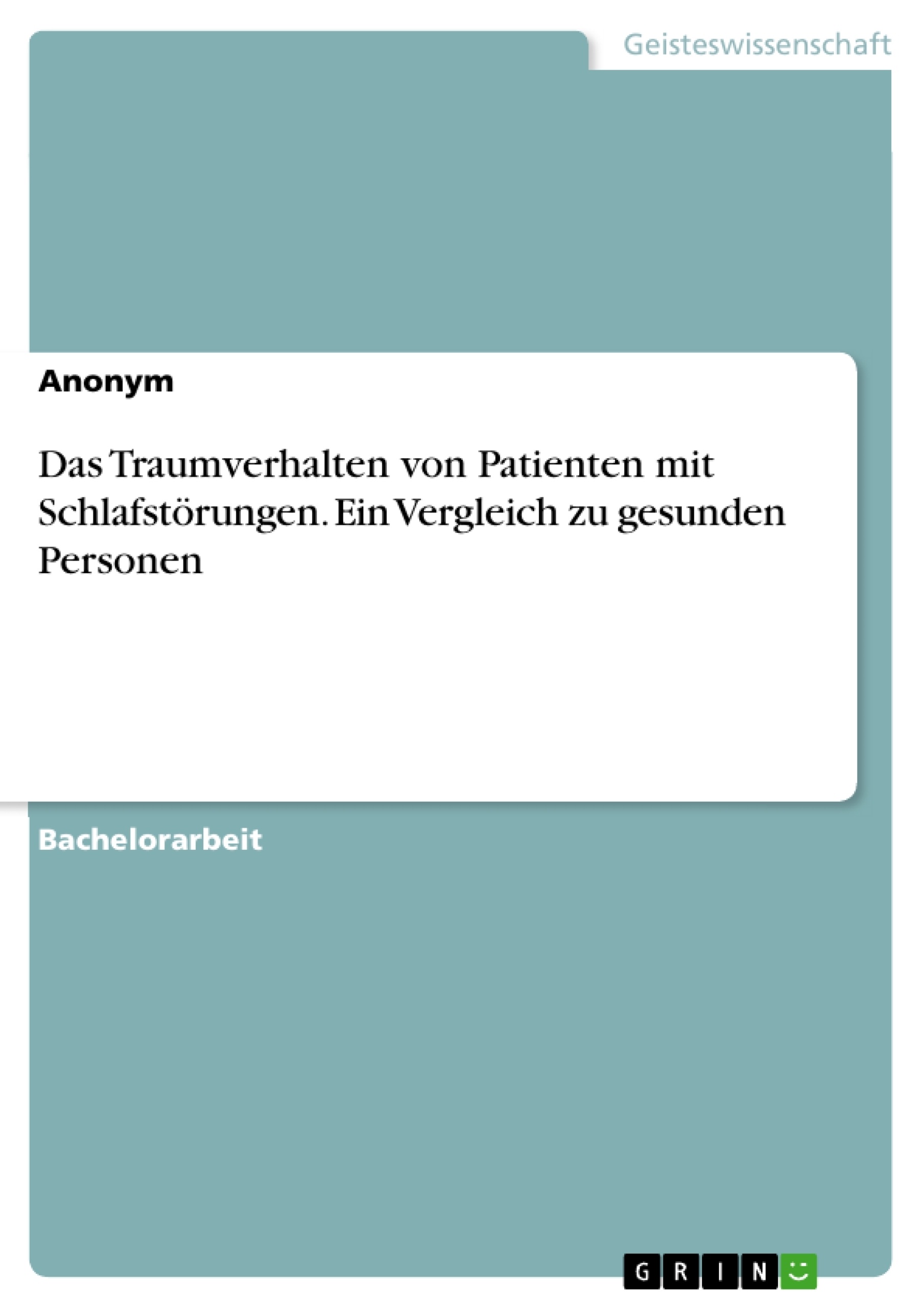Diese Arbeit hat das Ziel zu untersuchen, ob Patienten mit Schlafstörungen sich hinsichtlich ihres Traumverhaltens von gesunden Personen unterscheiden. Hierbei werden Patienten bezüglich spezifischer Traumvariablen mit gesunden Personen verglichen. Die Traumforschung gehört noch nicht zu den am intensivsten erforschten Gebieten und hat definitiv noch Forschungsbedarf, dennoch gibt es bereits zahlreiche Befunde und Studien, die interessante Einblicke in dieses Forschungsthema gewähren und dazu motivieren, weiter zu forschen. Auch zu dem Thema, mit dem sich diese Ausarbeitung beschäftigt, gibt es vielversprechende Studien, die als Basis und Ausgangspunkt für die folgenden Seiten dienen.
Vor ca. 100 Jahren hat Sigmund Freud mit der Veröffentlichung seines Buches den Weg für die moderne Traumforschung entscheidend geprägt. Freud hat die Träume als Botschaft unseres Unterbewusstseins erkannt. Er sah in diesen Botschaften einen Weg, verdrängte und nicht ausgelebte Triebe, Wünsche und Gefühle zu identifizieren. Also ein Weg zu all dem, was der Mensch sich aufgrund sozialer und kultureller Regeln im Wachleben nicht auszuleben traut. Der Traum scheint ein Weg für uns zu sein, in verschlüsselten Symbolen und ohne Konsequenzen befürchten zu müssen, diese Triebe auszuleben. Freud (1900) betonte die Wichtigkeit vom Deuten der Träume, da Menschen Entscheidungen größtenteils anhand von Vorgängen treffen, die vom Unterbewusstsein geleitet werden und ebenso von unterdrückten Wünschen, welche sogar zu einer Erkrankung der Seele führen können. Durch das Entschlüsseln des Inhalts, sei es möglich, die verborgene Thematik und somit tiefgründige Konflikte zu erkennen. Deshalb sah Freud die Traumdeutung als den Königsweg zum Unbewussten. Seit den Tagen Freuds hat sich in der Welt der Traumforschung vieles weiterentwickelt. Dank intensiver Forschung weiß man heute vor allem mehr über die physiologischen Vorgänge die mit dem Traum einhergehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Grundlagen des Schlafes
- Definition Traum
- Traumverhalten
- Traumerinnerungshäufigkeit
- Alpträume
- Umgang mit Träumen
- Kontinuitätshypothese
- Geschlechtsunterschiede
- Schlafstörungen
- Schlafbezogene Atmungsstörung (Schlafapnoe‐Syndrom)
- Insomnie
- Restless‐Legs‐Syndrom
- Andere Störungen
- Träume bei Schlafstörungen
- Traum bei Schlafbezogener Atmungsstörung
- Traum bei Insomnie
- Traum bei anderen Störungen
- Bewertung des aktuellen Forschungsstandes
- Hypothesen
- Methode
- Messinstrument
- Stichprobe und Prozedur
- Ergebnisse
- Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht, ob sich Patienten mit Schlafstörungen hinsichtlich ihres Traumverhaltens von gesunden Personen unterscheiden. Hierfür werden verschiedene Traumvariablen mithilfe des MADRE‐Fragebogens an einer großen Patientenstichprobe erfasst und die Ergebnisse mit einer ebenfalls großen Stichprobe von gesunden Personen verglichen.
- Untersuchung des Einflusses von Schlafstörungen auf die Traumerinnerungshäufigkeit und die Häufigkeit von Alpträumen.
- Analyse der Stimmungslage in Träumen von Patienten im Vergleich zu gesunden Personen.
- Prüfung von Geschlechtsunterschieden in der Traumerinnerungshäufigkeit, der Erzählhäufigkeit und der Häufigkeit von Alpträumen bei Patienten mit Schlafstörungen.
- Erarbeitung von Hypothesen basierend auf etablierten Modellen der Traumforschung, wie der Kontinuitätshypothese und dem Veranlagungs‐Stress‐Modell.
- Bedeutung der Traumsozialisation für Geschlechtsunterschiede im Traumerleben.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Grundlagen des Schlafes und der Traumdefinition. Anschließend werden verschiedene Aspekte des Traumverhaltens von gesunden Menschen beleuchtet, wie Traumerinnerungshäufigkeit, Alpträume, Umgang mit Träumen und die Kontinuitätshypothese. Es werden auch Geschlechtsunterschiede im Traumverhalten behandelt.
Im dritten Kapitel werden verschiedene Schlafstörungen vorgestellt, darunter schlafbezogene Atmungsstörungen, Insomnie, das Restless‐Legs‐Syndrom und andere Störungen.
Kapitel 4 befasst sich mit den Träumen bei Schlafstörungen. Es werden Studien und Befunde zu Träumen bei schlafbezogenen Atmungsstörungen und Insomnie zusammengefasst.
Kapitel 5 leitet Hypothesen ab, die im weiteren Verlauf der Arbeit untersucht werden. Die Methode wird in Kapitel 6 erläutert, einschließlich des verwendeten Messinstruments MADRE und der Stichprobenerhebung.
Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse der statistischen Analysen, wobei verschiedene Tabellen die Traumerinnerungshäufigkeit, die Alptraumhäufigkeit, die Stimmung in Träumen und weitere Traumvariablen zeigen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet das Traumverhalten von Patienten mit Schlafstörungen, wobei der Schwerpunkt auf den folgenden Schlüsselbegriffen liegt: Traumforschung, Schlafstörungen, Traumerinnerung, Alpträume, Kontinuitätshypothese, Veranlagungs‐Stress‐Modell, Geschlechtsunterschiede, Traumsozialisation, MADRE‐Fragebogen, Schlafapnoe‐Syndrom, Insomnie, Restless‐Legs‐Syndrom.
Häufig gestellte Fragen
Unterscheiden sich die Träume von Menschen mit Schlafstörungen von gesunden Personen?
Ja, die Forschung zeigt, dass Patienten mit Schlafstörungen (z. B. Insomnie) oft eine andere Traumerinnerungshäufigkeit und eine negativere Stimmungslage in ihren Träumen aufweisen.
Was besagt die Kontinuitätshypothese der Traumforschung?
Sie besagt, dass sich die Sorgen, Erlebnisse und Gedanken des Wachlebens in den Träumen widerspiegeln. Belastungen durch eine Schlafstörung zeigen sich also auch im Trauminhalt.
Haben Patienten mit Schlafapnoe häufiger Alpträume?
Studien untersuchen den Zusammenhang zwischen Atemaussetzern und beklemmenden Trauminhalten, wobei die physische Atemnot oft in das Traumgeschehen eingebaut wird.
Gibt es Geschlechtsunterschiede im Traumverhalten?
Frauen berichten tendenziell häufiger von Träumen und Alpträusmen als Männer, was teilweise auf eine unterschiedliche Traumsozialisation und stärkere emotionale Auseinandersetzung zurückgeführt wird.
Was ist der MADRE-Fragebogen?
Der MADRE (Mannheim Dream Questionnaire) ist ein standardisiertes Messinstrument zur Erfassung verschiedener Traumvariablen wie Erinnerungshäufigkeit, Alptraumrate und Trauminhalt.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2018, Das Traumverhalten von Patienten mit Schlafstörungen. Ein Vergleich zu gesunden Personen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/991959