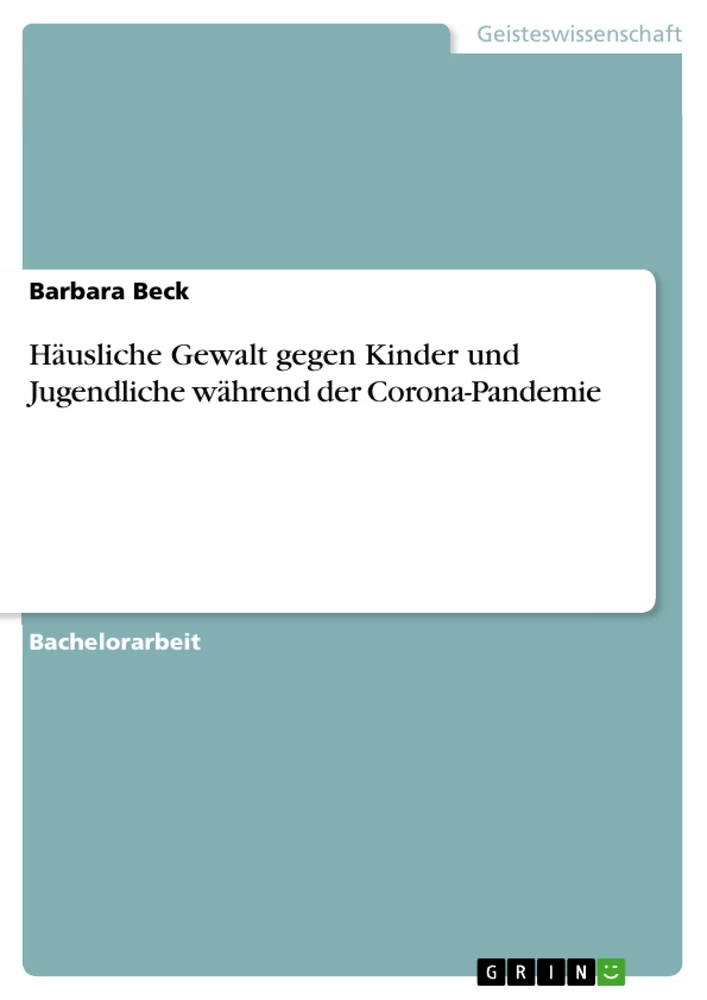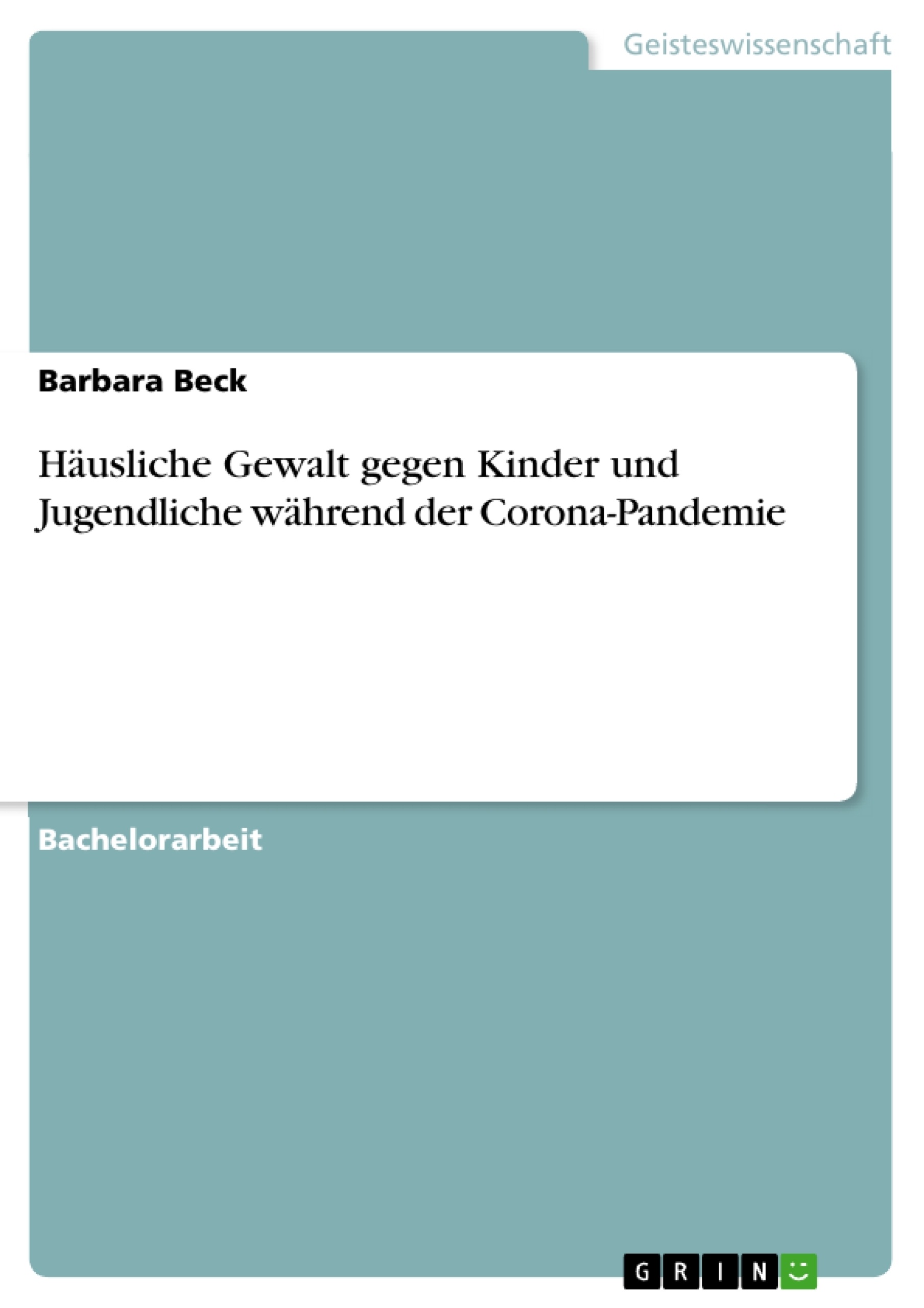Diese Forschungsarbeit befasst sich mit den unterschiedlichsten Fachliteraturen der häuslichen Gewalt bei Kindern und Jugendlichen, sowie Fachliteratur über Pandemien und Soziale Arbeit in Ausnahmezuständen. Es wurde eine Online-Umfrage durchgeführt. Die quantitative Datenerhebung ist repräsentativ. Des Weiteren wurden repräsentative Studien herangezogen, welche von renommierten Instituten durchgeführt und ausgewertet wurden.
Die Ergebnisse der Forschungsarbeit bestätigen abschließend, dass die Corona-Pandemie Gewalt begünstigt. Es wird ein Anstieg von häuslicher Gewalt gegen Kinder und Jugendliche während der Corona-Pandemie verzeichnet. Auf dieser Grundlage ist es empfehlenswert, Netzwerkstrukturen und Nachbarschaftshilfe der sozial Benachteiligten zu stabilisieren. Eine weiterführende Forschung könnte sich mit wissenschaftlichen Projekten der Netzwerkstrukturen und Nachbarschaftshilfe in Krisenzeiten beschäftigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Forschungsfrage
- Aufbau und wissenschaftliche Grundlagen der Forschungsarbeit
- Theoretische Fundierung
- Ausnahmezustand
- Soziale Benachteiligung
- Gewalt
- Häusliche Gewalt
- Spirale häuslicher Gewalt
- Kindeswohlgefährdung
- Vernachlässigung
- Körperliche und physische Misshandlung
- Seelische und psychische Misshandlung
- Sexuelle Gewalt
- Forschungsdesign/ Methodik
- Statistische Erhebungen
- Studie zu Angst, Stress und Gewalt
- Studie: Häusliche Gewalt während der Corona-Pandemie
- Online-Umfrage: Häusliche Gewalt gegen Kinder und Jugendliche während der Corona-Pandemie
- Statistik: Anstieg der Beratungen durch die Nummer gegen Kummer
- Statistik: Prof. Dr. Michael Tsokos/Gewaltschutzambulanz Charité Berlin
- Forschungsinteresse
- Forschungsergebnisse
- Soziale Ungleichheit/Benachteiligung
- Überforderung
- Handlungsempfehlung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Bachelorarbeit befasst sich mit der Problematik häuslicher Gewalt gegen Kinder und Jugendliche während der Corona-Pandemie. Die Arbeit analysiert die Auswirkungen des Ausnahmezustands auf die Entstehung und Eskalation von Gewalt innerhalb der Familie.
- Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Familienstrukturen und das familiäre Zusammenleben
- Die Entstehung und Entwicklung häuslicher Gewalt im Kontext der Pandemie
- Die Folgen häuslicher Gewalt für Kinder und Jugendliche
- Die Herausforderungen für die soziale Arbeit im Umgang mit häuslicher Gewalt während der Pandemie
- Die Bedeutung von Präventions- und Interventionsprogrammen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problemstellung der häuslichen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche während der Corona-Pandemie dar und formuliert die Forschungsfrage. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und die wissenschaftlichen Grundlagen.
- Theoretische Fundierung: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff des Ausnahmezustands im Kontext der Pandemie, insbesondere in Bezug auf soziale Benachteiligung. Es behandelt verschiedene Aspekte von Gewalt, insbesondere häusliche Gewalt und die Spirale häuslicher Gewalt, und definiert den Begriff der Kindeswohlgefährdung.
- Forschungsdesign/ Methodik: Dieses Kapitel stellt die angewandte Methodik der Arbeit vor, wobei der Fokus auf statistischen Erhebungen liegt, die relevante Daten zum Thema häusliche Gewalt während der Pandemie liefern.
- Forschungsergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten Analysen, wobei die Aspekte soziale Ungleichheit/Benachteiligung und Überforderung im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Themen häusliche Gewalt, Corona-Pandemie, Kinder und Jugendliche, Kindeswohlgefährdung, soziale Arbeit, Prävention und Intervention. Die Analyse der Forschungsdaten fokussiert auf die Auswirkungen der Pandemie auf die Familienstrukturen, die Entstehung von Gewalt und die Bedeutung von sozialer Unterstützung für Betroffene.
- Quote paper
- Barbara Beck (Author), 2020, Häusliche Gewalt gegen Kinder und Jugendliche während der Corona-Pandemie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/992188