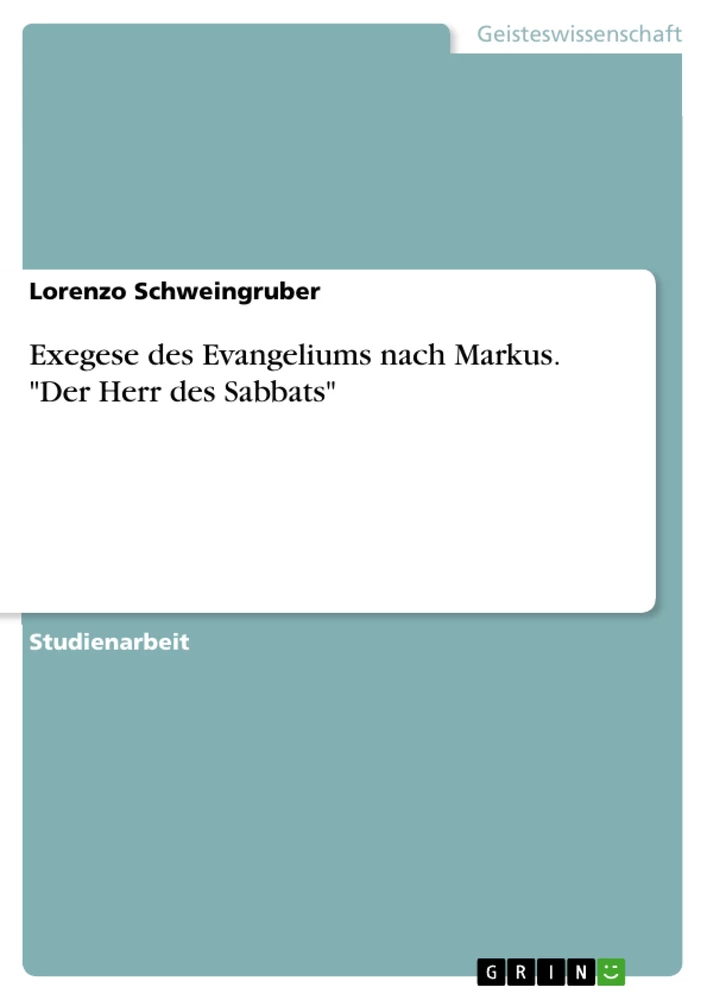In dieser Arbeit wird zum Buch "Jesus ganz anders" von Hansjörg Kägi (2018) eine Rezension verfasst, eine Wortstudie zum Begriff "Menschensohn" ausgearbeitet und eine Exegese zu Markus 3, 1-6 erstellt.
Im Buch "Jesus ganz anders" zeigt der reformierte Pfarrer Hansjörg Kägi anhand des Markusevangeliums das Leben Jesu Christi auf. Kägi nimmt den Leser auf eine Reise mit in das Leben von Jesus durch die verschiedenen Zusammenhänge, um Kulturen und Szenen kennenzulernen. Dem reformierten Pfarrer geht es in seinem Buch nicht um eine theoretische-theologische Abhandlung, obwohl Kägi einen Doktorgrad in Dogmatik erlangt hat. Kägi möchte mit seinem Buch eine Begegnung zwischen dem Leser und dem Messias schaffen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Rezension
- Wortstudie
- Verwendung des Begriffs
- Im klassischen Griechisch
- Altes Testament
- Neues Testament
- Exegese
- Textthema
- Übersetzungsvergleich
- Historische Analyse
- Synoptischer Vergleich
- Kontextuelle Analyse
- Literarische Analyse
- Pragmatische Analyse des Textprinzips
- Anwendung
- Abkürzungsverzeichnis
- Biblische Bücher
- Allgemeine Abkürzungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Evangelium nach Markus und untersucht den Begriff „Menschensohn“ im Kontext von Markus 3,1-6. Die Arbeit beinhaltet eine Rezension des Buches „Jesus ganz anders“ von Hansjörg Kägi, eine Wortstudie zum Begriff „Menschensohn“ und eine Exegese zu Markus 3,1-6.
- Rezension des Buches „Jesus ganz anders“ von Hansjörg Kägi
- Wortstudie zum Begriff „Menschensohn“
- Exegese zu Markus 3,1-6
- Analyse der Verwendung des Begriffs „Menschensohn“ im Neuen Testament
- Untersuchung der Bedeutung von Markus 3,1-6 im Kontext des gesamten Evangeliums
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Arbeit und ihre Ziele vor, erläutert die verwendete Literatur und Übersetzung sowie den Aufbau der Arbeit.
Rezension
Dieses Kapitel enthält eine Rezension des Buches „Jesus ganz anders“ von Hansjörg Kägi, welches eine neue Sichtweise auf das Leben Jesu Christi anhand des Markusevangeliums bietet.
Wortstudie
Dieses Kapitel widmet sich dem Begriff „Menschensohn“ und untersucht seine Verwendung im klassischen Griechisch, im Alten Testament und im Neuen Testament.
Exegese
Dieses Kapitel beinhaltet eine Exegese zu Markus 3,1-6. Es behandelt das Textthema, einen Übersetzungsvergleich, eine historische Analyse, einen synoptischen Vergleich, eine kontextuelle Analyse, eine literarische Analyse, eine pragmatische Analyse des Textprinzips und eine Anwendung des Textes.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Evangelium nach Markus, Menschensohn, Jesus Christus, Exegese, Synoptische Evangelien, Wortstudie, Rezension, „Jesus ganz anders“, Hansjörg Kägi, Sabbat, Heilung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Exegese zu Markus 3, 1-6?
Die Exegese untersucht die Erzählung über die Heilung eines Mannes mit einer verdorrten Hand am Sabbat und die damit verbundenen Konflikte Jesu mit den Pharisäern.
Was ist die Bedeutung des Begriffs „Menschensohn“?
Die Arbeit bietet eine Wortstudie zur Verwendung dieses Titels im klassischen Griechisch sowie im Alten und Neuen Testament, um seine theologische Relevanz zu klären.
Welches Buch wird in dieser Arbeit rezensiert?
Es wird das Buch „Jesus ganz anders“ von Hansjörg Kägi rezensiert, das eine lebensnahe Begegnung mit dem Messias im Markusevangelium anstrebt.
Welche Analyseschritte umfasst die Exegese?
Die Exegese beinhaltet einen Übersetzungsvergleich, historische, synoptische, kontextuelle, literarische und pragmatische Analysen.
Warum wird der Sabbat in diesem Kontext thematisiert?
Der Sabbat ist der zentrale Streitpunkt in Markus 3,1-6, da Jesus durch die Heilung die traditionelle Auslegung der Sabbatruhe herausfordert und sich als „Herr des Sabbats“ zeigt.
Was ist das Ziel von Hansjörg Kägis Buch laut der Rezension?
Kägi möchte keine rein theoretisch-theologische Abhandlung schreiben, sondern dem Leser eine persönliche Begegnung mit Jesus Christus ermöglichen.
- Quote paper
- Lorenzo Schweingruber (Author), 2020, Exegese des Evangeliums nach Markus. "Der Herr des Sabbats", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/992388