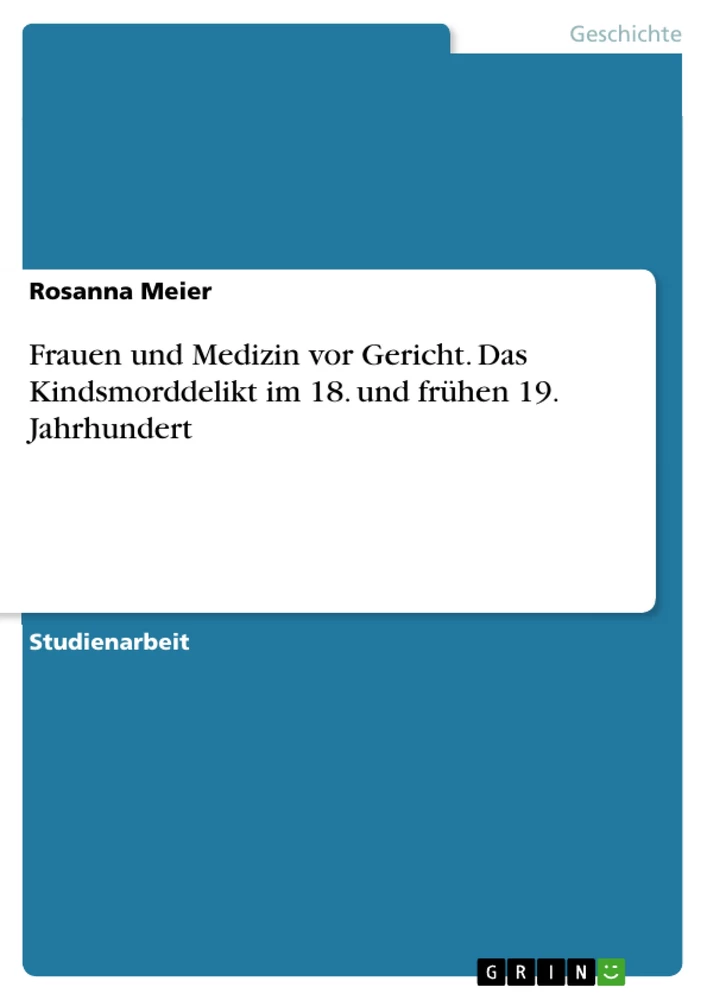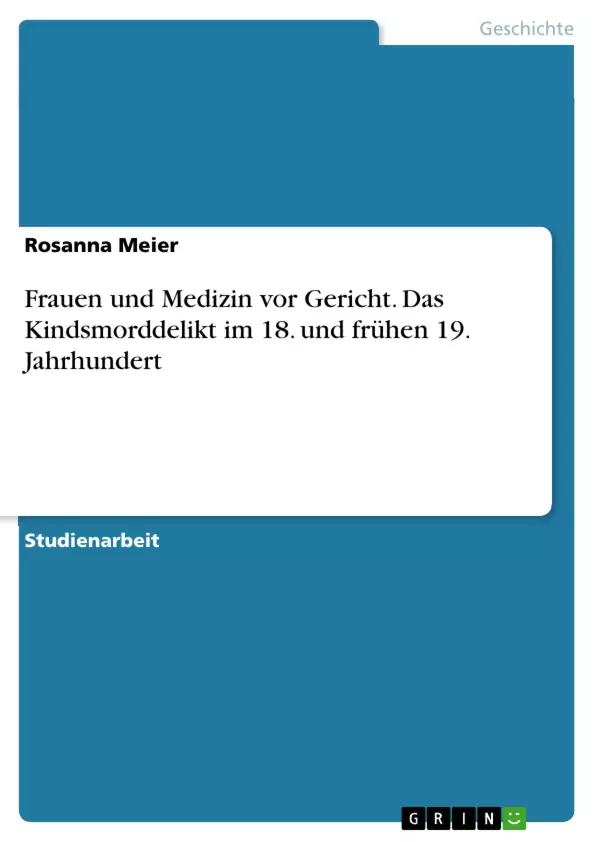Ziel dieser Arbeit ist es, den besonderen Wandel im 18. Jahrhundert innerhalb der Debatte um die Kindstötung zu erörtern sowie aufzuzeigen, inwiefern der Kindsmord eine so wichtige Schlüsselfunktion im Verlauf der Aufklärung innehatte. Die Tat der Kindestötung galt schon seit Langem als schweres Verbrechen, allerdings wurde das Delikt erst im 16. Jahrhundert systematisch verfolgt und streng bestraft. Es gibt unterschiedliche Gründe für solch eine Entwicklung.
Damit dies möglich ist, sollen zwei verschiedene Untersuchungsschwerpunkte gebildet werden. Im ersten Abschnitt handelt es sich um rechtsgeschichtliche Aspekte des Kindsmorddelikts und beschäftigt sich besonders mit der Entwicklung von Gesetzgebung und Rechtsprechung. Im zweiten Teil werden sozialgeschichtliche Aspekte der Kindstötung behandelt, welche die Täterinnen und die Tatmotive in das Zentrum der Betrachtung stellen. Anschließend wird speziell auf die Diskussion der Kindstötung im 18. Jahrhundert eingegangen, indem gesellschaftliche und ideologische Hintergründe dargestellt sowie Verhütungsmaßnahmen aufgezeigt werden, die letztendlich zur Entstehung einer neuen Kindsmordinterpretation im aufgeklärten Absolutismus führen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Aufbau, Inhalt und Ziel dieser Arbeit
- 1.2 Forschungsstand
- 2. Rechtsgeschichtliche Perspektive
- 2.1 Strafrechtliche Definition von Kindsmord
- 2.2 Entwicklung des Paragraphen § 217 aF (Kindestötung)
- 2.3 Emotionale Wirkung des Kindsmorddeliktes
- 3. Sozialgeschichtliche Perspektive
- 3.1 Charakteristika der Kindsmörderinnen
- 3.2 Die Tatmotive
- 4. Die Kindsmord-Debatte im Zuge der Aufklärung
- 4.1 Die Mannheimer Preisfrage von 1780
- 4.2 Maßnahmen zur Verhütung des Kindsmords
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der Debatte um Kindstötung im 18. Jahrhundert und deren Bedeutung im Kontext der Aufklärung. Sie verfolgt dabei zwei Schwerpunkte: einen rechtsgeschichtlichen, der die Entwicklung von Gesetzgebung und Rechtsprechung analysiert, und einen sozialgeschichtlichen, der sich mit den Täterinnen und ihren Motiven auseinandersetzt. Die Arbeit beleuchtet die gesellschaftlichen und ideologischen Hintergründe der Kindsmorddiskussion und die daraus resultierenden präventiven Maßnahmen.
- Entwicklung des Strafrechts bezüglich Kindsmord im 18. und frühen 19. Jahrhundert
- Sozio-ökonomische Profile der Kindsmörderinnen
- Motive für Kindstötung im Untersuchungszeitraum
- Die Rolle der Aufklärung in der Debatte um Kindsmord
- Präventive Maßnahmen und ihre gesellschaftlichen Implikationen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Aufbau, Inhalt und die Zielsetzung der Arbeit, welche den Wandel der Debatte um Kindstötung im 18. Jahrhundert und deren Bedeutung für die Aufklärung untersucht. Sie skizziert die beiden Untersuchungsschwerpunkte: die rechts- und sozialgeschichtliche Perspektive. Der Forschungsstand wird ebenfalls kurz beleuchtet, wobei bedeutende Werke zur Gerichtsmedizin und zur Geschichte des Kindsmords erwähnt werden, darunter Arbeiten von Michalik, Fischer-Homberger, Ulbricht, Wächterhäuser und Dürwald. Schillers Gedicht "Die Kindsmörderin" dient als einleitender Bezugspunkt, der die Bedeutung des Themas in der Literatur des 18. Jahrhunderts hervorhebt.
2. Rechtsgeschichtliche Perspektive: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung des strafrechtlichen Denkens und der Rechtspraxis in Bezug auf Kindsmord. Es definiert den Begriff „Kindsmord“ im Kontext der damaligen Zeit und untersucht die Entwicklung des Paragraphen § 217 aF (Kindestötung). Besondere Aufmerksamkeit wird der emotionalen Wirkung des Delikts und dem Wandel der gesellschaftlichen Einstellungen zu Sinn und Zweck von Strafen gewidmet. Das Kapitel präsentiert den Kindsmord als „Kristallisationspunkt der Bestrebungen um eine Humanisierung des Strafrechts“.
3. Sozialgeschichtliche Perspektive: Dieser Abschnitt befasst sich mit den sozialgeschichtlichen Aspekten der Kindstötung, indem er die Charakteristika der Kindsmörderinnen und ihre Tatmotive im Detail untersucht. Es wird analysiert, welche sozialen und ökonomischen Faktoren zu den Taten beigetragen haben und wie diese im Kontext der damaligen Gesellschaft zu verstehen sind. Das Kapitel trägt zum Verständnis der komplexen Ursachen von Kindstötung bei und betrachtet die Täterinnen nicht nur als isolierte Individuen, sondern als Akteure innerhalb eines bestimmten sozialen und historischen Umfelds.
4. Die Kindsmord-Debatte im Zuge der Aufklärung: Dieses Kapitel untersucht die öffentliche Diskussion um Kindsmord während der Aufklärung. Es analysiert die Mannheimer Preisfrage von 1780 und die daraus resultierenden Maßnahmen zur Verhütung von Kindsmord. Die gesellschaftlichen und ideologischen Hintergründe dieser Debatte werden beleuchtet, um die Entstehung einer neuen Interpretation des Kindsmordes im aufgeklärten Absolutismus zu verstehen. Der Fokus liegt auf dem Wandel der Diskurse und den verschiedenen Lösungsansätzen, die im Kontext der Aufklärung vorgeschlagen wurden.
Schlüsselwörter
Kindsmord, Kindestötung, Aufklärung, Rechtsgeschichte, Sozialgeschichte, Strafrecht, Gerichtsmedizin, Frauen, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, Tatmotive, Prävention, § 217 aF.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Kindsmord im 18. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht den Wandel der Debatte um Kindstötung im 18. Jahrhundert und deren Bedeutung im Kontext der Aufklärung. Sie betrachtet dabei sowohl die rechtsgeschichtliche Entwicklung von Gesetzgebung und Rechtsprechung als auch die sozialgeschichtlichen Aspekte, wie die Täterinnen und ihre Motive.
Welche Perspektiven werden eingenommen?
Die Arbeit verfolgt einen rechtsgeschichtlichen und einen sozialgeschichtlichen Schwerpunkt. Der rechtsgeschichtliche Schwerpunkt analysiert die Entwicklung des Strafrechts bezüglich Kindsmord. Der sozialgeschichtliche Schwerpunkt konzentriert sich auf die sozio-ökonomischen Profile der Kindsmörderinnen und deren Tatmotive.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Strafrechts bezüglich Kindsmord im 18. und frühen 19. Jahrhundert, die sozio-ökonomischen Profile der Kindsmörderinnen, die Motive für Kindstötung im Untersuchungszeitraum, die Rolle der Aufklärung in der Debatte um Kindsmord und präventive Maßnahmen und deren gesellschaftlichen Implikationen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung (mit Forschungsstand), Rechtsgeschichtliche Perspektive (Definition von Kindsmord, Entwicklung des § 217 aF, emotionale Wirkung), Sozialgeschichtliche Perspektive (Charakteristika der Kindsmörderinnen, Tatmotive), Die Kindsmord-Debatte im Zuge der Aufklärung (Mannheimer Preisfrage, präventive Maßnahmen) und Fazit.
Wie wird die Mannheimer Preisfrage von 1780 behandelt?
Die Mannheimer Preisfrage von 1780 wird im Kapitel über die Kindsmord-Debatte in der Aufklärung analysiert. Die Arbeit beleuchtet die daraus resultierenden Maßnahmen zur Verhütung von Kindsmord und die gesellschaftlichen und ideologischen Hintergründe der Debatte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kindsmord, Kindestötung, Aufklärung, Rechtsgeschichte, Sozialgeschichte, Strafrecht, Gerichtsmedizin, Frauen, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, Tatmotive, Prävention, § 217 aF.
Welche Autoren werden im Forschungsstand erwähnt?
Der Forschungsstand erwähnt bedeutende Werke zur Gerichtsmedizin und zur Geschichte des Kindsmords, darunter Arbeiten von Michalik, Fischer-Homberger, Ulbricht, Wächterhäuser und Dürwald. Schillers Gedicht "Die Kindsmörderin" dient als einleitender Bezugspunkt.
Wie wird der Begriff "Kindsmord" definiert?
Die Arbeit definiert den Begriff "Kindsmord" im Kontext des 18. Jahrhunderts und untersucht dessen Entwicklung innerhalb des damaligen strafrechtlichen Denkens und der Rechtspraxis.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
(Das Fazit ist in der bereitgestellten Zusammenfassung nicht detailliert beschrieben. Es wird jedoch erwartet, dass es die Ergebnisse der rechts- und sozialgeschichtlichen Analysen zusammenfasst und die Bedeutung der Kindsmorddebatte für die Aufklärung herausstellt.)
- Arbeit zitieren
- Rosanna Meier (Autor:in), 2012, Frauen und Medizin vor Gericht. Das Kindsmorddelikt im 18. und frühen 19. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/992502