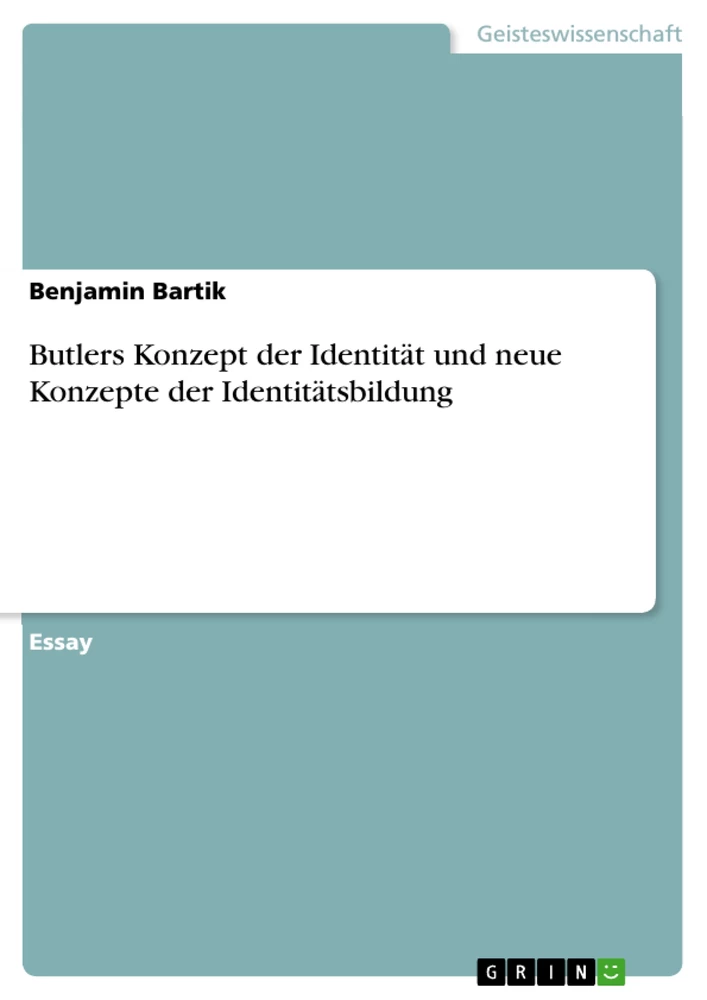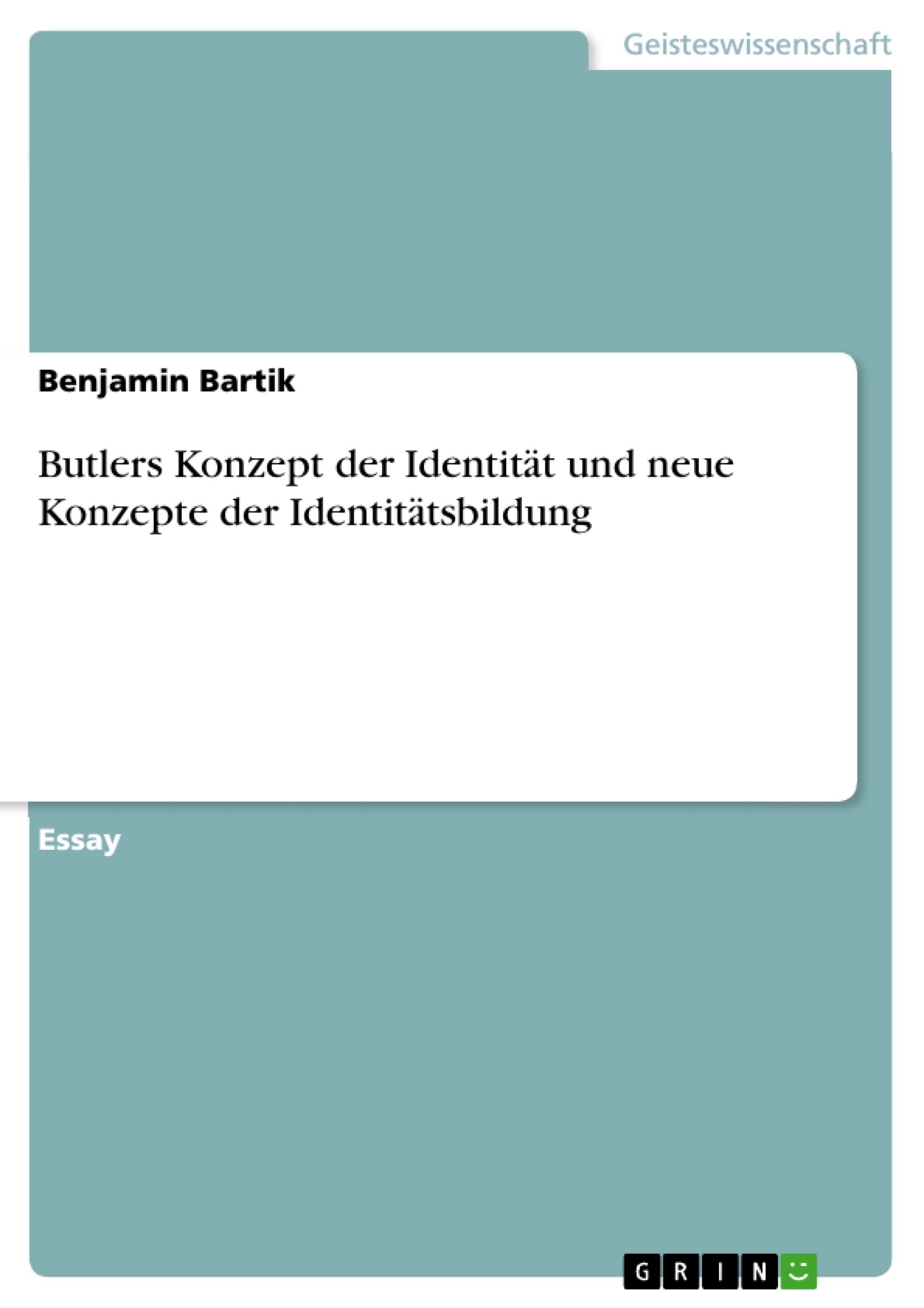In dieser Arbeit möchte ich von Butlers Konzept der Identitätsbildung ausgehend die Entwicklungen jener Communitys kritisch betrachten, die sich gegen den hegemonialen Diskurs der Geschlechterbinarität wenden, etwa durch die Etablierung von neuen Bezeichnungen wie transsexuell, Intersexuell, non-binary, queer, usw. Diese Bewegungen stellen einen wesentlichen Teil der Identitätsbildung von Personen dar, deren soziales oder biologisches Geschlecht nicht den diskursiven Kategorien der Geschlechtsnormativität entspricht, die der Anforderung nach einer bestimmten Kombination von Sex und Gender nicht entsprechen. In diesen Communitys ist die Namensgebung ein wesentlicher Teil der Identitätsbildung. Jede Art der Kombination von Sex, Gender und Desire, bzw. auch verschiedene Arten der Ablehnung dieser Kategorien hat eine eigene Bezeichnung. Die Frage, der ich mithilfe von Judith Butler nachgehen möchte, ist, ob das der richtige Weg ist, alle diskursiven Normen die Identität von Menschen betreffend zu sprengen, oder ob auch das Wege sind, zwar mehr Identitäten zu schaffen, aber immer noch der Ansicht verhaftet zu bleiben, dass es zwar viele, aber doch nicht unendlich viele Geschlechtsidentitäten gebe, denen sich Personen unterordnen müssen, denen das Verhalten von Personen entsprechen muss und die Personen durch ihr Verhalten wiederum reproduzieren.
Inhaltsverzeichnis
- Geschlechtsidentität
- Was „zählt“ als Körper?
- Sprachliche Aspekte
- Warum gerade jetzt?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Butlers Konzept der Identitätsbildung und untersucht, wie sich dieses Konzept auf die Entwicklung von Communitys auswirkt, die sich gegen den hegemonialen Diskurs der Geschlechterbinarität wenden.
- Die Konstruktion von Geschlechtsidentität als kulturelles, diskursiv konstruiertes Konstrukt
- Die Kritik an der Annahme, dass die Geschlechtsidentität eine kulturelle Interpretation des Geschlechts ist
- Die Bedeutung von sprachlichen Aspekten in der Konstruktion von Geschlechtsidentitäten
- Die Rolle des Diskurses in der Unterdrückung von Personen, die nicht den Normen des Diskurses entsprechen
- Die Problematik der Etablierung neuer Identitäten und die Frage, ob diese zur Auflösung von Machtstrukturen beitragen können
Zusammenfassung der Kapitel
Geschlechtsidentität
Dieses Kapitel untersucht Butlers Konzept der Geschlechtsidentität, das als ein sich ständig verschiebendes und kontextuelles Phänomen verstanden wird. Butler argumentiert, dass das biologische Geschlecht (sex) ein kulturelles, diskursiv konstruiertes Konstrukt ist, das als vordiskursiv dargestellt wird. Sie kritisiert die Annahme, dass die Geschlechtsidentität (gender) eine kulturelle Interpretation des Geschlechts ist. Stattdessen versteht sie die Geschlechtsidentität als einen Schnittpunkt zwischen kulturell und geschichtlich spezifischen Relationen.
Was „zählt“ als Körper?
In diesem Kapitel befasst sich die Arbeit mit der Frage, wie Menschen angesehen werden, die nicht den Normen des Diskurses entsprechen, insbesondere im Hinblick auf ihre Körperlichkeit. Butler argumentiert, dass es im herrschenden Diskurs nicht möglich ist, Körpern eine Existenz zuzusprechen, die der Markierung ihres Geschlechts vorherginge. Sie kritisiert den Versuch, durch die Etablierung neuer Bezeichnungen wie transsexuell, non-binary oder intergeschlechtlich die Normen des Diskurses zu sprengen.
Sprachliche Aspekte
Dieses Kapitel widmet sich der rein sprachlichen Ebene der Geschlechterbezeichnungen. Butler argumentiert, dass der Akt, die beiden entgegengesetzten Momente der Binarität (männlich und weiblich) zu differenzieren, dazu führt, dass sich jeder der Terme festigt und eine innere Kohärenz von anatomischem Geschlecht (sex), Geschlechtsidentität (gender) und Begehren gewinnt. Sie kritisiert die Vorstellung, dass die Schaffung neuer Bezeichnungen zur Auflösung von Machtstrukturen beitragen kann.
Warum gerade jetzt?
Dieses Kapitel untersucht die Gründe, warum gerade jetzt die Identitätsfindung und die Thematisierung des Selbst so wichtig geworden sind. Die Arbeit bezieht sich auf Schroer, der die Selbstthematisierung mit Individualisierungsprozessen verbindet. Er argumentiert, dass die Formen der Selbstthematisierung von den Institutionen abhängen, die den Menschen zur Verfügung stehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen der Geschlechtsidentität, des Diskurses, der Körperlichkeit, der Sprachlichkeit, der Individualisierung und der Selbstthematisierung. Sie analysiert die Bedeutung dieser Begriffe im Kontext der Kritik an der Geschlechterbinarität und der Etablierung neuer Identitäten.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert Judith Butler Geschlechtsidentität?
Butler sieht Geschlechtsidentität als ein kulturell und diskursiv konstruiertes Phänomen, nicht als biologische Gegebenheit.
Was kritisiert Butler an der Geschlechterbinarität?
Sie kritisiert die Vorstellung, dass es nur zwei Geschlechter gibt und dass diese durch diskursive Normen erzwungen und reproduziert werden.
Helfen neue Begriffe wie "non-binary" bei der Identitätsbildung?
Die Arbeit hinterfragt, ob neue Labels die Machtstrukturen auflösen oder lediglich neue Kategorien schaffen, denen man sich unterordnen muss.
Welche Rolle spielt die Sprache laut Butler?
Sprache festigt die Binarität; durch das Benennen von "männlich" und "weiblich" wird eine innere Kohärenz von Körper und Begehren erst konstruiert.
Warum ist Selbstthematisierung heute so wichtig?
Dies wird mit Individualisierungsprozessen in der modernen Gesellschaft erklärt, in denen die Suche nach der eigenen Identität zentral wird.
- Citar trabajo
- Benjamin Bartik (Autor), 2020, Butlers Konzept der Identität und neue Konzepte der Identitätsbildung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/993526