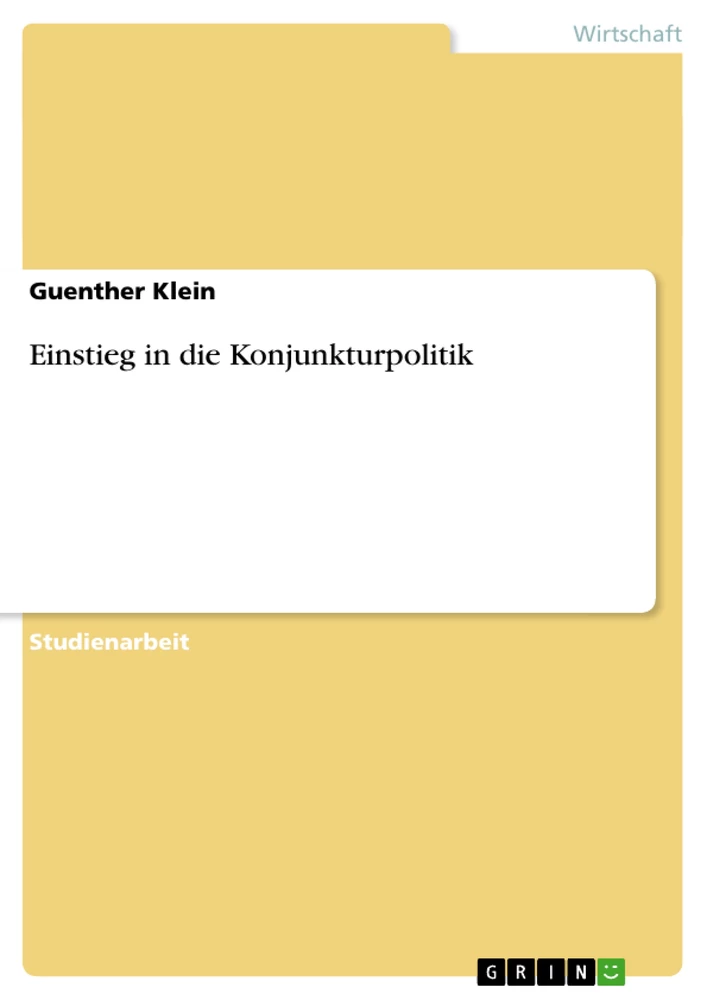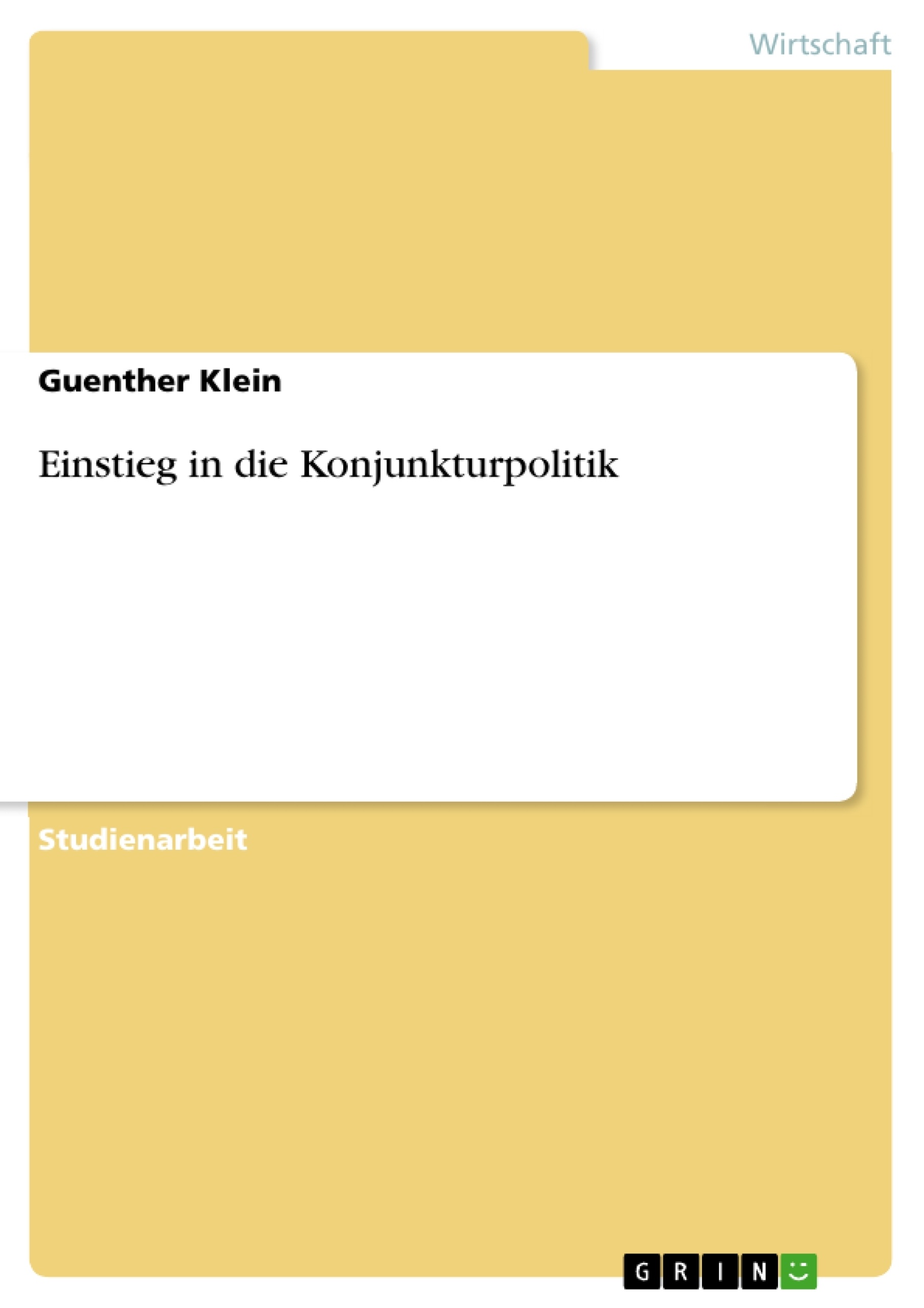Kennzeichen des Aufschwungs
Der Aufschwung wird allgemein als eine angenehme Phase betrachtet. So schauen die Deutschen wehmütig auf z.B. die Zeit Ende der 50er Jahre zurück, wo die Wirtschaft wuchs und es den Bürgen subjektiv gut ging.
Hier wäre zunächst zwischen für den Bürger "spürbaren" und den "versteckten" Anzeichen eines Aufschwungs zu unterscheiden. So werden im Aufschwung zunehmend Arbeitskräfte gesucht. Die Arbeitslosigkeit sinkt, das Volkseinkommen steigt (wie auch die Konsumgüternachfrage zunimmt), wie auch die Zinsen steigen. Die Preise für die Güter steigen ebenfalls langsam an. Investitionsgüter werden verstärkt nachgefragt, Erweiterungsinvestitionen werden getätigt. Die Gewinne steigen.
Weniger offensichtliche, dafür genau so zutreffende Indikatoren für den Aufschwung sind ein steigender Auftragsbestand verbunden mit einer zunehmenden Kapazitätsauslastung. Kurzum: Die Stimmung ist gut und die Erwartungen sind positiv.
Inhaltsverzeichnis
- I. Vom Aufschwung zum Boom
- a. Kennzeichen des Aufschwungs
- b. Der Übergang zum Boom
- c. Warum Inflation unerwünscht ist / negative Auswirkungen
- d. GELDWERTSTABILITÄT / STABILISIERUNGSPROBLEM
- II. Mittel der Geld- und Fiskalpolitik, um den Aufschwung zu stabilisieren / GLOBALSTEUERUNG
- a. Variation der Staatsausgausgaben
- b. Einnahmenpolitik
- c. Beeinflussung von privaten Investitionen
- d. Haushaltspolitik / Konjunkturausgleichsrücklage zur Abkühlung des Aufschwungs
- e. Anlagevorschrift für die Träger der Sozialversicherung
- fa. Geldpolitik zur Liquiditätsabschöpfung
- fb Offenmarktpolitik
- fc. Mindestreservepolitik
- ga. Realität der Fiskal- und Geldpolitik / Kritik zur Fiskal- und Geldpolitik
- gb. Zweifel am Erfolg von Mitteln die gegen den Boom eingesetzt werden
- gc. Milton Friedmann / Monetarismus
- III. Mögliche Gründe warum in der Vergangenheit nicht o. nur unzureichend gegen den Boom vorgegangen wurde
- a. Politiker als Stimmenmaximierer
- b. TIME LAGS / INFO MENGE
- c. Zielkonflikte / Auswirkungen der Konjunkturdämpfung auf das Ziel der Preisniveaustabilität und das Wachstumsziel
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Herausforderungen, die mit dem Übergang von einem Konjunkturaufschwung zu einem Boom verbunden sind. Sie beleuchtet die Kennzeichen eines Aufschwungs und untersucht, wie die Geld- und Fiskalpolitik versuchen können, diesen zu stabilisieren, um einer Überhitzung der Wirtschaft und negativen Folgen wie Inflation entgegenzuwirken. Des Weiteren werden die möglichen Gründe untersucht, warum die Bekämpfung eines Booms in der Vergangenheit nur unzureichend gelungen ist.
- Kennzeichen des Aufschwungs und des Übergangs zum Boom
- Negative Auswirkungen der Inflation
- Instrumente der Geld- und Fiskalpolitik zur Stabilisierung des Aufschwungs
- Zweifel an der Wirksamkeit von Maßnahmen gegen den Boom
- Gründe für das unzureichende Eingreifen gegen den Boom in der Vergangenheit
Zusammenfassung der Kapitel
I. Vom Aufschwung zum Boom
Dieses Kapitel beschreibt die Merkmale eines wirtschaftlichen Aufschwungs, von der positiven Stimmung bis hin zur steigenden Nachfrage und der wachsenden Beschäftigung. Es erläutert den Übergang zum Boom, der durch eine Überhitzung der Wirtschaft gekennzeichnet ist, mit steigenden Preisen, Überlastung der Kapazitäten und erhöhter Inflation. Die negativen Auswirkungen der Inflation, insbesondere für Gläubiger und sozial Schwache, werden ebenfalls beleuchtet.
II. Mittel der Geld- und Fiskalpolitik, um den Aufschwung zu stabilisieren / GLOBALSTEUERUNG
Dieses Kapitel behandelt verschiedene Instrumente der Geld- und Fiskalpolitik, die zur Stabilisierung des Aufschwungs und zur Abkühlung der Wirtschaft eingesetzt werden können. Dazu gehören die Steuerung der Staatsausgaben, die Einnahmenpolitik, die Beeinflussung privater Investitionen sowie die Geldpolitik zur Liquiditätsabschöpfung. Es werden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Maßnahmen diskutiert, sowie Zweifel an ihrer Wirksamkeit.
III. Mögliche Gründe warum in der Vergangenheit nicht o. nur unzureichend gegen den Boom vorgegangen wurde
Dieses Kapitel analysiert die Gründe, warum in der Vergangenheit nicht oder nur unzureichend gegen die Überhitzung der Wirtschaft im Boom eingegriffen wurde. Es beleuchtet die Rolle der Politiker als Stimmenmaximierer, die Zeitverzögerungen bei der Wirkung von Maßnahmen und die Zielkonflikte zwischen verschiedenen wirtschaftspolitischen Zielen.
Schlüsselwörter
Konjunkturpolitik, Aufschwung, Boom, Inflation, Geldpolitik, Fiskalpolitik, Staatsausgaben, Einnahmenpolitik, Investitionen, Liquiditätsabschöpfung, Überhitzung der Wirtschaft, Zeitverzögerungen, Zielkonflikte, Preisniveaustabilität, Wachstum.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die typischen Anzeichen eines wirtschaftlichen Aufschwungs?
Steigende Nachfrage, sinkende Arbeitslosigkeit, zunehmende Kapazitätsauslastung, steigende Gewinne und eine positive Erwartungshaltung bei Unternehmen und Bürgern.
Warum ist eine zu hohe Inflation in einem Boom gefährlich?
Inflation gefährdet die Geldwertstabilität, benachteiligt Gläubiger sowie sozial Schwache und kann zu einer Überhitzung der Wirtschaft führen.
Welche Instrumente hat die Fiskalpolitik zur Konjunktursteuerung?
Dazu gehören die Variation der Staatsausgaben, Einnahmenpolitik (Steuern) und die Bildung von Konjunkturausgleichsrücklagen.
Was versteht man unter „Offenmarktpolitik“ der Zentralbank?
Der Kauf oder Verkauf von Wertpapieren durch die Zentralbank, um die Liquidität am Geldmarkt und damit die Zinsen zu steuern.
Was sind „Time Lags“ in der Konjunkturpolitik?
Zeitverzögerungen zwischen dem Auftreten eines wirtschaftlichen Problems, der politischen Entscheidung über Maßnahmen und deren tatsächlicher Wirkung.
- Quote paper
- Guenther Klein (Author), 2002, Einstieg in die Konjunkturpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/9941