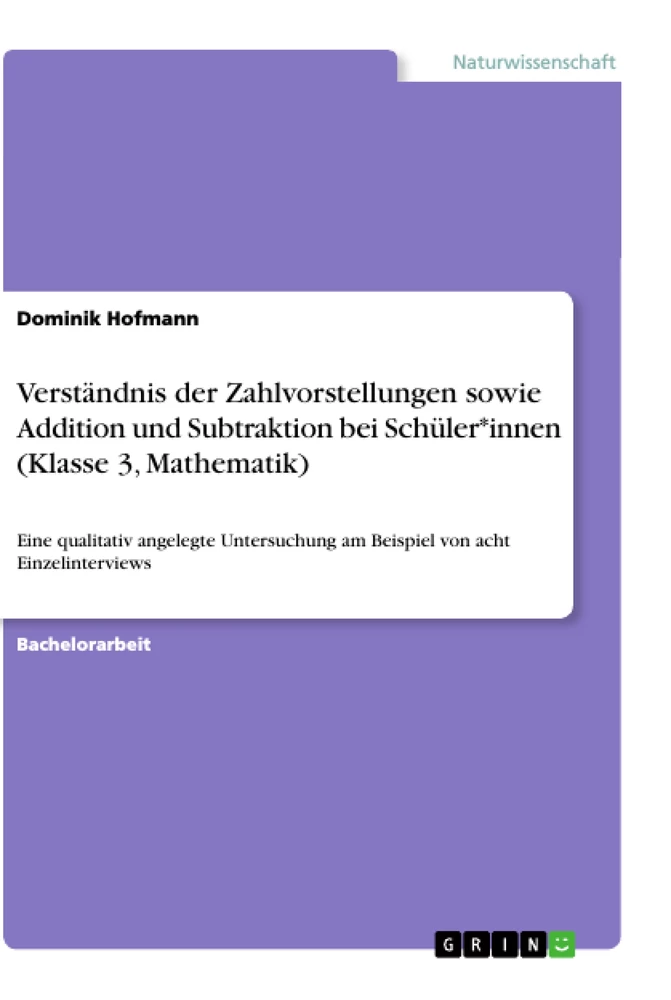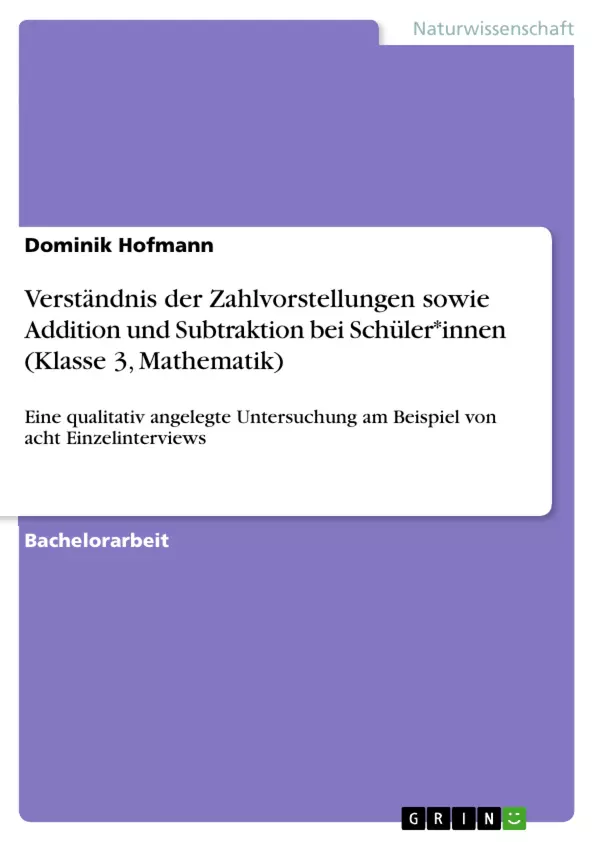Die Basis der Arbeit ist die Annahme, dass ein gelungener Mathematik-Unterricht in der Grundschule gleichgewichtig inhaltsbezogene und prozessbezogene Kompetenzen fördern soll. Das heißt, er sollte auf der einen Seite Wissen und Fertigkeiten und auf der anderen Seite Verständnis und eine positive Einstellung vermitteln. So werden neben der „Sache Mathematik“ auch das Kind als „lernendes Subjekt“ und seine Lebenswelt in den Mittelpunkt gestellt. Und zusammengeführt bedeutet dies, dass prozessbezogene Kompetenzen nur in Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten und inhaltsbezogene Kompetenzen nur mit prozessbezogenen Fähigkeiten erworben werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung – Die Sache Mathematik und das Kind als lernendes Subjekt
- 2. Theoretische Vorüberlegungen: Begrifflichkeiten, Situationen, Strategien
- 2.1 Allgemeine (prozessbezogene) und inhaltliche mathematische Kompetenzen
- 2.2 Zahlbegriffsentwicklung, Zahlvorstellungen und Stellenwertsystem
- 2.3 Fokussierung auf Addition und Subtraktion als Rechenoperationen
- 2.4 Klassifikationstypen von Rechenarten: Handlungssituationen und Hauptstrategien beim Addieren und Subtrahieren
- 3. Durchführung der Studie – Kinder als Experten und Akteure
- 3.1 Forschungsmethode und Transkription
- 3.2 Präsentation der Aufgabenbereiche im leitfadengestützten Interview
- 3.3 Lern- und Entwicklungspotentiale, kritische Ansätze und mögliche Fehler
- 3.4 Praktische Umsetzung: Schule, Schulklasse, konkrete Gegebenheiten
- 4. Auswertung – Mathematische Kenntnisvermittlung und Persönlichkeitsbildung
- 4.1 Zur Anonymisierung des Datensatzes
- 4.2 Aufgabenbezogene Auswertungen: Lernoptimierung und Förderung
- 4.3 Einbezug der mathematischen Kompetenzen in die Auswertung
- 4.4 Rückbezüge zu den theoretischen Vorüberlegungen
- 5. Fazit - Mathematische Inhalte als Werkzeug zur Welterschließung?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht das Verständnis von Zahlvorstellungen, Addition und Subtraktion bei Drittklässlern. Ziel ist es, die Ausprägung dieser mathematischen Kompetenzen qualitativ zu erforschen und den Bezug zur Lebenswelt der Kinder im Mathematikunterricht zu beleuchten. Die Arbeit basiert auf acht leitfadengestützten Einzelinterviews.
- Analyse der Zahlvorstellungen von Drittklässlern
- Untersuchung des Verständnisses von Addition und Subtraktion
- Beziehung zwischen mathematischen Kompetenzen und der Lebenswelt der Kinder
- Bewertung der inhalts- und prozessbezogenen Kompetenzen im Mathematikunterricht
- Identifikation von Lernpotentialen und Schwierigkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung - Die Sache Mathematik und das Kind als lernendes Subjekt: Die Einleitung führt in die Forschungsfrage ein: Wie sind das Verständnis der Zahlvorstellungen sowie der Operationen Addition und Subtraktion bei Schülerinnen und Schülern in der dritten Klassenstufe ausgeprägt? Sie beschreibt den Kontext der Studie – acht leitfadengestützte Einzelinterviews mit Drittklässlern – und betont die gleichgewichtige Förderung inhalts- und prozessbezogener Kompetenzen im Mathematikunterricht. Die Einleitung unterstreicht die Bedeutung des Kindes als lernendes Subjekt und den Bezug seiner Lebenswelt zum Mathematikunterricht. Ein Beispiel einer kindlichen Rechengeschichte illustriert die unterschiedlichen Perspektiven von Kindern und Erwachsenen beim Lösen mathematischer Probleme.
2. Theoretische Vorüberlegungen: Begrifflichkeiten, Situationen, Strategien: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Studie dar. Es definiert und erläutert zentrale Begriffe wie mathematische Kompetenzen (sowohl inhalts- als auch prozessbezogen), Zahlbegriffsentwicklung, Zahlvorstellungen und Stellenwertsystem. Es konzentriert sich auf Addition und Subtraktion als Rechenoperationen, klassifiziert verschiedene Rechenarten und Strategien und legt damit den Rahmen für die anschließende empirische Untersuchung. Die Kapitel 2.1 bis 2.4 liefern detaillierte Erläuterungen zu diesen Aspekten und stellen den theoretischen Bezugsrahmen für die Analyse der Interviewdaten dar.
3. Durchführung der Studie – Kinder als Experten und Akteure: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der Studie. Es erläutert die Forschungsmethode der leitfadengestützten Einzelinterviews, den Prozess der Transkription und die Präsentation der Aufgaben im Interview. Es wird auf Lern- und Entwicklungspotenziale sowie mögliche Fehler eingegangen, und die konkreten Umstände der Durchführung in der jeweiligen Schulklasse werden beschrieben. Insgesamt wird die methodische Vorgehensweise transparent und nachvollziehbar dargestellt, um die wissenschaftliche Güte der Studie sicherzustellen.
4. Auswertung – Mathematische Kenntnisvermittlung und Persönlichkeitsbildung: Dieses Kapitel präsentiert die Auswertung der durchgeführten Interviews. Es beginnt mit der Anonymisierung der Daten und beschreibt anschließend die aufgabenbezogenen Auswertungen mit dem Fokus auf Lernoptimierung und Förderung. Die Ergebnisse werden im Kontext der mathematischen Kompetenzen interpretiert, wobei Rückbezüge zu den theoretischen Vorüberlegungen hergestellt werden. Dieser Abschnitt bietet eine detaillierte Analyse der empirischen Daten und ihre Interpretation im Lichte des theoretischen Hintergrunds.
Schlüsselwörter
Zahlvorstellungen, Addition, Subtraktion, Drittklässler, Mathematikdidaktik, prozessbezogene Kompetenzen, inhaltsbezogene Kompetenzen, qualitative Forschung, Einzelinterviews, Lernpotential, Lebensweltbezug.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Bachelorarbeit: "Zahlvorstellungen, Addition und Subtraktion bei Drittklässlern"
Was ist das Thema der Bachelorarbeit?
Die Bachelorarbeit untersucht das Verständnis von Zahlvorstellungen, Addition und Subtraktion bei Schülerinnen und Schülern der dritten Klasse. Sie erforscht qualitativ die Ausprägung dieser mathematischen Kompetenzen und deren Bezug zur Lebenswelt der Kinder im Mathematikunterricht.
Welche Methode wurde verwendet?
Die Arbeit basiert auf acht leitfadengestützten Einzelinterviews mit Drittklässlern. Die Interviews wurden transkribiert und anschließend qualitativ ausgewertet.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf Theorien zur Zahlbegriffsentwicklung, Zahlvorstellungen, Stellenwertsystem, sowie auf die Unterscheidung zwischen inhalts- und prozessbezogenen mathematischen Kompetenzen. Verschiedene Rechenstrategien bei Addition und Subtraktion werden klassifiziert und analysiert.
Welche Aspekte werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Zahlvorstellungen der Drittklässler, untersucht ihr Verständnis von Addition und Subtraktion, beleuchtet den Zusammenhang zwischen mathematischen Kompetenzen und der Lebenswelt der Kinder und bewertet inhalts- und prozessbezogene Kompetenzen im Mathematikunterricht. Schließlich werden Lernpotenziale und Schwierigkeiten identifiziert.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretische Vorüberlegungen, Durchführung der Studie, Auswertung und Fazit. Die Einleitung führt in die Forschungsfrage ein und beschreibt den methodischen Ansatz. Die theoretischen Vorüberlegungen legen die Grundlagen der Studie dar. Die Durchführung der Studie beschreibt die Methodik detailliert. Die Auswertung präsentiert die Ergebnisse der Interviews und ihre Interpretation. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert ihre Bedeutung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Zahlvorstellungen, Addition, Subtraktion, Drittklässler, Mathematikdidaktik, prozessbezogene Kompetenzen, inhaltsbezogene Kompetenzen, qualitative Forschung, Einzelinterviews, Lernpotential, Lebensweltbezug.
Welche konkreten Fragen werden in der Studie behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie sind das Verständnis der Zahlvorstellungen sowie der Operationen Addition und Subtraktion bei Schülerinnen und Schülern in der dritten Klassenstufe ausgeprägt? Die Arbeit untersucht die Ausprägung der mathematischen Kompetenzen und deren Bezug zur Lebenswelt der Kinder im Mathematikunterricht.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Auswertung der Interviews wird detailliert präsentiert, mit Fokus auf Lernoptimierung und Förderung. Die Ergebnisse werden im Kontext der mathematischen Kompetenzen interpretiert und in Bezug zu den theoretischen Vorüberlegungen gesetzt.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert die Bedeutung der Ergebnisse für den Mathematikunterricht. Es wird die Frage nach mathematischen Inhalten als Werkzeug zur Welterschließung diskutiert.
Wo finde ich den vollständigen Text?
(Hier sollte der Link zum vollständigen Text eingefügt werden.)
- Citar trabajo
- Dominik Hofmann (Autor), 2020, Verständnis der Zahlvorstellungen sowie Addition und Subtraktion bei Schüler*innen (Klasse 3, Mathematik), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/995013