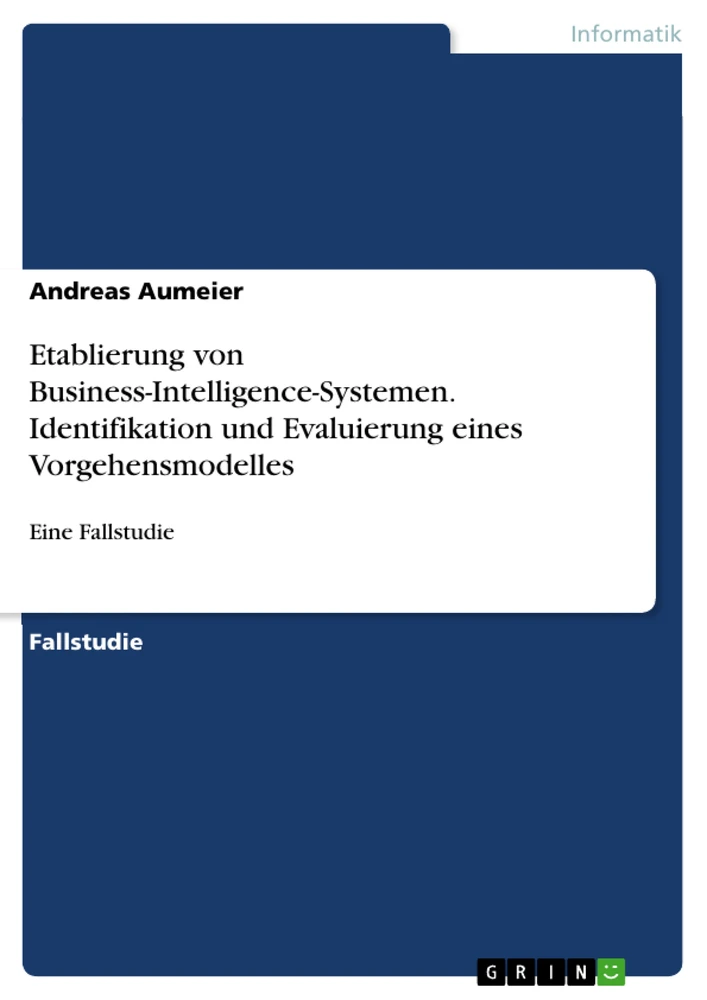Diese Fallstudie beschreibt aus der Perspektive einer fiktiven Unternehmensberatung die Identifikation und Evaluation von Vorgehensmodellen zur Einführung von Business Intelligence (BI) Systemen bei einem mittelständischen Handelsbetrieb.
Hierzu werden die Lesenden zunächst in das Thema eingeführt, anschließend die Begriffe "Projekt", "IT-Projekt" und "Vorgehensmodell" definiert um im Anschluss auf die Besonderheiten von BI-Projekten einzugehen.
Weiterhin werden die bisher in IT-Projekten etablierten Vorgehensmodelle analysiert und im Hinblick auf deren Eignung für BI-Projekte bewertet. Zum Abschluss wird ein Kriterienkatalog entwickelt, mithilfe dessen Vorgehensmodelle künftig evaluiert werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung.
- Beschreibung der Akteure.
- Ausgangssituation.
- Fallbeschreibung und Aufgabenstellung
- IT-Projekte und Vorgehensmodelle
- Begriffsdefinition: (IT-)Projekt und Vorgehensmodell.
- Sequenzielles Vorgehensmodell: Wasserfallmodell..
- Iteratives Vorgehensmodell: Rational Unified Process..
- Agiles Vorgehensmodell: Scrum
- BI-Projekte: Besonderheiten und vorhandene Modelle
- Definition und Konzept von Business Intelligence.....
- Besonderheiten von BI-Projekten.......
- Etablierte Vorgehensmodelle in BI-Projekten
- Analyse der Eignung von Vorgehensmodellen für BI-Projekte......
- Phasenorientierte Vorgehensmodelle.
- Iterative und iterativ-inkrementell Vorgehensmodelle.......
- Agile Vorgehensmodelle
- Entwicklung von Auswahlkriterien für BI-Vorgehensmodelle......
- Identifikation allgemeingültiger Auswahlkriterien in IT-Projekten........
- Berücksichtigen der Besonderheiten von BI-Projekten
- Zusammenfassen und Gewichten der Kriterien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Fallstudie analysiert die Eignung verschiedener Vorgehensmodelle für die Implementierung eines Business Intelligence (BI)-Systems im Unternehmen „BioFood". Das Ziel ist es, geeignete Modelle zu identifizieren, die den besonderen Anforderungen von BI-Projekten gerecht werden und die erfolgreiche Einführung eines zukunftsfähigen BI-Systems gewährleisten.
- Begriffsdefinition und Unterschiede von IT-Projekten und BI-Projekten.
- Analyse von klassischen, iterativen und agilen Vorgehensmodellen im Kontext von IT-Projekten.
- Identifizierung der spezifischen Herausforderungen und Besonderheiten von BI-Projekten.
- Evaluierung der Eignung verschiedener Vorgehensmodelle für die Umsetzung von BI-Projekten.
- Entwicklung von Kriterien für die Auswahl des optimalen Vorgehensmodells für BI-Projekte.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel liefert einen Überblick über die Akteure, die Ausgangssituation und die Aufgabenstellung der Fallstudie. Das zweite Kapitel widmet sich der Erläuterung des Begriffs „IT-Projekt“ und stellt verschiedene Vorgehensmodelle für IT-Projekte vor, darunter das Wasserfallmodell, das Spiralmodell und Scrum. Kapitel drei definiert den Begriff „Business Intelligence“ und beleuchtet die Besonderheiten von BI-Projekten. Es werden auch bekannte Vorgehensmodelle für BI-Projekte vorgestellt. Das vierte Kapitel untersucht die Eignung der in Kapitel zwei vorgestellten Vorgehensmodelle im Kontext von BI-Projekten. Schließlich werden in Kapitel fünf Auswahlkriterien entwickelt, die die Auswahl eines geeigneten Vorgehensmodells für BI-Projekte erleichtern.
Schlüsselwörter
Die Fallstudie fokussiert auf die Themen Business Intelligence (BI), IT-Projekte, Vorgehensmodelle, BI-Projekte, Auswahlkriterien, Data Mining, personalisierte Werbung, Informationsvorsprung und Wettbewerbsvorteil. Die Untersuchung beleuchtet die Eignung verschiedener Vorgehensmodelle für die Implementierung von BI-Systemen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel dieser Business-Intelligence (BI) Fallstudie?
Ziel ist die Identifikation und Evaluation geeigneter Vorgehensmodelle für die Einführung eines BI-Systems in einem mittelständischen Handelsbetrieb.
Welche Vorgehensmodelle werden verglichen?
Die Arbeit analysiert das sequenzielle Wasserfallmodell, den iterativen Rational Unified Process (RUP) und das agile Scrum-Modell.
Was sind die Besonderheiten von BI-Projekten?
BI-Projekte zeichnen sich durch hohe Datenkomplexität, sich ändernde Anforderungen der Fachbereiche und die Notwendigkeit einer engen Verzahnung von IT und Business aus.
Wie werden die Vorgehensmodelle evaluiert?
Mithilfe eines entwickelten Kriterienkatalogs, der sowohl allgemeine IT-Projektkriterien als auch BI-spezifische Anforderungen berücksichtigt.
Welchen Wettbewerbsvorteil bietet Business Intelligence?
BI ermöglicht einen Informationsvorsprung durch Datenanalyse (z.B. Data Mining), was personalisierte Werbung und fundiertere Managemententscheidungen erlaubt.
- Quote paper
- Andreas Aumeier (Author), 2020, Etablierung von Business-Intelligence-Systemen. Identifikation und Evaluierung eines Vorgehensmodelles, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/995872