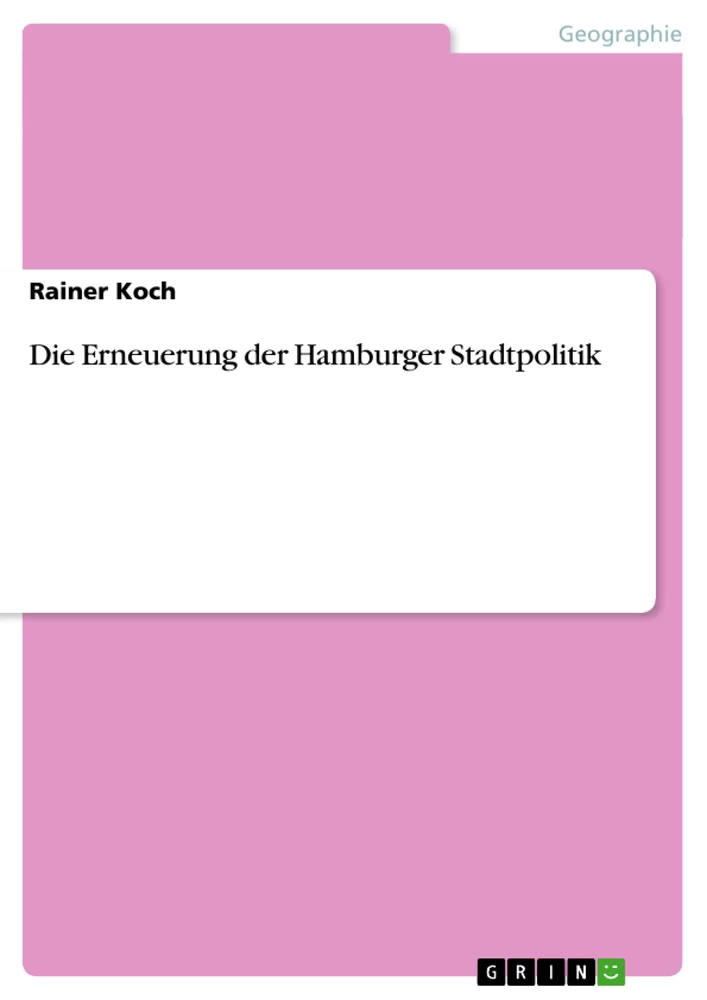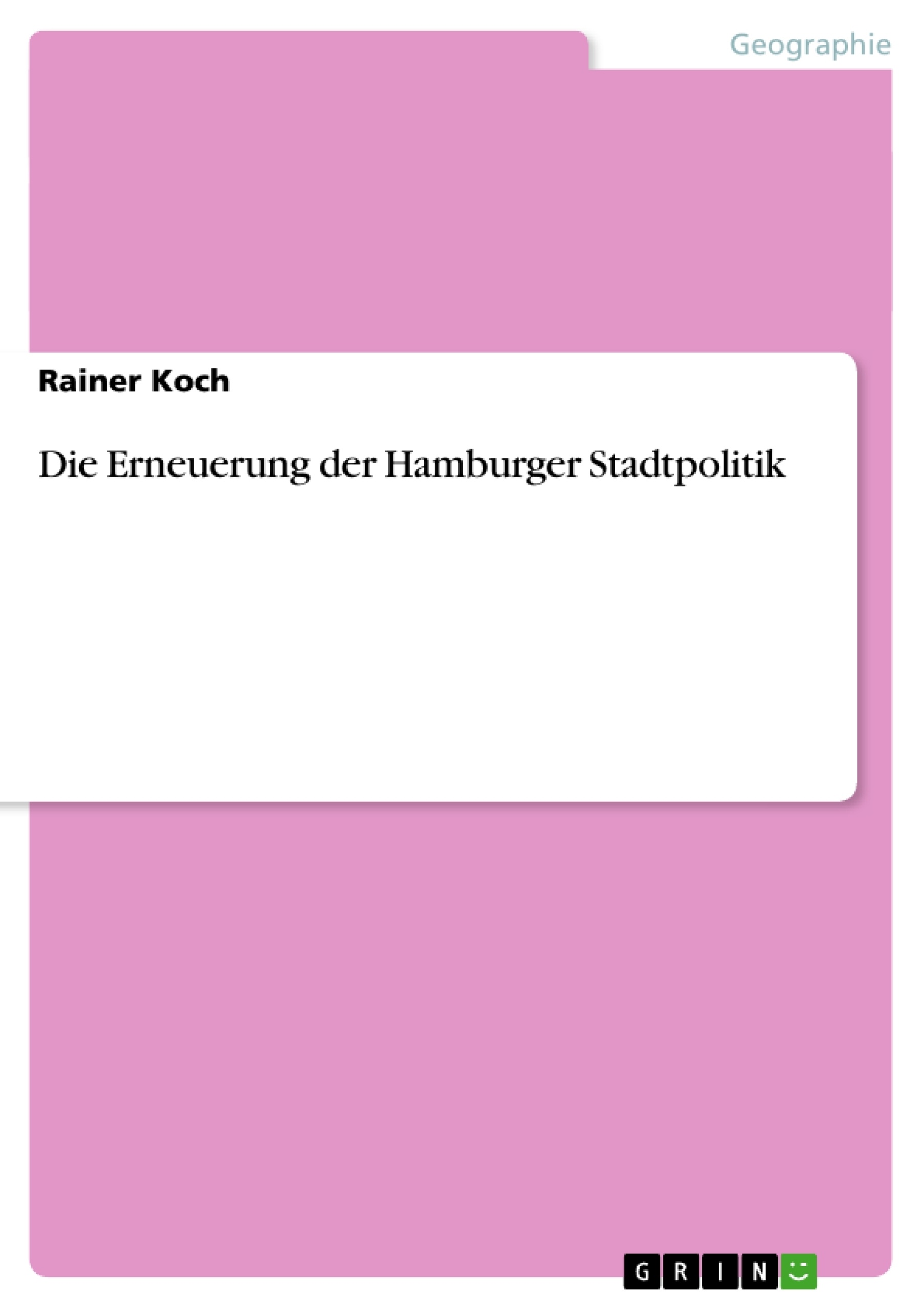Die Erneuerung der Hamburger Stadtpolitik
In diesem Kapitel soll beschrieben werden, wie die Stadt Hamburg den Niedergang der traditionellen Industrie und des Hafens aufhalten will. Zunächst soll beschrieben werden, welche Folgen die Krise des Fordismus auf Hamburg hatte und wie Hamburg versucht, die Abwärtsentwicklung zu beenden. Am Ende dieses Kapitel soll beschrieben werden, welche negativen sozialen Folgen die Stadt Hamburg in Kauf nimmt, um die Wirtschaft zu unterstützen. Das Beispiel Hamburg zeigt deutlich, wie die regionale Entwicklung aussehen kann, wenn die sozialen Auswirkungen der Erneuerung ignoriert werden.
Die Stadt Hamburg galt lange Zeit als eine der wirtschaftlich erfolgreichsten Städte Europas. Ihre Wirtschaftspolitik war auf die Unterstützung des Hafens und die damit verbundenen Handels- und Industriefunktionen ausgerichtet. Ende der 70er Jahre wurde auch die Ökonomie Hamburgs von der Krise des Fordismus erfaßt, die besonders die Bereiche Hafen, Handel und Seehafenindustrie betroffen hat. Während die Arbeitsplätze in den traditionellen Industrien und Dienstleistungen seit dieser Zeit massiv abgebaut wurden, gab es ein Wachstum in den technologisch hochentwickelten Industrien und Dienstleistungen wie dem Flugzeugbau oder der Werbewirtschaft. Da die Zahl der Beschäftigten im sekundären Sektor deutlich sank, wurde Mitte der 70er Jahre versucht, mit der Industrialisierung der Unterelbe dem Niedergang der traditionellen Industrie entgegenzutreten. Diese Maßnahme, entgegen der sich im Prozeß befindenden wirtschaftlichen Umgestaltung, erwies sich als deutliche Fehlinvestition, weil durch hohe öffentliche Subventionen dieses Projekts die Verschuldung der Stadt deutlich anstieg.
Während die Arbeitslosigkeit in Hamburg in den 70er Jahren noch relativ tief lag, stieg sie ab 1980 von 3,4% bis 1987 auf 13,9%. Bis zum Jahre 1992 sank die Arbeitslosigkeit dann auf 8%, bevor sie wieder bis auf 13,2% im August 1997 anstieg. Der kurze Aufschwung läßt sich unter anderem durch die Boomphase nach dem Zusammenbruch der DDR erklären, wodurch Hamburg zu einer zentralen Stelle zwischen Nord- und Ostsee sowie zwischen Nord- und Mitteleuropa wurde. Die Auswirkungen der Strukturkrise 1992/93 verdeutlichen aber, daß die Hamburger Wirtschaft eine strukturelle Schwäche hat. Die Sockelarbeitslosigkeit der Stadt Hamburg ist überdurchschnittlich hoch, die Arbeitslosigkeit nimmt stärker als im Bundesdurchschnitt zu und des reale Wirtschaftswachstum, das von 1989 bis Anfang 1993 sehr hoch war, liegt seit Ende 1993 wieder unter dem Durchschnitt der alten Bundesländer.
Der Wandel in der Wirtschaftspolitik Hamburgs wurde mit einer Rede des Ersten Bürgermeisters Klaus von Dohnanyi im Jahre 1983 eingeleitet, in der er forderte, daß sich die Wirtschaftspolitik nicht mehr auf den im Niedergang befindenden Hafen, sondern auf moderne und zukunftsweisende Technologien und Dienstleistungen konzentrieren solle. Im Jahre 1984 forderte die Handelskammer darauf den Wandel von Wirtschaftspolitik und Stadtentwicklungsplanung mit dem Vorhaben, bestehende Bauvorschriften sowie Auflagen für Planung und Umweltschutz außer Kraft zu setzen, was daraufhin auch teilweise geschah. Die Hamburger Wirtschaftsförderungsgesellschaft (HWF) sollte diesen neuen Kurs möglich machen, indem sie die vorhandenen Unternehmen fördern und neue zukunftsträchtige Unternehmen nach Hamburg holen sollte. Erreicht werden sollte dies dadurch, daß sie finanziell von der Wirtschaftsbehörde unterstützt wurde und unabhängig von den Behörden und der Bürgerschaft Entscheidungen treffen konnte.
Zugleich wurden Public-Private-Partnerships gegründet, die den Wissens- und Informationstransfer vorantreiben sollten. Des weiteren forderte der Erste Bürgermeister die Ausweitung von Kultur, Messe, Sport sowie Tourismus, die Förderung der weichen Standortfaktoren und die Orientierung am neuen Mittelstand. Die Handelskammer verlangte darauf die Ausweisung neuer Gewerbegebiete, die Erweiterung des Verkehrssystems sowie die Verbesserung der Stadt, indem Wohn-, Lebens- und Kulturbedingungen für gehobene Angestellte geschaffen werden.
Die Stadtentwicklungspolitik Hamburgs ist schon seit 1977 darauf abgestellt, die Bedürfnisse der höheren Einkommensschichten zu befriedigen. Dies resultierte daraus, dass die Stadt die Folgen der Suburbanisierung verringern wollte, die die Abwanderung der Bevölkerung, Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe in das Umland und in die Region waren. Der Weg dahin sollte die Umstrukturierung des Baubestandes der Hamburger Innenstadt sein. Konkret waren das die Umgestaltung der innenstadtnahen Wohnungen und der Einkaufsbereiche sowie die Vergrößerung der Flächen für Büros, Hotels und die Messe. Die Stadtentwicklungspolitik in Hamburg versucht seitdem ein Milieu zu schaffen, das besonders attraktiv für qualifizierte Arbeitskräfte und Unternehmen ist. Es sollen zusätzlich Menschen mit hoher Kaufkraft angezogen werden, nämlich Messe- und Kongreßbesucher sowie die gehobene Mittelschicht.
Durch die Veränderung der Stadtentwicklungspolitik wird auf dem Wohnungsmarkt gerade auf diejenigen Menschen gesetzt, die nach Hamburg ziehen sollen, also junge qualifizierte Arbeitskräfte mit einem höheren Einkommen. Diese erwarten Wohnungen in innenstadtnahen Bereichen, was in der Masse nur durch Gentrifizierung bewerkstelligt werden kann, da die hohe Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt anders nicht befriedigt werden kann. Dies bedeutet, daß Mietwohnungen durch Modernisierung, Verwandlung in Eigentumswohnungen oder durch Erhöhung der Miete aufgewertet werden, wodurch die ursprüngliche, nicht so kaufkräftige, Bevölkerung verdrängt wird. Der Prozeß der Gentrifizierung läuft schon seit den 70er Jahren: Von 1973 bis 1983 wurden in Hamburg insgesamt 500 Mio DM investiert um 126.500 Wohnungen zu modernisieren. Die wirtschaftliche Umstrukturierung bewirkt neben der Gentrifizierung auch, daß es eine Polarisierung der Einkommen gibt. Der Einschätzung von Jens Dangschat, daß Wohlstand und Armut räumlich konzentriert sind, kann ich nur bedingt folgen, da es eine sehr deutliche Segregation der Einkommensgruppen in Hamburg gibt. Es gibt in Hamburg 18 Stadtteile, deren Bewohner ein durchschnittliches Jahreseinkommen von unter 41.000 DM haben und 16 Stadtteile, deren Bewohner durchschnittlich über 71.000 DM verdienen. Es ist auffällig, daß die ärmeren Stadtteile eher um die Innenstadt herum und südlich des Hafens liegen, während die reicheren Bewohner eher im Norden und Westen Hamburgs leben. Die Gebiete, in denen sich eine Gentrifizierung vollzieht, werden auf längere Sicht durch Verdrängungen ebenfalls zu den Gebieten der sozial stärkeren Einwohner gehören.
Eine andere Folge des hohen Bedarfs an Wohnungen ist, daß die Mietpreise seit 1987 in Hamburg über dem Bundesdurchschnitt ansteigen, da es einen erheblichen Fehlbestand von Wohnungen gibt. Auch wenn der Wohnungsbau in Hamburg in den letzten Jahren sehr expansiv war und sich die Zahl der Baufertigstellungen im Zeitraum von 1991 bis 1995 von jährlich 4.582 auf 9.750 mehr als verdoppelt wurde, ergibt sich nur eine geringe Entlastung auf dem Wohnungsmarkt, da es in dieser Zeitspanne einen erheblichen Bevölkerungszuwachs von über 40.000 Menschen gab.
Ein weiteres Problem der Stadt Hamburg ist, daß immer mehr Gelder für soziale Ausgaben gezahlt werden müssen. Die Zahl der Sozialhilfeempfänger stieg von 8,5% im Jahre 1985 auf 11,2% im Jahre 199053, die Wohngeldzahlungen stiegen von 78 Millionen DM auf 192,4 Millionen DM zwischen 1980 und 1989.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in "Die Erneuerung der Hamburger Stadtpolitik"?
Das Kapitel beschreibt, wie Hamburg versucht, den Niedergang von traditioneller Industrie und Hafen aufzuhalten. Es analysiert die Folgen der Fordismus-Krise für Hamburg und die Maßnahmen zur Beendigung der Abwärtsentwicklung, einschließlich der negativen sozialen Konsequenzen.
Welche wirtschaftlichen Herausforderungen hatte Hamburg zu bewältigen?
Hamburg erlebte einen Niedergang in Hafen, Handel und Seehafenindustrie aufgrund der Krise des Fordismus. Arbeitsplätze in traditionellen Sektoren wurden abgebaut, während es ein Wachstum in technologisch fortgeschrittenen Industrien gab. Der Versuch, mit der Industrialisierung der Unterelbe entgegenzuwirken, erwies sich als Fehlinvestition.
Wie hat sich die Arbeitslosigkeit in Hamburg entwickelt?
Die Arbeitslosigkeit stieg in Hamburg von 3,4% im Jahr 1980 auf 13,9% im Jahr 1987. Nach einem Rückgang bis 1992 stieg sie bis August 1997 wieder auf 13,2%. Die Strukturkrise von 1992/93 verdeutlicht eine strukturelle Schwäche der Hamburger Wirtschaft.
Welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen wurden ergriffen?
Die Wirtschaftspolitik konzentrierte sich ab 1983 auf moderne Technologien und Dienstleistungen anstelle des Hafens. Die Handelskammer forderte Änderungen in Bauvorschriften und Umweltschutzauflagen. Die Hamburger Wirtschaftsförderungsgesellschaft (HWF) sollte Unternehmen fördern und neue anziehen. Public-Private-Partnerships wurden gegründet, und Kultur, Messe, Sport sowie Tourismus wurden gefördert.
Welche Rolle spielt die Stadtentwicklungspolitik?
Die Stadtentwicklungspolitik ist seit 1977 darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse höherer Einkommensschichten zu befriedigen, um die Folgen der Suburbanisierung zu verringern. Ziel ist die Umstrukturierung des Baubestandes der Innenstadt und die Schaffung eines attraktiven Milieus für qualifizierte Arbeitskräfte und Unternehmen.
Was bedeutet Gentrifizierung in Hamburg?
Gentrifizierung bedeutet die Aufwertung von Mietwohnungen durch Modernisierung, Umwandlung in Eigentumswohnungen oder Mieterhöhungen, wodurch die ursprüngliche, weniger kaufkräftige Bevölkerung verdrängt wird. Dieser Prozess läuft seit den 70er Jahren und führt zu einer Polarisierung der Einkommen und einer Segregation der Einkommensgruppen.
Wie hat sich der Wohnungsmarkt entwickelt?
Die Mietpreise in Hamburg steigen seit 1987 über dem Bundesdurchschnitt, da ein erheblicher Fehlbestand an Wohnungen besteht. Trotz des expansiven Wohnungsbaus wird der Wohnungsmarkt nur geringfügig entlastet, da es gleichzeitig einen erheblichen Bevölkerungszuwachs gibt.
Welche sozialen Probleme bestehen?
Die Stadt Hamburg muss immer mehr Gelder für soziale Ausgaben aufwenden. Die Zahl der Sozialhilfeempfänger und Wohngeldzahlungen ist gestiegen.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Wirtschafts- und Stadtentwicklungspolitik führt zu einer Ausgrenzung von Bevölkerungsteilen, die nicht mehr für die Wirtschaft verwertbar sind, während qualifizierte Arbeitskräfte angeworben werden. Die Polarisierung wird in Kauf genommen, um die Wirtschaft zu stärken.
- Citation du texte
- Rainer Koch (Auteur), 2000, Die Erneuerung der Hamburger Stadtpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99590