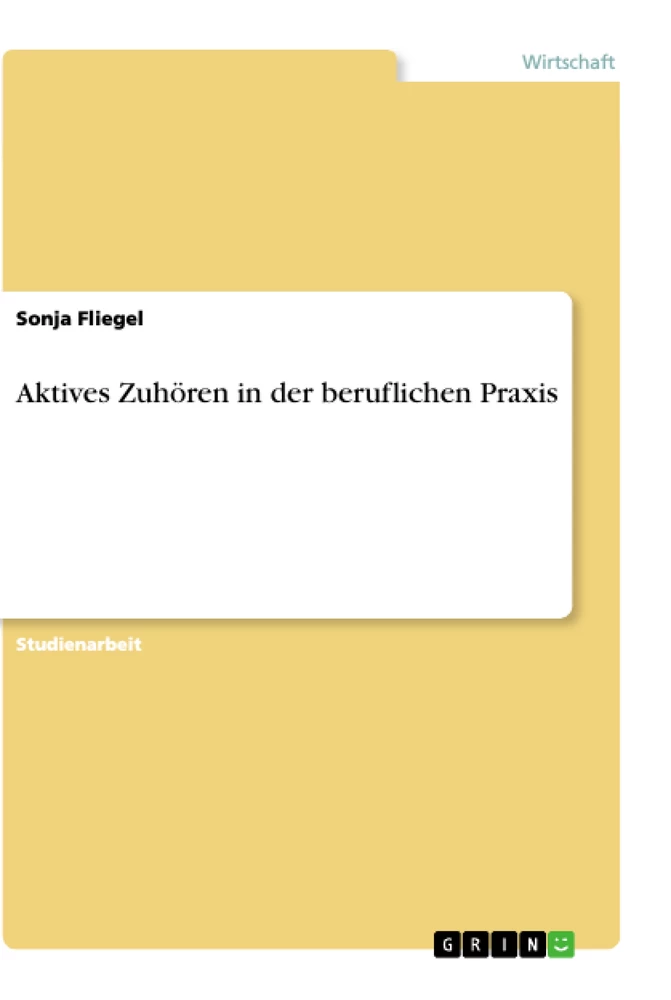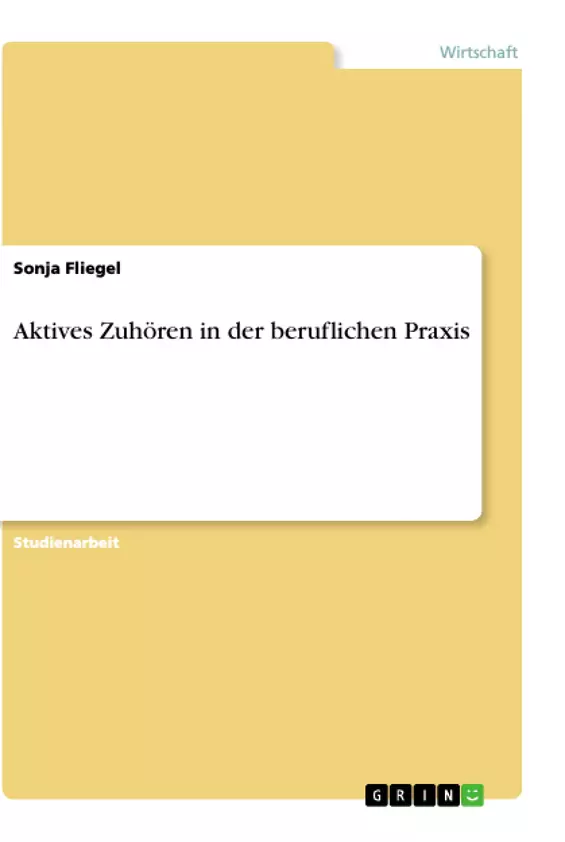In der Hausarbeit sollen zunächst die Grundlagen der Kommunikation erläutert werden. Hierzu betrachte ich die Thesen von Paul Watzlawick näher und untersuche die nicht-direktive Beratungsmethode von Carl R. Rogers, die für das Aktive Zuhören grundlegend ist.
Im Anschluss betrachte ich das „Kommunikationsquadrat“ nach Schulz von Thun näher, in dem die Erkenntnisse von Watzlawick und Rogers kombiniert und ergänzt werden. Im zweiten Teil der Hausarbeit definiere ich Aktives Zuhören und beschreibe die zugehörigen Rahmenbedingungen und Methoden. Im letzten Abschnitt soll die Methodik des Aktiven Zuhörens anhand eines Fallbeispiels aus meiner beruflichen Praxis angewendet und erörtert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Grundlagen der Kommunikation
- 2.1 Die nicht-direktive Beratung
- 2.2 Das Kommunikationsquadrat
- 2.2.1 Die vier Botschaften
- 2.2.2 Die vier Ohren
- 3 Aktives Zuhören
- 3.1 Die Aktivierung des Selbstkundegabe-Ohrs
- 3.2 Paraphrasieren und Verbalisieren
- 4 Fallbeispiel aus der beruflichen Praxis
- 4.1 Fallbeispiel unter Anwendung des Aktiven Zuhörens
- 4.2 Fallanalyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht das aktive Zuhören in der beruflichen Praxis. Ziel ist es, die Grundlagen der Kommunikation zu erläutern und die Methode des aktiven Zuhörens anhand eines Fallbeispiels zu veranschaulichen. Die Arbeit verbindet theoretische Konzepte mit praktischer Anwendung.
- Grundlagen der Kommunikation nach Watzlawick und Rogers
- Die nicht-direktive Beratung als Grundlage für aktives Zuhören
- Das Kommunikationsquadrat nach Schulz von Thun
- Methoden des aktiven Zuhörens
- Anwendung des aktiven Zuhörens in der Behindertenhilfe
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung: Die Einleitung führt in das Thema „Aktives Zuhören in der beruflichen Praxis“ ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie verweist auf die Bedeutung des Zuhörens und kündigt die Auseinandersetzung mit den Grundlagen der Kommunikation, dem aktiven Zuhören und einem Fallbeispiel aus der Behindertenhilfe an. Der Bezug auf Michael Ende’s Momo unterstreicht die Bedeutung des authentischen Zuhörens und legt den Grundstein für die anschließende theoretische und praktische Betrachtung.
2 Grundlagen der Kommunikation: Dieses Kapitel befasst sich mit den Grundlagen der Kommunikation, ausgehend von Paul Watzlawicks fünf Axiomen. Es werden die Inhalts- und Beziehungsebene der Kommunikation detailliert erläutert, sowie die Bedeutung der unterschiedlichen Kommunikationsstrukturen und der analogen und digitalen Kommunikation. Die verschiedenen Wirklichkeitsauffassungen der Kommunikationspartner nach Watzlawick werden dargestellt und mit den Thesen von Carl R. Rogers in Verbindung gebracht, der die Bedeutung individueller Wahrnehmungen betont.
2.1 Die nicht-direktive Beratung: Dieses Kapitel beschreibt die nicht-direktive Beratungsmethode von Carl R. Rogers im Gegensatz zur direktiven Beratung. Es betont die zentrale Rolle des Klienten und seiner Gefühlswelt im Beratungsprozess. Die nicht-direktive Beratung zielt darauf ab, den Klienten zur eigenständigen Problemlösung zu befähigen, anstatt ihm Lösungen vorzugeben. Die Rolle des Beraters besteht darin, aktiv zuzuhören und den Klienten in seiner Selbstfindung zu unterstützen.
3 Aktives Zuhören: Dieses Kapitel definiert das aktive Zuhören und beschreibt die zugehörigen Methoden und Rahmenbedingungen. Es baut auf den zuvor dargestellten Theorien von Watzlawick und Rogers auf und integriert diese in die Praxis des aktiven Zuhörens. Der Fokus liegt auf der Aktivierung des Selbstkundegabe-Ohrs und Techniken wie Paraphrasieren und Verbalisieren als essentielle Bestandteile des aktiven Zuhörens.
Schlüsselwörter
Aktives Zuhören, Kommunikation, Watzlawick, Rogers, Schulz von Thun, Kommunikationsquadrat, nicht-direktive Beratung, Behindertenhilfe, Fallbeispiel, Beziehungsebene, Inhaltsebene.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Aktives Zuhören in der beruflichen Praxis
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit befasst sich mit dem Thema "Aktives Zuhören in der beruflichen Praxis". Sie untersucht die Grundlagen der Kommunikation, insbesondere die Theorien von Watzlawick und Rogers, und erläutert die Methode des aktiven Zuhörens anhand eines Fallbeispiels aus der beruflichen Praxis (vermutlich Behindertenhilfe). Die Arbeit verbindet theoretische Konzepte mit praktischer Anwendung und beinhaltet eine Einführung, Kapitel zu den Kommunikationsgrundlagen (inkl. Kommunikationsquadrat und nicht-direktiver Beratung), aktives Zuhören (mit Methoden wie Paraphrasieren und Verbalisieren) und eine Fallstudie mit Analyse.
Welche Theorien werden behandelt?
Die Arbeit stützt sich auf die Theorien von Paul Watzlawick (fünf Axiome der Kommunikation, Inhalts- und Beziehungsebene), Carl R. Rogers (nicht-direktive Beratung) und Friedemann Schulz von Thun (Kommunikationsquadrat). Die verschiedenen Wirklichkeitsauffassungen der Kommunikationspartner werden dargestellt und die Bedeutung individueller Wahrnehmungen betont.
Was ist aktives Zuhören und wie wird es definiert?
Aktives Zuhören wird in der Hausarbeit definiert und durch Methoden wie Paraphrasieren und Verbalisieren erläutert. Es baut auf den Theorien von Watzlawick und Rogers auf und integriert diese in die praktische Anwendung. Ein Schwerpunkt liegt auf der Aktivierung des "Selbstkundegabe-Ohrs" des Zuhörenden.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit enthält eine Einführung, ein Kapitel zu den Grundlagen der Kommunikation (inkl. Unterkapiteln zur nicht-direktiven Beratung und dem Kommunikationsquadrat), ein Kapitel zum aktiven Zuhören, ein Kapitel mit einem Fallbeispiel aus der beruflichen Praxis inklusive Analyse und abschließend Schlüsselwörter.
Welches Fallbeispiel wird verwendet?
Die Hausarbeit enthält ein Fallbeispiel aus der beruflichen Praxis (der genaue Kontext wird nicht explizit genannt, aber es wird impliziert, dass es aus der Behindertenhilfe stammt), das die Anwendung des aktiven Zuhörens veranschaulicht und anschließend analysiert wird.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Aktives Zuhören, Kommunikation, Watzlawick, Rogers, Schulz von Thun, Kommunikationsquadrat, nicht-direktive Beratung, Behindertenhilfe, Fallbeispiel, Beziehungsebene, Inhaltsebene.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, die Grundlagen der Kommunikation zu erläutern und die Methode des aktiven Zuhörens anhand eines Fallbeispiels zu veranschaulichen. Ziel ist die Verbindung von theoretischen Konzepten mit praktischer Anwendung.
- Citation du texte
- Sonja Fliegel (Auteur), 2017, Aktives Zuhören in der beruflichen Praxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/995920