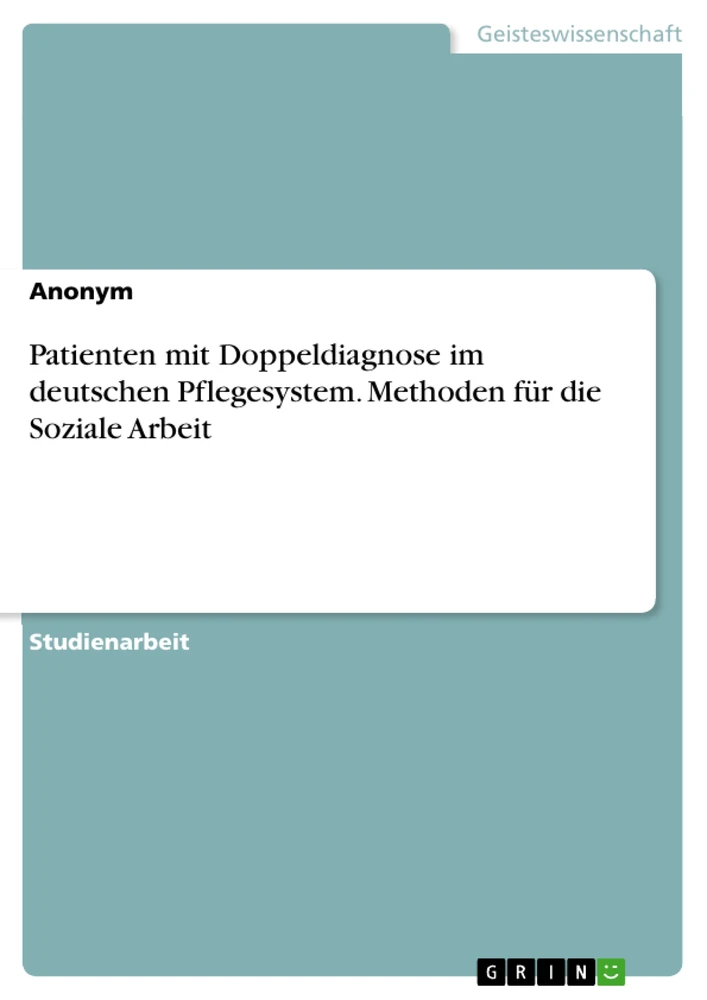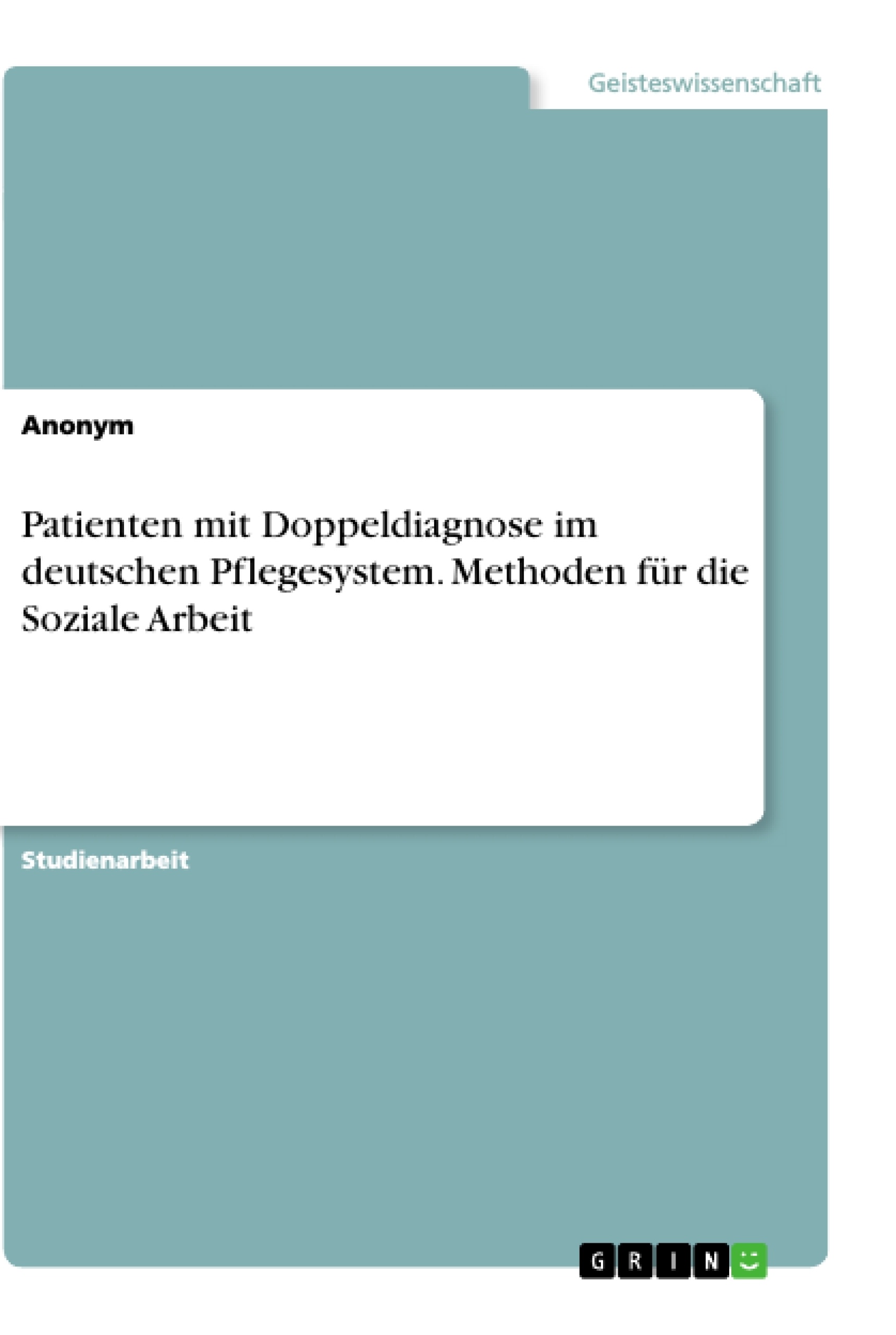Diese Hausarbeit thematisiert grundlegende sozialarbeiterische Methoden für den Kontakt mit Doppeldiagnose-Patienten.
Menschen mit Doppeldiagnosen stellen keine kleine Randgruppe im Pflegesystem dar. So wird der Anteil von Menschen mit Persönlichkeitsstörung bei Alkoholkranken viermal so hoch veranschlagt wie bei Menschen ohne Suchterkrankung. Die epidemiologic catchment area (ECA) study des National Institute of Mental Health (NIMH) von 1990 ergab, dass die Häufigkeit von Substanzmissbrauch/-abhängigkeit bei schizophrenen Menschen 47% beträgt.
Allerdings ist die Gefahr für DD-Patienten/innen durch die Raster der Pflegesysteme zu rutschen immer noch groß, da für viele suchttherapeutische Einrichtungen eine diagnostizierte Psychose ein Ausschlusskriterium für eine stationäre Aufnahme darstellt. Umgekehrt verkompliziert langandauernder Konsum von Suchtmitteln den Krankheitsverlauf von Persönlichkeitsstörungen und dessen Behandlung.
Das Resultat davon ist, dass viele Patienten/innen mit Doppeldiagnosen sich in verschiedenen Pflegesystemen aufhalten, ohne einen adäquaten Umgang oder Behandlung zu erfahren.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Stand der Forschung
- 3 Begriffsklärung
- 3.1 Krankheitsbild der Doppeldiagnose
- 3.1.1 Ätiologische Erklärungsmodelle der Doppeldiagnose
- 3.2 Methoden der Sozialen Arbeit
- 3.2.1 Einzelfallhilfe
- 3.2.2 Soziale Gruppenarbeit
- 3.2.3 Gemeinwesenarbeit
- 4 Methoden der sozialen Arbeit bei Doppeldiagnose-Patienten
- 4.1 Einzelfallhilfe mit Doppeldiagnose-Patienten
- 4.2 Soziale Gruppenarbeit mit Doppeldiagnose-Patienten
- 4.3 Gemeinwesenarbeit mit Doppeldiagnose-Patienten
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Thematik der Doppeldiagnose (DD) in der Sozialen Arbeit. Sie untersucht den aktuellen Forschungsstand, definiert zentrale Begriffe und erörtert methodische Ansätze der Sozialen Arbeit im Umgang mit DD-Patienten.
- Herausforderungen bei der Behandlung von DD-Patienten, die sich aus der Interdependenz von Suchterkrankungen und psychischen Störungen ergeben.
- Der integrative Ansatz, der die gleichzeitige Behandlung beider Störungen in einem interdisziplinären Team ermöglicht.
- Die Bedeutung von Psychoedukation, motivierender Gesprächsführung und Ergebnisoffenheit in der therapeutischen Praxis.
- Methodische Ansätze der Sozialen Arbeit, die auf die Bedürfnisse von DD-Patienten abgestimmt sind, wie z. B. Einzelfallhilfe, soziale Gruppenarbeit und Gemeinwesenarbeit.
- Die Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Sozialarbeitern, Psychotherapeuten und Suchttherapeuten.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Doppeldiagnose ein und beleuchtet die besondere Herausforderung, die DD-Patienten für das Pflegesystem darstellen. Kapitel 2 beleuchtet den aktuellen Forschungsstand und die Schwierigkeiten, die sich aus dem Zusammentreffen von psychiatrischer und suchttherapeutischer Behandlung ergeben. Kapitel 3 befasst sich mit der Begriffsklärung, definiert zentrale Begriffe wie Komorbidität und Doppeldiagnose und erklärt die verschiedenen Formen der psychischen Störungen und Suchtmittelmissbrauchs.
Das Kapitel 4 widmet sich den Methoden der Sozialen Arbeit im Umgang mit DD-Patienten und stellt die besonderen Herausforderungen und Möglichkeiten der Einzelfallhilfe, der Sozialen Gruppenarbeit und der Gemeinwesenarbeit dar.
Schlüsselwörter
Doppeldiagnose, Komorbidität, psychische Störungen, Suchtmittelmissbrauch, Suchterkrankung, integrative Therapie, Psychoedukation, motivierende Gesprächsführung, Einzelfallhilfe, Soziale Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit, Interdisziplinäre Zusammenarbeit.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2019, Patienten mit Doppeldiagnose im deutschen Pflegesystem. Methoden für die Soziale Arbeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/995949