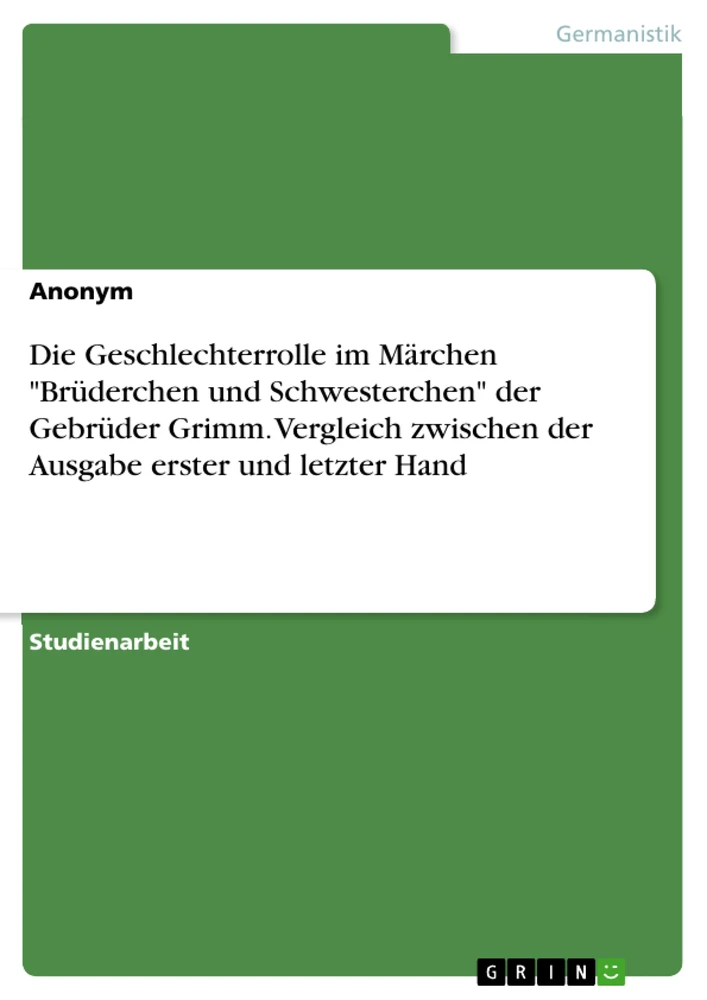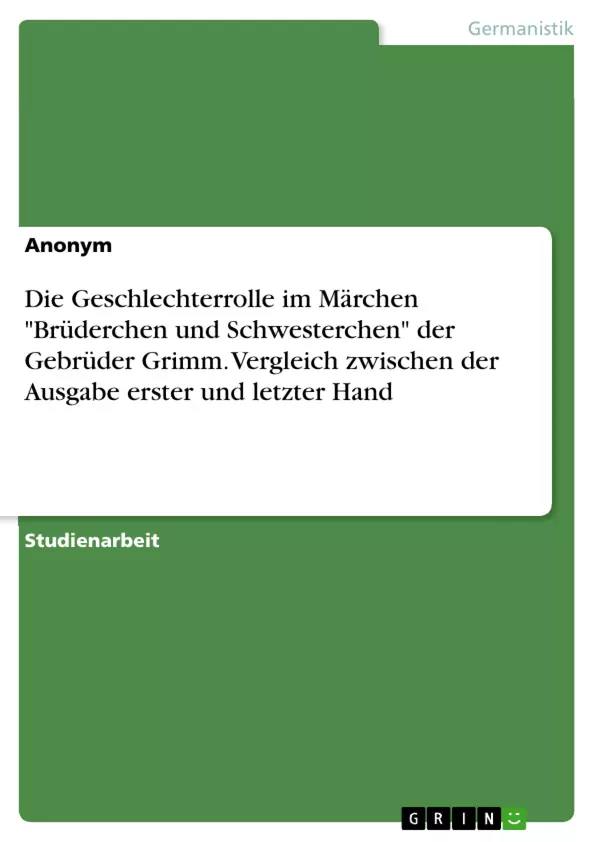Das KHM der Gebrüder Grimm "Brüderchen und Schwesterchen" soll den Gegenstand dieser Analyse darstellen. Dabei wird das Bild der Frauen, deren Beziehung untereinander und die Entwicklung der Hauptfigur verglichen und interpretiert. In Märchen ist das Bild der Frau vielseitig und ändert sich innerhalb des Märchens stark. Bei der Analyse werden drei Leitfragen beantwortet. Welche Eigenschaften werden in dem Märchen "Brüderchen und Schwesterchen" mit den heutigen Frauenbildern in Verbindung gebracht? Wie verändert sich das Frauenbild, ausgehend von der Gestalt des Schwesterchens, von der Kindheit bis zum Erwachsenenalter? Welche Bedeutung haben die Beziehungen zwischen den im Märchen agierenden Frauen und welches Frauenbild wird dargestellt? Schlussendlich werden die gezogenen Erkenntnisse der Analyse zusammengefasst und der Einfluss auf den Leser erörtert. Ein Fazit der Analyse stellt mögliche Verbesserungsvorschläge dar.
Die meisten Menschen kennen Literatur hauptsächlich in Form von Märchen. Kindheitserinnerungen vom abendlichen Vorlesen sind ein Grund, warum Märchen einen besonderen Stellen-wert für uns haben. Sie wurden anfangs von Generation zu Generation mündlich weitergetragen. Die bekannten Anfangs- und Schlussätze "Es war einmal" oder "und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute" der Gebrüder Jacob und Wilhelm Grimm gehören zu ihren Kinder- und Hausmärchen (KHM). Im Laufe der Zeit wurde der Inhalt der Märchen verändert. Deshalb wurden Märchen in den letzten Jahrhunderten verschriftlicht. Doch auch hier kann man Unterschiede feststellen, wenn man die Ausgabe erster Hand mit der Ausgabe letzter Hand vergleicht. Die Erzählungen über die Heldinnen und Helden sind aus der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken, denn Märchen gelten als zeitlose, aktuelle Klassiker der Literatur.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Märchen
- Definition und Ursprung
- Volksmärchen
- Genderperspektiven
- Frauenbilder und Geschlechterrollen
- Das Schwesterchen als Kind und junges Mädchen
- Das Schwesterchen als junge Frau und Mutter
- Stiefmutter
- weitere Figuren
- Stiefschwester
- Kinderfrau
- Beziehungen zwischen den Figuren
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Geschlechterrollen im Märchen der Gebrüder Grimm „Brüderchen und Schwesterchen“, indem sie die erste und letzte Ausgabe vergleicht. Die Hauptziele sind die Untersuchung der Darstellung von Frauenbildern, der Entwicklung der Hauptfigur und der Beziehungen zwischen den weiblichen Figuren im Märchen. Die Analyse zielt darauf ab, die Eigenschaften der weiblichen Figuren mit heutigen Frauenbildern in Verbindung zu bringen und die Bedeutung der Beziehungen zwischen den Frauen im Kontext des dargestellten Frauenbildes zu beleuchten.
- Entwicklung des Frauenbildes im Märchen
- Vergleich der Frauenbilder in der ersten und letzten Ausgabe
- Beziehungen zwischen den weiblichen Figuren
- Interpretation der Geschlechterrollen im Kontext des Märchens
- Relevanz des Märchens für heutige Frauenbilder
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Genderanalyse in Kinder- und Jugendliteratur ein und benennt das Grimm'sche Märchen „Brüderchen und Schwesterchen“ als Gegenstand der Untersuchung. Sie skizziert die Forschungsfrage, die sich mit der Darstellung von Frauenbildern, deren Beziehungen und der Entwicklung der Hauptfigur beschäftigt, und umreißt den methodischen Ansatz der Analyse. Die Leitfragen der Analyse werden formuliert, die den Rahmen für die Interpretation des Märchens setzen.
Märchen: Dieses Kapitel liefert eine Definition des Begriffs „Märchen“ und beleuchtet dessen Ursprung und Entwicklung. Es differenziert zwischen der Definition des Begriffs im Laufe der Zeit und im Kontext der Literaturwissenschaft. Die Diskussion um die Frage nach der Urheberschaft von Volksmärchen und der Rolle der mündlichen Überlieferung wird behandelt, sowie die Merkmale, die Märchen kennzeichnen, werden erläutert. Es wird die Bedeutung der Märchen für die Gesellschaft und ihre bleibende Popularität hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Genderanalyse, Kinder- und Jugendliteratur, Gebrüder Grimm, Brüderchen und Schwesterchen, Frauenbild, Geschlechterrolle, Märchenanalyse, Volksmärchen, Literaturvergleich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Brüderchen und Schwesterchen": Genderanalyse eines Märchens der Gebrüder Grimm
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Geschlechterrollen und Frauenbilder im Märchen „Brüderchen und Schwesterchen“ der Gebrüder Grimm. Dabei werden die erste und letzte Ausgabe des Märchens verglichen.
Welche Ziele verfolgt die Analyse?
Die Analyse untersucht die Darstellung von Frauenfiguren, die Entwicklung der Hauptfigur und die Beziehungen zwischen den weiblichen Figuren. Sie zielt darauf ab, die Eigenschaften der weiblichen Figuren mit heutigen Frauenbildern zu vergleichen und die Bedeutung der Beziehungen zwischen den Frauen im Kontext des dargestellten Frauenbildes zu beleuchten.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung des Frauenbildes im Märchen, einen Vergleich der Frauenbilder in verschiedenen Ausgaben, die Beziehungen zwischen den weiblichen Figuren, die Interpretation der Geschlechterrollen und die Relevanz des Märchens für heutige Frauenbilder.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zu Märchen allgemein (inkl. Definition und Ursprung), ein Kapitel zu Genderperspektiven mit Fokus auf Frauenbilder und Geschlechterrollen (einschließlich detaillierter Analyse verschiedener weiblicher Figuren wie Schwesterchen, Stiefmutter etc.), ein Kapitel zu den Beziehungen zwischen den Figuren, ein Fazit, und ein Literaturverzeichnis.
Wie wird das Märchen "Brüderchen und Schwesterchen" analysiert?
Die Analyse vergleicht die erste und letzte Ausgabe des Märchens, um die Entwicklung des Frauenbildes zu verfolgen und die Veränderungen in der Darstellung der Geschlechterrollen zu untersuchen. Methodisch wird eine Genderanalyse angewendet, um die verschiedenen Aspekte der Darstellung von Frauen und ihren Beziehungen zu beleuchten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Genderanalyse, Kinder- und Jugendliteratur, Gebrüder Grimm, Brüderchen und Schwesterchen, Frauenbild, Geschlechterrolle, Märchenanalyse, Volksmärchen, Literaturvergleich.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung führt in das Thema der Genderanalyse in Kinder- und Jugendliteratur ein und benennt das Grimm'sche Märchen „Brüderchen und Schwesterchen“ als Untersuchungsgegenstand. Sie formuliert die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz.
Was wird im Kapitel "Märchen" behandelt?
Dieses Kapitel bietet eine Definition des Begriffs „Märchen“, beleuchtet dessen Ursprung und Entwicklung, differenziert zwischen verschiedenen Definitionen im Laufe der Zeit und im Kontext der Literaturwissenschaft und diskutiert die Urheberschaft von Volksmärchen und die Rolle der mündlichen Überlieferung.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2019, Die Geschlechterrolle im Märchen "Brüderchen und Schwesterchen" der Gebrüder Grimm. Vergleich zwischen der Ausgabe erster und letzter Hand, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/997725