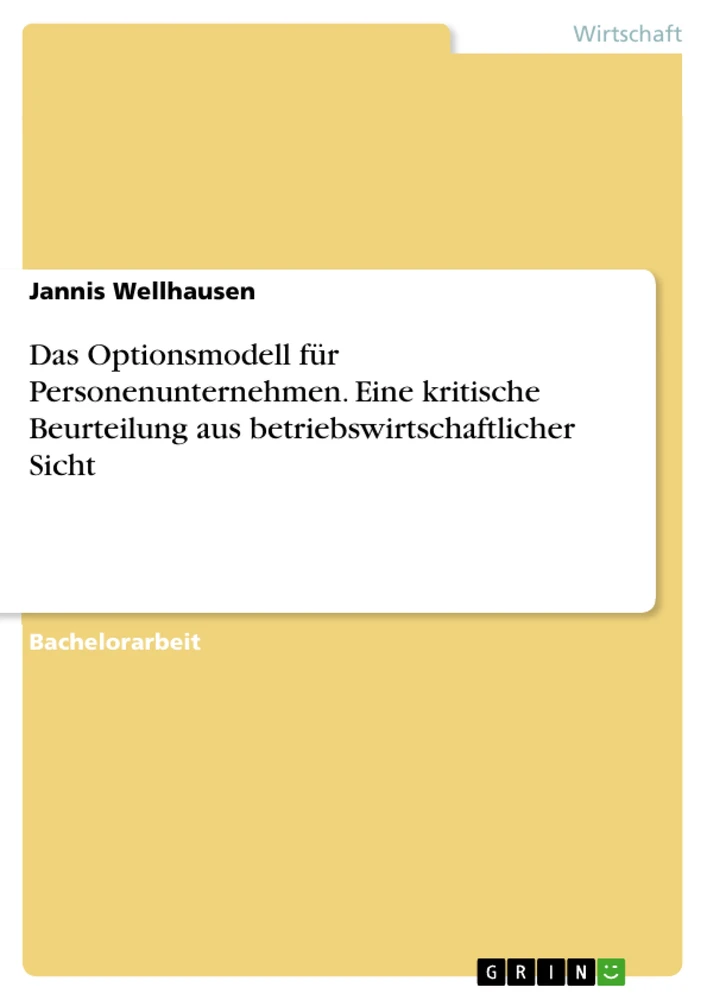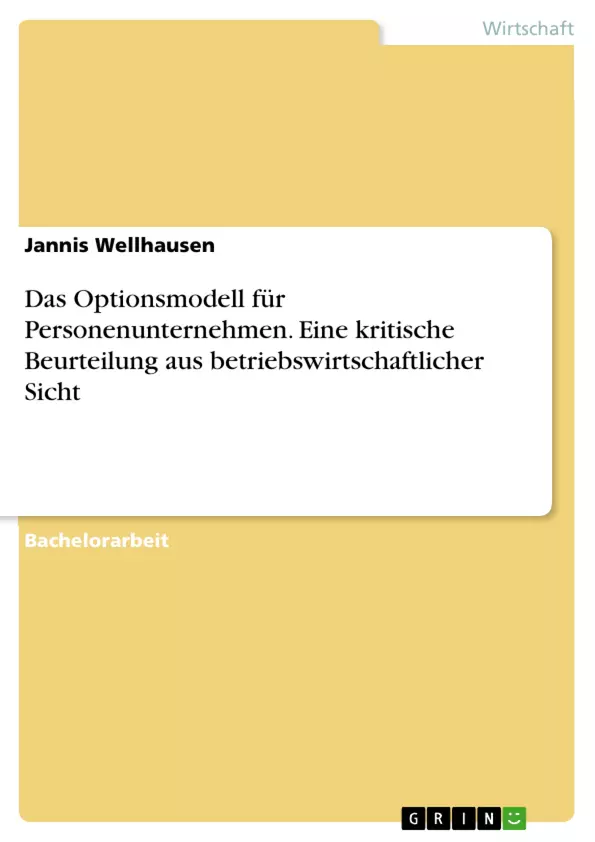Diese Arbeit setzt sich mit einer kritischen Analyse eines Optionsmodells aus betriebswirtschaftlicher Sicht auseinander. Zu Beginn werden, aufgrund des Dualismus der deutschen Unternehmensbesteuerung, die Unterschiede zwischen Kapitalgesellschaften und Personenunternehmen aufgezeigt und anschließend der Begriff der Rechtsformneutralität erläutert. Die Unterschiede in der Besteuerung dienen als Grundlage für die folgende Darstellung der aktuellen Belastungsunterschiede zwischen den Rechtsformen. Danach beschäftigt sich die Arbeit mit einer möglichen Ausgestaltung und Umsetzung eines Optionsmodells. Dafür dient als Orientierungspunkt das Positionspapier des IDW.
Im Anschluss folgt die kritische Analyse des Optionsmodells. Hierbei erfolgt zuerst eine Ausarbeitung steuerlicher Zweifelsfragen. Als nächstes folgt eine kritische Beurteilung, ob ein Optionsmodell Auswirkungen auf Rechtsformneutralität hat und Investitions- und Finanzierungsentscheidung beeinflusst. Das abschließende Fazit vermittelt die Kerngedanken und gewonnenen Erkenntnisse dieser Arbeit und präsentiert eine abschließende Beurteilung der Fragestellung.
Aus Vereinfachungsgründen gehen die Berechnungen der Belastungsunterschiede von ledigen, kinder- und konfessionslosen Steuerpflichtigen aus. Darüber hinaus besitzen sie keine weiteren Einkünfte oder Steuerabzüge. Außerdem werden Auswirkungen auf die Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer in dieser Arbeit nicht berücksichtigt.
Das durch die Unternehmensteuerreform von 2008 bestehende Unternehmensteuerrecht bildet die Grundlage dieser Arbeit. Aktuell werden die Stimmen nach einer neuen Unternehmensteuerreform lauter. Scherf spricht sogar davon, dass die Unternehmensteuerreform von 2008 "gründlich missglückt" ist. Tarifbelastungen zwischen den unterschiedlichen Rechtsformen wurden zwar verringert, jedoch weist das Unternehmensteuerrecht nach der Steuerreform viele systematische Mängel auf und stellt keine Gleichbehandlung her.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Aktuelle Unternehmensbesteuerung in Deutschland
- 2.1 Besteuerung von Kapitalgesellschaften
- 2.2 Besteuerung von Personenunternehmen
- 2.2.1 Personengesellschaften im Einkommensteuerrecht
- 2.2.2 Einzelunternehmen im Einkommensteuerrecht
- 2.2.3 Thesaurierungsbegünstigung nach § 34a EStG
- 2.3 Gewerbesteuerliche Behandlung
- 2.4 Verlustausgleich
- 3 Rechtsformneutralität
- 4 Belastungsvergleich der Unternehmensformen
- 5 Das Optionsmodell
- 6 Kritische Beurteilung des Optionsmodells
- 6.1 Steuerliche Zweifelsfragen
- 6.2 Betriebswirtschaftliche Auswirkungen
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Einführung eines Optionsmodells für Personenunternehmen in Deutschland und dessen Auswirkungen auf die Rechtsformneutralität der Unternehmensbesteuerung. Die Arbeit analysiert kritisch, ob ein solches Modell aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist und welche steuerlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen es mit sich bringt.
- Analyse der aktuellen Unternehmensbesteuerung in Deutschland und deren Unterschiede zwischen Kapital- und Personengesellschaften.
- Bewertung des Konzepts der Rechtsformneutralität und seiner Relevanz für die Unternehmensbesteuerung.
- Kritische Auseinandersetzung mit dem Optionsmodell für Personenunternehmen und seinen potenziellen Vorteilen und Nachteilen.
- Untersuchung der steuerlichen Zweifelsfragen im Zusammenhang mit dem Optionsmodell.
- Bewertung der betriebswirtschaftlichen Auswirkungen des Optionsmodells auf Investitions- und Finanzierungsentscheidungen.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Unternehmensbesteuerung in Deutschland ein und beleuchtet die Diskussion um eine Reform des bestehenden dualistischen Systems. Sie hebt die kontroverse Debatte um ein Optionsmodell für Personenunternehmen hervor, das eine gleichartige Besteuerung wie bei Kapitalgesellschaften ermöglichen würde. Die Arbeit untersucht die Frage, ob die Einführung eines solchen Modells zu einer rechtsformneutralen Besteuerung führt und ob dies betriebswirtschaftlich gerechtfertigt ist.
2 Aktuelle Unternehmensbesteuerung in Deutschland: Dieses Kapitel beschreibt die aktuelle Unternehmensbesteuerung in Deutschland, differenziert nach Kapital- und Personengesellschaften. Es analysiert die steuerlichen Regelungen für Kapitalgesellschaften (Körperschaftsteuer) und Personenunternehmen (Einkommensteuer), einschließlich der Behandlung von Personengesellschaften, Einzelunternehmen und der Thesaurierungsbegünstigung. Die gewerbesteuerliche Behandlung und der Verlustausgleich werden ebenfalls beleuchtet, um ein umfassendes Bild der bestehenden Unterschiede zu zeichnen.
3 Rechtsformneutralität: Dieses Kapitel definiert und diskutiert das Konzept der Rechtsformneutralität im Steuerrecht. Es untersucht, warum Rechtsformneutralität angestrebt wird und welche Herausforderungen bei der Umsetzung bestehen. Es werden verschiedene Ansätze und Interpretationen von Rechtsformneutralität beleuchtet, um den Kontext für die spätere Bewertung des Optionsmodells zu schaffen.
4 Belastungsvergleich der Unternehmensformen: Das Kapitel vergleicht die Steuerbelastung verschiedener Unternehmensformen unter verschiedenen Szenarien, beispielsweise bei Ausschüttung oder Thesaurierung von Gewinnen. Dieser Vergleich dient als Grundlage für die Beurteilung, inwieweit das bestehende System rechtsformneutral ist und wo Diskrepanzen bestehen, die durch ein Optionsmodell behoben werden könnten.
5 Das Optionsmodell: Dieses Kapitel erläutert detailliert das Konzept des Optionsmodells für Personenunternehmen. Es beschreibt die Funktionsweise des Modells, wie Personenunternehmen die Option zur Körperschaftsteuerpflicht wählen könnten und welche Konsequenzen dies hätte. Der historische Kontext der Debatte um das Optionsmodell wird ebenso beleuchtet.
6 Kritische Beurteilung des Optionsmodells: Dieses Kapitel stellt eine eingehende kritische Analyse des Optionsmodells dar. Es befasst sich mit den steuerlichen Zweifelsfragen, wie der Definition des Adressatenkreises, der Behandlung von Sonderbetriebsvermögen, Verlust- und Zinsvorträgen, sowie den Anforderungen an Gesellschafterbeschlüsse und die Bindungsfrist. Des Weiteren werden die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen des Modells, insbesondere auf Investitions- und Finanzierungsentscheidungen, untersucht. Die internationale Anerkennung des Modells wird ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Optionsmodell, Personenunternehmen, Kapitalgesellschaften, Unternehmensbesteuerung, Rechtsformneutralität, Steuerbelastung, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Investitionsentscheidungen, Finanzierungsentscheidungen, Steuerliche Zweifelsfragen, Betriebswirtschaftliche Auswirkungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Unternehmensbesteuerung in Deutschland und dem Optionsmodell
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Einführung eines Optionsmodells für Personenunternehmen in Deutschland und dessen Auswirkungen auf die Rechtsformneutralität der Unternehmensbesteuerung. Sie untersucht kritisch die betriebswirtschaftliche Sinnhaftigkeit des Modells und dessen steuerliche und wirtschaftliche Konsequenzen.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit umfasst eine detaillierte Betrachtung der aktuellen Unternehmensbesteuerung in Deutschland (Kapital- und Personengesellschaften), eine Definition und Diskussion des Konzepts der Rechtsformneutralität, einen Belastungsvergleich verschiedener Unternehmensformen, eine Erklärung des Optionsmodells, sowie eine kritische Beurteilung mit Fokus auf steuerliche Zweifelsfragen und betriebswirtschaftliche Auswirkungen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Aktuelle Unternehmensbesteuerung in Deutschland (einschließlich Kapital- und Personengesellschaften, Gewerbesteuer und Verlustausgleich), Rechtsformneutralität, Belastungsvergleich der Unternehmensformen, Das Optionsmodell, Kritische Beurteilung des Optionsmodells (mit Fokus auf steuerliche Zweifelsfragen und betriebswirtschaftliche Auswirkungen) und Fazit.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Auswirkungen eines Optionsmodells auf die Rechtsformneutralität der Unternehmensbesteuerung zu untersuchen. Sie analysiert, ob ein solches Modell aus betriebswirtschaftlicher Sicht sinnvoll ist und welche steuerlichen und wirtschaftlichen Konsequenzen es hat.
Was ist unter Rechtsformneutralität zu verstehen?
Die Arbeit definiert und diskutiert das Konzept der Rechtsformneutralität im Steuerrecht. Sie untersucht, warum Rechtsformneutralität angestrebt wird und welche Herausforderungen bei der Umsetzung bestehen. Verschiedene Ansätze und Interpretationen werden beleuchtet.
Wie wird das Optionsmodell im Detail erläutert?
Das Kapitel zum Optionsmodell beschreibt detailliert die Funktionsweise, die Möglichkeit der Wahl zur Körperschaftsteuerpflicht für Personenunternehmen und die daraus resultierenden Konsequenzen. Der historische Kontext der Debatte wird ebenfalls beleuchtet.
Welche kritischen Aspekte des Optionsmodells werden behandelt?
Die kritische Beurteilung des Optionsmodells umfasst die Analyse steuerlicher Zweifelsfragen (z.B. Adressatenkreis, Sonderbetriebsvermögen, Verlust- und Zinsvorträge) und die Untersuchung der betriebswirtschaftlichen Auswirkungen auf Investitions- und Finanzierungsentscheidungen. Die internationale Anerkennung des Modells wird ebenfalls thematisiert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Optionsmodell, Personenunternehmen, Kapitalgesellschaften, Unternehmensbesteuerung, Rechtsformneutralität, Steuerbelastung, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Investitionsentscheidungen, Finanzierungsentscheidungen, Steuerliche Zweifelsfragen, Betriebswirtschaftliche Auswirkungen.
Welche Kapitelzusammenfassungen bietet die Arbeit?
Die Arbeit enthält Kapitelzusammenfassungen für jedes der sieben Kapitel, die die zentralen Inhalte und Ergebnisse jedes Kapitels kurz und prägnant zusammenfassen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Studierende, Steuerberater und alle, die sich mit der Unternehmensbesteuerung in Deutschland und der Debatte um Rechtsformneutralität auseinandersetzen.
- Citation du texte
- Jannis Wellhausen (Auteur), 2020, Das Optionsmodell für Personenunternehmen. Eine kritische Beurteilung aus betriebswirtschaftlicher Sicht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/997771