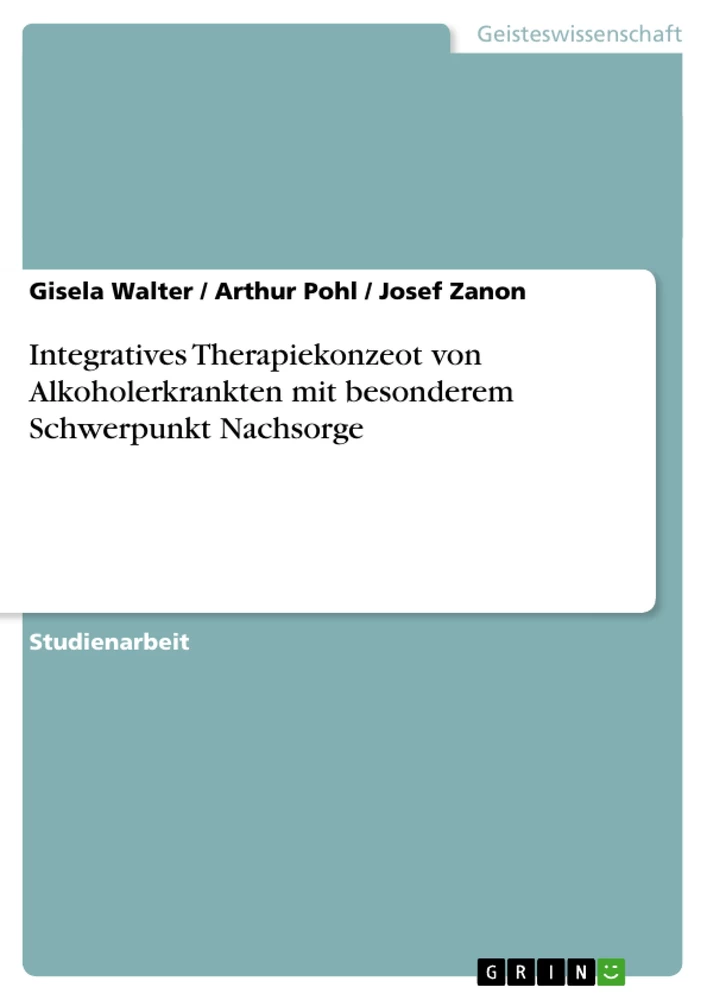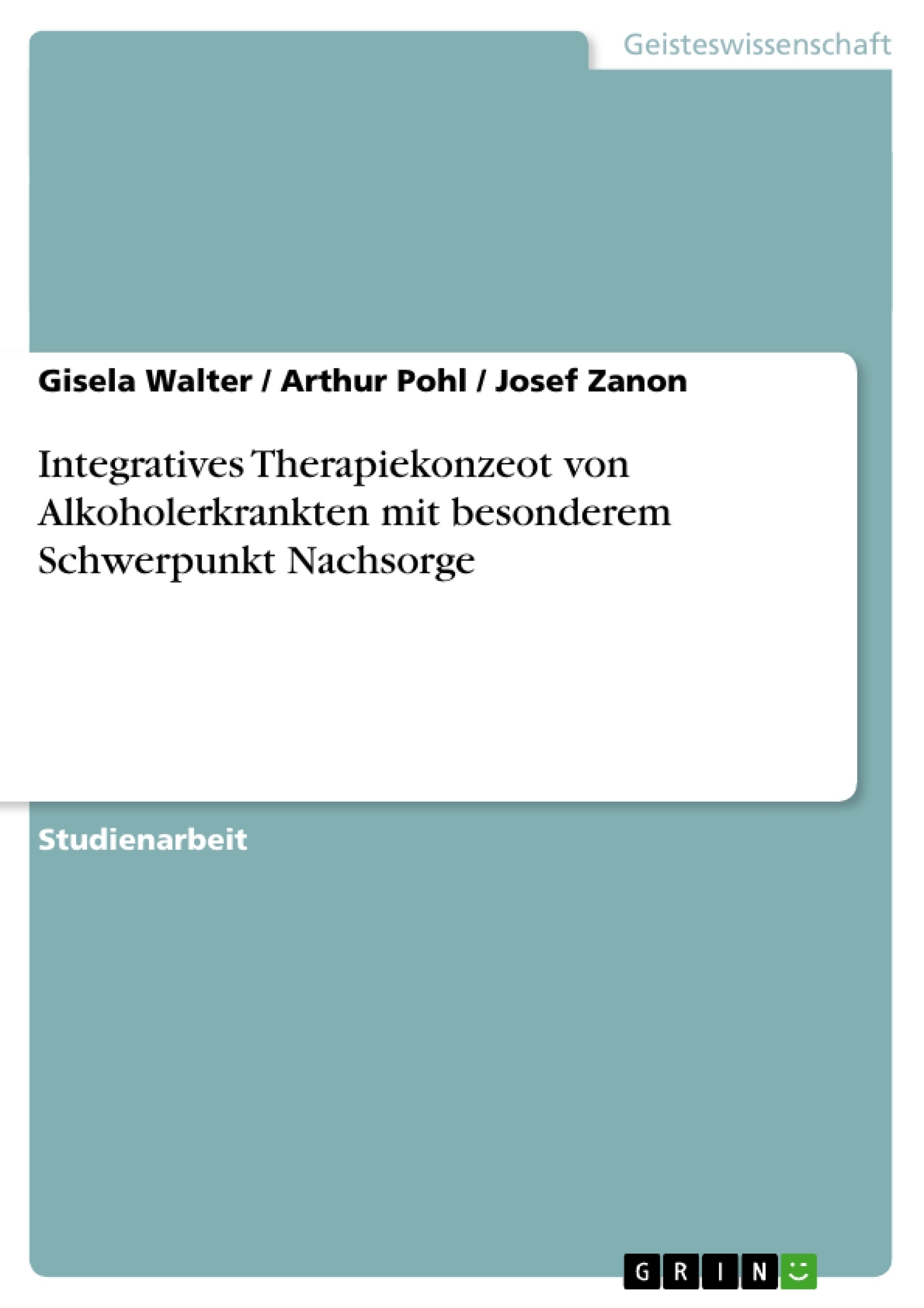Während früher die Trunksucht als moralisches Versagen ("Laster") angesehen wurde, hat sich heute die Auffassung durchgesetzt, daß es sich dabei um eine Erkrankung handelt: So ist der Alkoholismus in der Bundesrepublik Deutschland seit 1968 vom Bundessozialgericht als Krankheit anerkannt. [...] In Österreich beträgt heute der jährliche Alkohol-pro-Kopf-Verbrauch 6 Liter Schnaps, 150 Liter Bier, 20 Liter Wein; 4 - 5% aller Erwachsenen sind alkoholabhängig, 10% sind als gefährdet anzusehen; das Lebenszeitrisiko beträgt 15%; 42% der Männer, 13% der Frauen und 5% der Jugendlichen trinken täglich Alkohol [12]. Dazu ist zu sagen, daß eine vorliegende Alkoholproblematik häufig nicht erkannt wird oder es wird erst gar nicht auf sie eingegangen: So muß festgestellt werden, daß alkoholkranke Patienten bsp. An Internen Abteilungen häufig aufgenommen, jedoch oft nicht als alkoholkrank erkannt werden und nach der symptomatischen Behandlung der Alkoholfolgeerkrankungen ohne weiterführende krankheitsspezifische Behandlung nach Hause entlassen werden. Funktioniert allerdings die Kommunikation mit den das Abstinenzsyndrom behandelnden Institutionen und den Fachabteilungen, werden die Patienten häufiger einer Entwöhnungsbehandlung zugeführt. Diese Kommunikation ist meist dann gut, wenn die Interaktion z.b. durch ein räumliches Nebeneinander von psychiatrischen und somatischen Bereichen besteht (Universitätskliniken) und eher schlecht, wenn eine große räumliche und fachliche Distanz besteht.
INHALTSVERZEICHNIS
1. EINLEITUNG
1.1. Historisches
1.2. Grundsätzliche epidemiologische Daten
2. ENTWICKLUNG DER ALKOHOLKRANKHEIT
2.1. Einflussgrößen
2.2. Suchtpersönlichkeit
2.3. Risikofaktoren
2.4. Comorbidität
2.5. Entwicklung der manifesten Abhängigkeit
2.6. Deutung süchtigen Verhaltens
3. THERAPIEKONZEPT BEI ABHÄNGIGKEITSERKRANKTEN
3.1. Allgemeines
3.2. Spezielle Therapietechniken
3.3. Grundzüge der ambulanten Therapie
3.3.1. Vorzüge einer ambulanten Therapie
3.3.2. Was spricht gegen eine ambulante Therapie
3.4. Grundzüge der stationären Therapie
3.4.1. Kontaktphase
3.4.2. Entgiftungsphase
3.4.3. Entwöhnungsphase
3.4.4. Nachsorge-Rehabilitationsphase
4. NACHSORGE
4.1. Arten der Nachsorge
4.1.1. Nachsorgegruppen
4.1.1.1. Nicht professionelle Nachsorgegruppen
4.1.1.1.1. Anonyme Alkoholiker
4.1.1.2. Professionelle Nachsorgegruppen
4.1.2. Ambulant aufsuchender Dienst
4.1.2.1. Aufsuchende Einzelbetreuung nach dem Modell des PSP
4.1.2.2. Betreute Wohngemeinschaften nach dem Modell des PSP
4.1.3. Niederschwellige Nachsorge
4.1.3.1. Harm-Reduction
4.2. Kosten-Nutzen-Ananlyse
5. AUFTRETENDE PROBLEMATIK WÄHREND UND NACH DER STATIONÄREN THERAPIE
5.1. Abwehrmechanismen
5.2. Der Rückfall
5.2.1.Unterscheidung der Rückfälle
5.2.2. Begünstigende Faktoren beim Rückfall
5.2.3. Einflußfaktoren beim Rückfall von seiten des Betreuers
5.3. Übertragung
5.4. Coabhängigkeit
5.4.1. Kennzeichen der Coabhängigkeit
5.4.2. Einteilung der Coabhängigkeit nach Jackson
5.5. Suizidalität
5.6. Burn out
LITERATURVERZEICHNIS
SACHREGISTER
1.EINLEITUNG
1.1. Historisches
Während früher die Trunksucht als moralisches Versagen ("Laster") angesehen wurde, hat sich heute die Auffassung durchgesetzt, daß es sich dabei um eine Erkrankung handelt: So ist der Alkoholismus in der Bundesrepublik Deutschland seit 1968 vom Bundessozialgericht als Krankheit anerkannt.[8]
Obwohl schon um 18oo[40] von ärztlicher Seite als Erkrankung erkannt, findet man auch in den Schriften der Psychiater späterer Zeit noch eine moralisierend-abwertende Haltung gegenüber Suchterkrankten: Sie findet sich auch im Lehrbuch von Krafft- Ebing 1903 [15]. Die Haltung einiger Psychiater zu dieser Zeit läßt sich durch ein Zitat aus der Anstaltschronik eines Psychiatrischen Krankenhauses von 1885 illustrieren. Der damalige Direktor erklärte: "Wir haben eine gewisse Anzahl von ihnen aufgenommen, aber wir sollten es nicht tun, sie können nicht geheilt werden. Sie sind die unangenehmsten Patienten. Der Psychiater braucht viel Zeit und Beherrschung, um Gleichmut zu bewahren, gegenüber solcher Mischung von Eitelkeit, Charakterschwäche, Lügen und Widerstand."
Forel weist 1907 in seiner Abhandlung "Verbrechen und konstitutionelle Seelenabnormitäten" besonders auf die Geisteszerrüttung hin, "die den zerebralen Intoxikationen sowie dem Morphinismus, dem Kokainismus und besonders dem Alkoholismus verdankt wird, der so verbreitet ist, daß er direkt oder indirekt unsere Irren,- Idioten- und Epileptikeranstalten bevölkert". Dabei wird auch eindeutig erwähnt, daß es sich hierbei um eine Krankheit handelt. Forel überlegte dabei unter anderem, was z.B. mit einem Alkoholiker zu tun sei, der ein Verbrechen an seiner Frau beginge, ob er in die Strafanstalt solle oder in eine Heil- und Pflegeanstalt[16]. Kraepelin [24] weist in seinem Lehrbuch auf die hohen Aufnahmeraten von Suchtkranken in Irrenanstalten hin, die bis zu 40% betrugen. Er beklagte 1907, daß es solche Heilstätten in Deutschland viel zu wenig gebe. Deutlich wird auch damals schon die Einteilung getroffen in therapierbare, d.h. als gutwillig, folgsam, charakterlich positiv Beschriebene und in Unheilbare, die mehr der Dissozialität, der Psychopathie etc. zugeordnet wurden.
Im Juli 1933 erließ die Nationalsozialistische Regierung Deutschlands das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses: Dieses Gesetz erlaubte die chirurgische Sterilisierung "auch gegen den Willen des Unfruchtbarzumachenden" und hielt auch "die Anwendung unmittelbaren Zwanges (für) zulässig". Neben verschiedenen anderen psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen wurden auch Personen mit "schwerem Alkoholismus" in diesem Gesetzt erwähnt. Etwa 400.000 Menschen wurden bis 1945 zwangssterilisiert, über 1000, hauptsächlich Frauen, starben an der Operation[2].
Ende Oktober 1939 unterschrieb Adolf Hitler einen wohl nicht zufällig auf den 1. September 1939 - den Tag des Angriffs auf Polen-zurückdatierten Geheimerlaß, durch welchen die sogenannten "Euthanasieprogramme" legitimiert wurden. Im Zuge der "Aktion T4" (benannt nach der Adresse der zuständigen Dienststelle in Berlin, Tiergartenstraße 4) wurden bis zum August 1941 über 70.000 psychisch Kranke in sechs eigens dafür eingerichteten Tötungsanstalten hauptsächlich durch Giftgas systematisch ermordet.
Da der T4-Dienststelle von den Heil- und Pflegeanstalten neben Patienten mit anderen Erkrankungen auch alle jene mit "neurologischen Endzuständen" gemeldet werden mußten, ist anzunehmen, daß auch viele chronisch Alkoholkranke der Aktion T4 zum Opfer vielen. Am 24. August 1941 soll Hitler die mündliche Anweisung gegeben haben, die Tötung psychisch Kranker einzustellen[13]. Tatsächlich erklärte der mit der Aktion T4 befaßte V. Brack in einer Eidesstattlichen Erklärung im Nürnberger Prozeß, er habe im August 1941 entweder vom Chef der Kanzlei des Führers, Ph. Bouhler, oder von Hitlers Leibarzt, K. Brandt, den beiden Euthanasiebeauftragten, den mündlichen Befehl erhalten, die Vergasungen einzustellen. Es ist dabei aufschlußreich, daß viele T4 Mitarbeiter von dem angeblichen "Stopp" der Aktion T4 gar nichts bemerkt haben [20], da dieser "Stopp" in Wirklichkeit nicht das Ende der Tötungen bedeutete, sondern eine bessere Tarnung bei zum Teil geänderten Tötungsmethoden (z.b. Einführung von Hungerstationen, unauffällige Medikamentenüberdosierung - beispielsweise Luminal).
Eine Schätzung in einem Verhandlungsprotokoll des Internationalen Militärgerichtshofes in Nürnberg ergab, daß mindestens 275.000 Menschen auf diesem Weg ermordet wurden.
1.2. Grundsätzliche epidemiologische Daten
In Österreich beträgt heute der jährliche Alkohol-pro-Kopf-Verbrauch 6 Liter Schnaps, 150 Liter Bier, 20 Liter Wein; 4 - 5% aller Erwachsenen sind alkoholabhängig, 10% sind als gefährdet anzusehen; das Lebenszeitrisiko beträgt 15%; 42% der Männer, 13% der Frauen und 5% der Jugendlichen trinken täglich Alkohol[12].
Dazu ist zu sagen, daß eine vorliegende Alkoholproblematik häufig nicht erkannt wird oder es wird erst gar nicht auf sie eingegangen:
So muß festgestellt werden, daß alkoholkranke Patienten bsp. An Internen Abteilungen häufig aufgenommen, jedoch oft nicht als alkoholkrank erkannt werden und nach der symptomatischen Behandlung der Alkoholfolgeerkrankungen ohne weiterführende krankheitsspezifische Behandlung nach Hause entlassen werden. Funktioniert allerdings die Kommunikation mit den das Abstinenzsyndrom behandelnden Institutionen und den Fachabteilungen, werden die Patienten häufiger einer Entwöhnungsbehandlung zugeführt. Diese Kommunikation ist meist dann gut, wenn die Interaktion z.b. durch ein räumliches Nebeneinander von psychiatrischen und somatischen Bereichen besteht (Universitätskliniken) und eher schlecht, wenn eine große räumliche und fachliche Distanz besteht.[13]
2. ENTWICKLUNG DER ALKOHOLKRANKHEIT
2.1. EINFLUSSGRÖSSEN
Ausgangspunkt ist die Frage, warum sich Alkoholismus in bestimmten Kulturen, Personengruppen oder Epochen häuft? Dabei sollte berücksichtigt werden, daß alkoholische Getränke in den meisten Ländern der Erde erhältlich sind, daß jedoch hinsichtlich der "Griffnähe" erhebliche Unterschiede bestehen.
Zunächst sind großgesellschaftliche Faktoren zu erwähnen, also Änderungen im sozialen Umfeld, d.h. im negativen, wie im positiven Sinn, z.b. Anonymität, Arbeitslosigkeit, Flüchtlingsschicksal, Nichtsesshaftigkeit, unbewältigte Freizeit. Eine nicht zu übersehende Rolle spielen Grundeinstellungen gegenüber der Einnahme von Substanzen mit hohem Abhängigkeitspotential (also Werte, Normen und Traditionen). Diese können regional und epochal unterschiedlich sein. Es lassen sich verschiedene Einstellungen zum Alkoholismus erkennen[8]:
- Rituelles Trinken
- Konviviales Trinken (Trinken in Gesellschaft mit mehr oder minder ausgeprägten soziale Ritualen)
- Utilitarisches Trinken (der Alkohol hat sozusagen eine pharmakologische Wirkung)
Nicht zu vernachlässigen sind traditionelle Trinksitten, die stark von soziokulturellen Einflüssen abhängig sind, wie z.b. der Religion.
Eine weitere Rolle bei der Entstehung des Alkoholismus scheint die Geschwisterreihe zu spielen. Unter Alkoholikern überwiegen die Letztgeborenen, wobei die Größe der Familie keinen Einflußfaktor darstellt[8].
(Diese Beobachtung konnten wir auch an der Drogenentzugsstation beobachten, wobei sich die Statistik auf 360 Patienten bezieht).
Von großer Bedeutung scheint die Beziehung der Kinder zu den Eltern zu sein, die Berufstätigkeit der Mutter scheint jedoch hier ohne Belang. Alkoholkranke berichten häufig über autoritäre, aber auch labile Väter. Außerdem scheint ein rigides Interaktionsmuster zu bestehen. Bei vielen Patienten tauchen in der Anamnese trinkfreudige bzw. alkoholabhängige Väter - und auch Mütter - auf.
Über die Bedeutung des Ehepartners (besonders der Ehefrau) wurden mehrere Untersuchungen gemacht. So gibt es mehrere Testverfahren über die Entstehung und Aufrechterhaltung des Alkoholismus in Beziehungen (siehe 5.4.Coabhängigkeit). Beschrieben werden dabei (- meist die Ehefrauen-) als "depressiv, ängstlich, unsicher, gespannt" bzw. als "psychopathisch, hypomanisch, hysterisch".
Alkoholismus findet sich in jeder gesellschaftlichen Sozialschicht, bei jedem Beruf. Herausragend sind Frauen mit steigendem sozialem Status, eine große Gruppe der Selbständigen und Unternehmer, sowie der Arbeitslosen, hier besonders Jugendliche bzw. nur halbtägig Berufstätige und solchen mit Schichtarbeit. Bestimmte Berufsgruppen scheinen überdies besonders gefährdet, nämlich:
- Berufe mit relativ niedrigem Qualifikationsniveau und/oder Technisierungsgrad
- Berufe mit traditionellem Alkoholkonsum schon während der Arbeitszeit (z.B. Betriebe, welche Alkohol herstellen)
- Berufe, die mit einem hohen Maß an Selbstkontrolle und Verhaltensautonomie verbunden sind, wie z.b. Manager
- sogenannte Durstberufe, wie z.b. Maurer, Fliesenleger, Kaminkehrer.
2.2. SUCHTPERSÖNLICHKEIT
Es gibt keine klassische Suchtpersönlichkeit[38], sondern nur Risikofaktoren, deren Häufung zu emotionalen und sozialen Fehlentwicklungen führen können, was wiederum zu einer Abhängigkeitserkrankung erheblich beitragen kann. Eine entscheidende Rolle in der Entwicklung spielen dabei die Pubertät und die Adoleszenz. In diesen Phasen sollten einerseits die Geschlechts- und eigene Identität aufgebaut und diese stabilisiert werden, andererseits sollte die Verantwortung für sein Tun und Handeln erfolgen. Einen wesentlichen Einfluß in dieser Zeit hat die sog. "Peergroup", die wichtige Funktionen für künftige Orientierung und Stützung innehat. In diesem Zusammenhang ist auch die zunehmende Bereitschaft von Jugendlichen zu verstehen, Drogen mit unterschiedlicher Wirkung und Gefährdung für Körper und Psyche auszuprobieren bzw. zu konsumieren. Wobei nicht nur die Neugier, sondern auch der Wunsch nach mystischen Erlebnissen (high lights), Bewunderung und die leichte Fluchtmöglichkeit vor Anforderungen und Problemen vor allem des Alltags als Auslöser für den Drogeneinstieg gelten.
Auch Arbeit, Ausbildung, soziale Integration und die Erreichbarkeit des Suchtmittels sind Faktoren, die nicht außer acht gelassen werden sollten. Welche Faktoren bei gleicher Risikokonstellation schützend wirken und welche dafür verantwortlich sind, daß eine Abhängigkeitserkrankung einsetzt, konnte bislang noch nicht geklärt werden.
2.3. RISIKOFAKTOREN
Risikofaktoren sind jene Umstände, die geeignet sind, eine bestimmte Störung mit großer Wahrscheinlichkeit hervorzurufen. Dazu zählen z.b. ein niedriger sozioökonomischer Status (die Gefahr ist innerhalb einer Familie mit niedrigen Status viel höher, wenn der Vater beispielsweise einen Hilfsarbeiterjob hat und die Mutter aus finanziellen Gründen gezwungen ist, ebenfalls einer Arbeit nachzugehen), schlechte Schulbildung der Eltern, weil die Kinder nicht gefördert werden, große Familien mit wenig Wohnraum, frühe Kontakte mit "sozialen Kontrollen", wie Jugendamt etc., chronische Erkrankung eines Elternteils, autoritäres väterliches Verhalten, alleinerziehende Mutter, Verlust der Mutter, häufig wechselnde frühe "Beziehungen", sexueller und/oder aggressiver Mißbrauch etc.
Je nachdem, ob sich Risiko- und protektive Faktoren (Großfamilie, insgesamt attraktives Mutterbild, robustes, aktives und kontaktfreudiges Temperament, mindestens durchschnittliche Intelligenz, geringe Risikogesamtbelastung) die Waage halten, kommt es zu Störungen oder eben nicht. Möglicherweise wird dann Alkohol zur Entspannung, Regulierung oder Harmonisierung eingesetzt.
2.4. Comorbidität
Unter Comorbidität versteht man ein gleichzeitiges Auftreten von (verschiedenen) Krankheiten und pathologischen Zuständen bei derselben Person ohne genaue Spezifizierung des WANN, WARUM und WIE.
Es konnte nachgewiesen werden, daß retrospektive Studien höhere Comorbiditätsraten aufwiesen als prospektive[11]. Die Zuverlässigkeit einer Diagnose sollte auf alle Fälle auf Untersuchungen über einen längeren Zeitraum basieren, vor der endgültigen Diagnose einer unabhängigen psychiatrischen Comorbidität, welche nicht sekundär auf pharmakologische Effekte oder andere Folgen des Suchtmittelmissbrauchs zurückzuführen ist. Psychiatrische Erkrankungen hängen auch mit dem Zeitpunkt der Diagnosestellung zusammen.
Es remittieren depressive oder psychotische Symptome oft innerhalb einiger Wochen, während Angstsymptome oder Persönlichkeitsveränderungen Monate bis Jahre bestehen bleiben können.
Als Beispiel für die Tatsache, daß depressive Symptome bei Alkoholikern nicht gleich unter der Kategorie Comorbidität einzuordnen sind, wird angeführt, daß sich zwar bei 98% aller Alkoholiker zu irgend einem Zeitpunkt Depressionen diagnostizieren lassen, diese jedoch mit Dauer der Entwöhnungsbehandlung und Abstinenzzeit Großteils verschwinden.
Psychiatrische Symptome sind oft die unmittelbare Folge des Suchtmittelmissbrauchs und nicht im Sinne einer tatsächlichen Comorbidität zu interpretieren. Prävalenzraten für psychiatrische Comorbidität zeigen sich beim Suchtklientel vergleichsweise niedrig und nicht wesentlich höher in der Allgemeinbevölkerung- hingegen zeigen sich Prävalenzraten beim psychiatrischen Klientel für Suchterkrankungen entschieden höher.
Für vorliegende "Doppeldiagnosen" gestaltet sich die Therapie insofern schwierig, als weitgehend oft adäquate Versorgungssysteme fehlen, eine geringe Compliance der Süchtigen besteht, welche die medikamentöse Therapie einer anderen psychischen Krankheit erschwert, dazu kommt oft eine unzureichende Diagnostik und Behandlungsplanung. Damit soll dringend darauf hingewiesen werden, daß dieses Klientel mit Doppeldiagnosen nicht durch den Rost der psychiatrischen und soziorehabilitativen Infrastruktur fällt.
2.5. ENTWICKLUNG DER MANIFESTEN ABHÄNGIGKEIT
Zu Beginn hat der Süchtige den Eindruck, mit dem Suchtmittel den richtigen Weg gefunden - die offensichtlich fehlende Karte, den Joker, zu haben. Mit dem Fortschreiten der Abhängigkeitsentwicklung finden sich auch charakteristische Verbiegungen der Interessen und der Antriebe auf den süchtigen Konsum der betreffenden Substanz. Bei Alkoholkranken kommt es zu einer zunehmenden Reduktion von Aktivität und Spontaneität, außerdem zur Unzuverlässigkeit, Mangel an Verantwortungsbewußtsein, zu Kritikschwäche, zu Konzentrationsstörungen und einer nachlassenden Geschicklichkeit, zum "Verfall der historischen Persönlichkeit".
Hier hat sich der Begriff der "Depravation" eingebürgert, wobei diese Depravation oft nicht trennbar ist von hirnorganischen Abbauprozessen, welche durch die chronische Giftwirkung hervorgerufen werden.
Schrappe [39] beschreibt damit eine Persönlichkeitsveränderung, die durch Egozentrismus, Verwahrlosung, Haltlosigkeit, Unzuverlässigkeit, sozialen Bindungsverlust und Abstieg sowie gegebenenfalls Kriminalität charakterisiert wird. Trotzdem bedeutet Depravation nicht immer hirnorganische Veränderung oder Abbau. Depravation ist vor allem als eine "suchtspezifische Besinnungsstörung" anzusehen. Damit wird ein Phänomen bezeichnet, das dem Verstand die Möglichkeit der distanzierenden Entscheidung über Situationen, Bedürfnisse und Verhaltensweisen nimmt und zum Organisator süchtiger Bedürfnisse verkommt.
Es bedarf mehrerer Ursachen, d.h. vielfältiger pathologischer Faktoren und deren Wechselbeziehung, die in der Abhängigkeitsentwicklung eine Rolle spielen.
Wie bereits erwähnt, sind die ersten Lebensjahre von elementarer Bedeutung für ein späteres psychisches Wohl/Unwohlbefinden. Spezifische Suchtursachen sind bisher nicht eruiert worden. Jedoch gibt es einige sehr wohl prädisponierende Faktoren. Prinzipiell kann sich eine süchtige Fehlhaltung in jedem von uns breitmachen.
Der Übergang vom Mißbrauch zur Sucht ist ein in Phasen verlaufendes Geschehen, wobei die Übergänge nicht immer scharf abzugrenzen sind.
Jedenfalls ist festzustellen, daß Mißbrauch dann vorliegt, wenn Substanzen mißbräuchlich verwendet werden, jedoch nach dem Absetzen bzw. bei Nicht- Einnahme der Droge es zu keinen Absetzphänomenen und schweren Beeinträchtigungen des seelischen und körperlichen Wohlbefindens kommt.
Beim Vorliegen einer Abhängigkeit im seelischen bzw. somatischen Sinne entstehen im Rahmen des Absetzens sehr wohl körperliche oder seelische sog. "Absetzphänome".
2.6 DEUTUNG SÜCHTIGEN VERHALTENS
Wie bereits erwähnt, spielten Suchtmittel eine Rolle bei der Überbrückung einer Minusposition.
Zur Verdeutlichung:
* Wenn eine Person Suchtmittel konsumiert, um sich eine unangenehme Lebenssituation oder ein Versagen nicht einzugestehen, um sich eine Scheinrealität aufzubauen, um aufsteigende Gefühle von Schuld, Scham oder Demütigung abzuwenden:
"Wenn ich trinke, kann ich die Wirklichkeit versinken lassen"
=> Sucht, um eine als unzulänglich erlebte Realität abzuwehren.
* Wenn sich jemand nur in alkoholisiertem Zustand stark und beliebt fühlt, während er sich im Alltag als uninteressant und unscheinbar erlebt:
"Nur wenn ich trinke, bin ich wer"
=> Sucht, um sich narzißtisch aufzuwerten.
* Wenn manche Jugendliche Drogen nehmen, um etwas Wichtiges und Besonderes zu erleben, um der Durchschnittlichkeit zu entgehen:
"Nur mit Drogen habe ich Erlebnisse, von denen andere nur träumen"
=> Sucht, um eine Scheinrealität des Besonderen und Außergewöhnlichen zu schaffen, wie Lust Rausch, Abenteuer).
* Wenn sozial wenig integriert und von der Gesellschaft enttäuschte Jugendliche sich nur in bestimmten Subkulturen angenommen und bestätigt fühlen, => Sucht, um zu einer Gruppe zu gehören, in der es möglich ist, sich stark und angenommen zu fühlen.
* Wenn Männer und Frauen vor allem dann laut und heftig, manchmal sogar gewalttätig werden, wenn sie vorher etwas getrunken haben, => Sucht, um einen Schein von Stärke, Mut und Macht wahren zu können.
* Wenn Alkoholiker durch das Pendeln zwischen Nüchternheit und Rückfälligkeit beweisen wollen, daß sie abstinent sein können
=> Sucht, um die Fiktion aufrecht zu erhalten, Kontrolle zu haben.
* Wenn Menschen sich durch illegale Drogen hinaus aus der "bürgerlichen
Normalität" und aus dem "Zwang der Gesetze und gesellschaftlichen Regeln" bewegen,
=> Sucht, um sich vorzumachen, frei zu sein und über den Dingen zu stehen.
3. Therapiekonzept bei Abhängigkeitserkrankten
3.1. Allgemeines
Auf der Basis von mehr als 60 kontrollierten und einer Vielzahl unkontrollierter Studien ergaben sich folgende Aussagen[27]:
* Die spezifische Behandlung von Alkoholabhängigen verbessert den Krankheitsverlauf signifikant.
* Es gibt keinen allein seligmachenden Weg in der Therapie, d.h. keine spezielle Behandlung, die ihre Überlegenheit allen anderen gegenüber beweisen könnte.
* Therapeutenvariablen scheinen wesentlicher zu sein als manche postulierte objektive Kriterien. So erklärt sich die spezifische Wirkung der Empathie und des supportiven Verhaltens von Therapeuten.
* Bei nicht vorselektionierten Patienten scheint es keinen signifikanten Unterschied im globalen Therapieerfolg zwischen stationär und ambulant zu geben.
* Es gilt als nicht gesichert, ob längere Therapien den kürzeren überlegen sind, andererseits gilt als gegeben, daß irgendeine Therapie erfolgreicher ist als gar keine.
3.2. SPEZIELLE THERAPIETECHNIKEN Die Verhaltenstherapie
Die Verhaltenstherapie entwickelte sich in den letzten Jahren in mehrere Richtungen: Die wegen ihrer nur kurzfristigen Erfolge[3] heute weitgehend obsolete Aversionsmethode leitet sich direkt vom Pavlow`schen Konditionierungsverfahren ab mit dem Ziel, eine konditionierte Vermeidungsreaktion auf Alkohol aufzubauen. Die Probleme dabei waren, daß aversives Verhalten in Krisensituationen noch keine Problemlösungsstrategie ist, der Patient durch Vermeidungsverhalten eher in seiner Passivität gefördert wird und somit jegliche Eigenverantwortung und Eigeninitiative verloren geht.
Eine Form des Aversionsverfahrens war auch die Therapie mit Disulfiram - "Antabus", die man heute weitgehend verlassen hat. Alkoholkonsum nach der Einnahme von Disulfiram führt zur Disulfiram- Äthanol- Reaktion, die dramatische Symptome, wie Hitzegefühl, Blutdruckabfall, Herzrasen, Kollaps u.ä., zeigt. Zu beachten ist, daß das Disulfiram eine toxische Wirkung auf das periphere Nervensystem aufweisen kann[34].
Der biochemische Wirkmechanismus besteht in einer reversiblen Hemmung der Aldehyddehydrogenase, ein Enzym, welches den ersten Metaboliten des Alkohols (Azetaldehyd) weiter zur Essigsäure oxidiert, wodurch es zu einer Anreicherung des Azetaldehyds im Organismus kommt. Außerdem sind neben den Nebenwirkungen auch die Gegenanzeigen dieser Wirksubstanz zu beachten. Fraglich ist, ob die Erfolge des Disulfirams auf seine pharmakologischen Eigenschaften oder auf seine psychologische Wirkung, d.h. die Angst vor der Disulfiram-Äthanol-Reaktion, zurückzuführen sind.
Systemische Therapie: Charakteristisch für systemische Therapieansätze ist eine betonte Lösungsorientierung, d.h. eine Fokussierung auf Ressourcen und erfolgreiche Lösungsansätze des Klienten und damit eine deutlich geringere Problemorientierung als in anderen Therapien üblich. Der Alkoholabhängige wird als Symptomträger im System der Familie oder in einem anderen sozialen System betrachtet. Das Suchtverhalten des Symptomträgers ist ein beziehungsregulierender Faktor, auf den sich das Umfeld eingestellt hat. Der Alkoholkonsum kann z.b. die Nähe bzw. Distanz zum Partner regulieren. Wenn daher auf der Ebene der interaktionellen Beziehungen etwas therapeutisch geändert wird, führt das auch zu Veränderungen des Symptomverhaltens.
Entscheidend ist, welche Bedeutung einzelnen Verhaltensweisen und Ereignissen in der Familie zugeordnet wird. Dadurch wird jeweils das Antwortverhalten gesteuert. Durch die Technik des "zirkulären" Fragens werden diese Bedeutungszuweisungen aufgedeckt. Übergeordnetes Prinzip ist die Selbsterhaltung des Systems der Familie [9].
Psychodrama: Mit dem Psychodrama nach Moreno wurden bei Alkoholikern und anderen Suchtkranken umfangreiche Erfahrungen gewonnen. Störungen und Symptome werden hauptsächlich als Ausdruck von Rollendefiziten in sozialen Beziehungen verstanden. Für die Entstehung der Sucht ist die Beziehungskonstellation von entscheidender Bedeutung. Im Psychodrama wird innerpsychisches erlebbar gemacht und neu gestaltet. Psychisches Erleben wird durch szenische Darstellung aktiviert, was die Auseinandersetzung mit der traumatisierten Vergangenheit und mit den für den Süchtigen problematischen Bezugspersonen auf realitätsnahe und erlebnisstarke Art und Weise birgt.
Breitbandverhaltenstherapie: Hier wird die multifaktorielle Genese des Alkoholismus stärker berücksichtigt. Entsprechend den Defiziten des Klienten werden flankierend Entspannungsübungen, Selbstbehauptungstraining, Aversionsmethoden und eine klassische systematische Desensibilisierung gekoppelt[3]. Wesentlich ist, daß man auf die individuellen Bedürfnisse des Patienten eingeht. Der Vorteil dieser Therapie wird in einer geringeren Abbruchsrate angegeben. Außerdem soll sie erfolgreicher sein, als eine Monotherapie
Kognitive Methode: Sie geht davon aus, daß individuelle Interpretation und die verzerrte Wahrnehmung einer Situation unangemessene emotionale Reaktionen und eine unangemessene Verhaltensweise hervorrufen.
Einige Autoren zufolge, wird Alkohol inadäquat zum Lösen von Problemen eingesetzt was in der Folge zu einem weiteren Ansteigen des Gefühls der Hilflosigkeit, zu einer Verminderung des Selbstwertgefühls führt. Mit Hilfe der kognitiven Methode sollte eine Änderung der Einstellung des Patienten zu seinen Problemen erzielt werden. Studien dazu müssen mit einer gewissen Kritik betrachtet werden, da ihr Ziel nie das abstinenzorientierte war, sondern lediglich die Reduzierung der Alkoholmenge. Ob diese Methode auch bei schweren Alkoholikern ohne gleichzeitige Abstinenz erfolgreich ist, muß noch offen gelassen werden.
Alternative Verhaltensweisen: Darunter versteht man im wesentlichen Methoden wie Selbstsicherheitstraining und die damit im Zusammenhang stehenden Verfahren. Ursprünglich war das Ziel des Selbstsicherheitstrainings die Verminderung sozialer Ängste und Hemmungen. Heute ist es vielmehr ein Abbau bestimmter sozialer Verhaltensweisen - die Unsicherheit alleine beruht nicht auf Angst und Hemmung, sondern ebenso auf einem Defizit von Lösungsstrategien bei sozialen Konflikten, welche offensichtlich während des Sozialisationsprozesses nicht erworben wurden.
Soziales Kompetenztraining: Einige Alkoholkranke zeigen einen Mangel an Kompetenz, wie z.b. hinsichtlich Selbstbehauptung und Selbstsicherheit, was sich besonders beim Umgang mit Versuchungssituationen feststellen läßt. Studien belegen, daß ein solches Training einen alkoholkonsumreduzierenden Effekt nach einer stationären Therapie hat. Dadurch kann der Rückfall zwar nicht zu 100% vermieden werden, selbige treten jedoch später auf und verlaufen weniger gravierend, auch hinsichtlich seiner Auswirkung auf das Sozialleben.
Der Grund für die Alkoholkrankheit ist nach heutigem Wissensstand nicht durch eine Ursache begründet, sondern ein multifaktorielles Geschehen im biopsychosozialen Sinne.
Zu erwähnen ist die Comorbidität (siehe 2.4. Comorbidität) im Rahmen eines Suchtgeschehens, wobei hier zwischen primärer Grundstörung im psychiatrischen Sinne und Sekundärschäden im biopsychosozialen Sinne zu unterscheiden wäre. Zu den primären Grundstörungen wären der hohe Anteil der Persönlichkeitsstörungen bis hin zur Borderline-Symptomatik, des weiteren neurotische Störungen und nicht zuletzt auch psychotische Veränderungen zu rechnen.
Die fehlgeleitete Lernerfahrung und damit die unzureichende Ausbildung somatosensorischer, emotionaler und kognitiver Strukturen bedingt eine inadäquate Verarbeitung von Frustrationen und Konflikten. So werden bei inneren Spannungen und Dysphorien diese nicht durch gesunde Mechanismen bearbeitet (coping), sondern intendieren eine Veränderung durch exogene Substanzen (Suchtmittel). Die Speicherung von suchtspezifischen Gedächtnisinhalten im Rahmen der Suchtentwicklung gilt heute als gesichert, wobei es zwei Arten von Lernvorgängen gibt:
1. das Verstärkungslernen: Alkohol macht euphorisch
2. das Vermeidungslernen: "reinforcing" (Angstvermeidung).
Diese Erfahrungen mit Suchtmitteln werden biologisch gespeichert und kognitiv verhaltensmodifiziert.
Die Folge davon ist, daß nachfolgende Lernvorgänge beeinträchtigt sind, sofern nicht die "Lücken" aufgeholt werden. Manche Therapeuten sprechen von der sog. "Nachreifung" im Rahmen einer Psychotherapie.
3.3. Grundzüge der ambulanten Therapie
Nur bei einer geringen Anzahl der Alkoholkranken ist eine stationäre Therapie erforderlich. Daß dies so ist, stellt ein Verdienst der Ambulanzen, Beratungsstellen und den niedergelassenen Ärzten dar, an die sich alle wenden können, die direkt oder indirekt vom Alkoholproblem betroffen sind. Die vollständige ambulante Behandlung umfaßt alle medizinischen, psychotherapeutischen und sozialtherapeutischen Maßnahmen, die erforderlich sind. Eine der wichtigsten Aufgaben dieser Stellen ist die Information über die Alkoholabhängigkeit. Jedermann kann sich dort zunächst einmal ohne Nennung seines Namens oder seiner Daten, also anonym, darüber informieren, was Alkoholabhängigkeit ist und welche Hilfen und Lösungsmöglichkeiten bestehen.
Zur zweiten wesentlichen Funktion der ambulanten Einrichtungen gehört die Diagnosestellung, mit der dann auch das auf den Einzelnen zugeschnittene Behandlungskonzept erstellt wird. Dies festzustellen, nämlich ob bei jemandem eine Alkoholkrankheit vorliegt, ist durch die Neigung des Alkoholikers zur Dissimulation oft keineswegs einfach.
Wegen der hohen Tabuisierung des Alkoholkonsums in der Öffentlichkeit und auch aus anderen Gründen (z.b. wegen des oft fehlenden Leidensdrucks) ist damit zu rechnen, daß die Mitarbeit der Patienten bei der Diagnosenstellung nicht immer vorhanden ist. Dies hängt u.a. auch mit diversen Abwehrmechanismen (siehe 5.1. Abwehrmechanismen) zusammen. Außerdem sollte bedacht werden, daß die meisten alkoholbezogenen Schäden auf körperlichem wie auf psychosozialem Gebiet nicht alkoholspezifisch sind. Pathognomonische (für eine Krankheit kennzeichnende) Symptome gibt es auf somatischem Gebiet so gut wie gar nicht, wenn man von ganz seltenen Störungen absieht. Selbst das Alkoholentzugssyndrom ist, rein vom Erscheinungsbild her, auf weite Strecken sehr unspezifisch.
Es gewinnt, wie alle anderen Alkoholfolgeerkrankungen, seine spezifische Bedeutung erst durch den Kontext des anamnestisch geklärten Alkoholmißbrauchs.
Unter anderem sind in frühen Stadien des Alkoholmißbrauchs schwere körperliche Schädigungen selten festzustellen - während psychosoziale Schäden bereits zur Debatte stehen. Gerade im Vorstadium zur Abhängigkeit ist eine frühzeitige fachliche Beratung besonders wichtig.
Weitere Aufgaben der ambulanten Einrichtungen:
- Motivationsarbeit - von den ambulanten Institutionen kommt in den meisten Fällen die Initialzündung für eine Behandlung
- Nachgehende Behandlung - nach der stationären Behandlung (siehe Nachsorgephase)
3.3.1. Vorzüge einer ambulanten Therapie
Es werden Personen einbezogen, die wahrscheinlich aus berechtigten oder auch unberechtigten Gründen zu keiner stationären Therapie nicht bereit gewesen wären;
- die Betroffenen verbleibt in seinem sozialen Umfeld
- die in der Therapie erarbeiteten Erkenntnisse und Fertigkeiten können unmittelbar auf die realistischen Umweltbedingungen übertragen und dort erprobt werden.
3.3.2. Was spricht gegen eine ambulanten Therapie
- Wenn, nach dem Absetzen des Alkohols so starke Entzugssymptome zu erwarten sind, daß sie ambulant nicht behandelt werden können;
- der psychische Abhängigkeitsmechanismus so groß ist, daß eine konsequente Mitarbeit des Betroffenen nicht erwartet werden kann;
- durch die Abhängigkeit eine Hirnorganizität eingetreten ist, die seine Krankheitseinsicht verhindert oder vermindert;
- eine seelische Grundstörung höheren Grades vorliegt;
- und wenn der Patient in einem konfliktreichen Milieu lebt, in dem ihm die zusätzliche Belastung durch eine ambulante Behandlung nicht zugemutet werden kann.
3.4. Grundzüge der stationären Therapie
Der Erfolg von stationären Behandlungseinrichtungen gilt als gesichert: Keup [19] untersuchte mehr als 10.000 Patienten, die in Fachabteilungen für Suchtkranke stationär behandelt wurden. Nach einem Jahr konnten Daten von 79%, nach zwei von 76%, nach vier Jahren von 66% gewonnen werden. Die Auswertung ergab Abstinenzraten von 58% nach einem Jahr, 56% nach zwei Jahren und 47% nach vier Jahren.
Andere Studien fanden 6 Monate nach einer halbjährlichen stationären Therapie Abstinenzraten von knapp 60%, nach 18 Monaten waren 47% abstinent[26]. Eine vollständige Heilung der Alkoholkrankheit ist im strengen Sinn nicht möglich. Die Rückfallsneigung, das heißt, das Symptom, das krankhafte Trinken wieder aufzunehmen, bleibt bei allen Menschen, die jemals in ihrem Leben alkoholkrank waren, bestehen. Ein kontrolliertes Trinken ist daher nicht möglich.
Das stationäre Therapiekonzept wird in Phasen eingeteilt[7]:
1. Kontakt-
2. Entgiftungs-
3. Entwöhnungs-
4. Nachsorge-Rehabilitationsphase
3.4.1. Kontaktphase
Damit sich ein Alkoholkranker zur Therapie meldet und auch dort erscheint, ist meist eine Krise vonnöten, welche psychisch, physisch und bzw. oder sozial gelagert sein kann.
Die Krise ist auf jeden Fall eine Chance. Sie gibt die Möglichkeit, eigene Ressourcen zu mobilisieren (bzw. falls keine Ressourcen vorhanden sind, kann dies auch ein Scheitern für den Betroffenen bedeuten). Neue Bewältigungsstrategien können mit der Zeit mit dem Klienten erarbeitet werden bzw. müssen erst entwickelt werden, d.h. in der Krise wird nicht mitagiert, sondern die neue Chance aufgezeigt.
Für den Patienten bedeutet die Krise zu Beginn eine neue Lebenssituation mit einer guten Motivationsbereitschaft. Motivation ist ein Prozeß, welche sich nicht ständig in einem Hoch befindet. Sie ist vielmehr auch abhängig von der Beziehung zwischen Patient und Therapeut. Entscheidend dabei ist auch "Was geht verloren, wenn Symptom verloren geht?". Behindernd wirkt sich aus, wenn die Trägheit des Patienten ganz im Vordergrund steht, ebenso ein sekundärer Krankheitsgewinn. Für die meisten ist das Annehmen der Hilfe und die Anerkennung der Hilfsbedürftigkeit ein wesentlicher, aber schwerer Schritt.
Einsicht in die Krankheit, Bereitschaft zur Abstinenz und Verständnis für die nötigen Behandlungsmaßnahmen werden in dieser Phase mittels einem Vorgespräch überprüft.
Entsprechend der multifaktoriellen Genese der Alkoholabhängigkeit und dem komplexen Zustandsbild der Patienten mit somatischen, psychischen und sozialen Störungen wird die stationäre Behandlung in einem interdisziplinären Ansatz mit ärztlichen, pflegerischen, psychotherapeutischen und soziotherapeutischen Anteilen durchgeführt.
3.4.2. Entgiftungsphase
Die sogenannte Entgiftungsphase umfaßt vor allem jede Art medizinischer und medikamentöser Hilfe, die der Süchtige wegen der auftretenden Abstinenzerscheinungen benötigt. In dieser Zeit gilt es, unterschiedliche Abstinenzsymptome, wie Angst- und Spannungszustände, Verstimmungen und Depressionen zu behandeln. Eine ausführliche medizinische Beratung zu Beginn der Behandlung schafft die notwendige Compliance auch bei Patienten, die mit abweichenden und unklaren Vorstellungen von der Entgiftungsbehandlung antreten. Neben der Entzugsbehandlung werden bestehende Begleiterkrankungen diagnostisch abgeklärt und behandelt. Soweit dies nicht während des stationären Aufenthaltes ausreichend umgesetzt werden kann, wird der Patient anderen Fachabteilungen zugewiesen.
3.4.3. Entwöhnungsphase
Die Analyse der Lebenssituation bietet die Grundlage für die weitere Behandlungs-planung, die sich an der individuellen Realität des Patienten orientiert und im wesentlichen im Rahmen der Bezugspersonenarbeit entwickelt wird. Hierzu gehört auch die Bearbeitung relevanter biographischer Aspekte, die Klärung des vorhandenen Beziehungsgefüges und der weiteren sozialen Situation sowie im Einzelfall auch spezielle Psychodiagnostik.
Es kann nicht nur darum gehen, dem Alkoholkranken spontan das Suchtmittel zu entziehen und die damit verbundenen Abstinenzsymptome zu bekämpfen. Man kann ihm nicht seine bisherige, wenn auch fragwürdige, Stütze nehmen, ohne ihm durch entsprechende Therapie auch aus seiner eingeengten Lebenssituation herauszuhelfen. Ziel ist es, die einschweißten Verhaltensmuster des Alkoholabhängigkeitsprozesses zu unterbrechen.
Im weiteren wird versucht werden, neue Sozialisationsformen des Lebens ohne Alkohol einzuüben. Um dies zu erreichen, bedarf es umfassender Maßnahmen. Diese sind vorwiegend psychologisch-psychotherapeutisch, aber auch sozio-therapeutisch und pädagogisch orientiert. Die gleichzeitige Behandlung von Begleit- bzw. Folgeerkrankungen der Alkoholabhängigkeit ist auch in dieser Phase ein integraler Bestandteil. Da Süchtige mit Strukturen, aufgrund ihrer mangelnden Selbstkontrolle, schlecht umgehen können, ist eine strenge Strukturierung, welche mittels eines verbindlichen Therapievertrages transparent gemacht wird, von wesentlicher Bedeutung.
Der Süchtige sollte durch Einzelgespräche, Gruppen-, Arbeits- und Sozialtherapie in die Lage versetzt werden, persönliche Kräfte und Strategien zur Lebensbewältigung zu entwickeln. Er sollte lernen, Konflikte und Schwierigkeiten, wie beispielsweise Ängste, Minderwertigkeitsgefühle und dergleichen, ohne den Griff zum "bewährten" Mittel zu bewältigen[31]. Die Betroffenen sollen nach der Therapie in der Lage sein, ein substanzfreies, sinnerfülltes Leben zu führen, "ein Leben ohne Drogen in einer Welt mit Drogen". Der Behandelte soll nach erfolgter Therapie frei, unabhängig und handlungsfähig sein[32].
Therapie bedeutet Veränderung und Neuorientierung, Abstinenz ist nur die Voraussetzung für gesteigerte Lebensqualität, Lebenslust, Liebes- und Beziehungsfähigkeit sowie Arbeitsfähigkeit. Je nach Ressourcen werden sie Schritt für Schritt in mehr Selbst- und Eigenverantwortung entlassen.
Die stationäre Behandlung ist an dem Grundsatz ausgerichtet, jeden Patienten seinen individuellen Erfordernissen entsprechend zu versorgen, bzw. die Versorgung einzuleiten und ihn an kompetente komplementären Institutionen weiter zu vermitteln
3.4.4. Nachsorge- Rehabilitationsphase
Ambulante Nachsorge in Form von Beratung und Psychotherapie stehen in positivem Zusammenhang mit dem Behandlungserfolg Alkoholkranker.
Die Studie von Vannicelli (1978)[23] legt nahe, daß die Teilnahme an Nachsorgeangeboten das Trinkverhalten positiv beeinflußt und daß nicht umgekehrt eine Reduktion des Alkoholkonsums die Wahrnehmung von Nachsorgekontakten begünstigt.
Nach Costello (1980)[5] ist die Nachsorgeteilnahme ein wichtiger Einflußfaktor auf das Trinkverhalten nach der Entlassung, besonders auch dann, wenn man Prognosemerkmale, wie z.b. die Trinkkarriere, mitberücksichtigt. Eine Reihe an nicht experimentellen Studien zeigen, daß die Nachsorge allerdings nur dann effektiv ist, wenn sie regelmäßig und über mehr als sechs Monate erfolgt.
Diesbezügliche Arbeiten, z.b. Chvapil 1978 [23], befinden, daß die Dauer mindestens über ein Jahr gehen sollte. Ein realistisches Ziel aller Präventionsbemühungen kann nicht sein, daß die Rückfälle "abgeschafft" werden, sondern unter anderem ihre Dauer und Schwere sowie den durchschnittlichen Alkoholkonsum zu reduzieren und damit die gravierenden Auswirkungen langanhaltender Rückfälligkeit und damit ev. Arbeitsplatzverluste zu mildern bzw. zu verhindern (Hartenfels 1980)[23].
Den verschiedensten Untersuchungen zufolge konzentrieren sich fast alle Ansätze zur Rückfallvorbeugung auf die Vermittlung sozialer Kompetenzen. Faktum ist, daß nicht alle Rückfälle durch die Nachsorge verhindert werden können. Es ist jedoch Aufgabe dieser Betreuung, den Patienten zu motivieren, nach einem Auftreten eines Rückfalls diesen nicht auf die Seite zu schieben und dem Geschehen Resignation seinen Lauf zu lassen, sondern baldmöglichst Unterstützung aufzusuchen, wodurch massiver Selbstverachtung, Schuldgefühlen und schweren Rückfällen vorgebeugt werden kann.
Schmitz (1986): "Je schneller ein Rückfall gestoppt werden kann, desto geringer sind die Folgen."[23] Außerdem erscheint eine gezielte Vorbereitung vom Patienten auf den Umgang mit emotionalen Problemen von enormer Dringlichkeit.
Das Problem liegt häufig dabei, daß ein zu geringes Angebot an Nachsorgeeinrichtungen besteht, bzw. daß nur relativ wenige Alkoholkranke erkennen, daß das reine Abstinentsein nicht die dauerhafte Lösung ist und es für die Veränderung eines immer wieder aktiven eigenen Zutuns bedarf.
Als effektiv in der Vorgehensweise haben sich erwiesen:
* telefonische Erinnerungskontakte mit der früheren Behandlungsstation, in denen wieder zu Nachsorgegesprächen angeregt wird
* die Verfügbarkeit von Nachsorgeangeboten in der Nähe des Wohnortes des Klienten
* Verträge mit dem Lebenspartner des Abhängigen und dem Abhängigen selbst, in denen eine gemeinsame Zusage zur Wahrnehmung von Paargesprächen nach der Entlassung erfolgt, verbunden mit häuslichen Erinnerungshilfen und einer Belohnung der Gesprächsteilnahmen
Nicht geklärt werden konnte in diversen nicht experimentellen Studien, ob bei eintretenden Krisen der berühmte "erste Schluck" durch die Nachsorge- in welcher Form auch immerwirksam reduziert werden konnte.
4. Nachsorge
Es ist unumstritten, daß ein stationärer Entzug mit ev. anschließendem Aufenthalt ohne Nachsorgephase wenig sinnvoll ist. Hier sollte die Stabilisierung neuer Wertund Verhaltensmuster erfolgen: der Wiedereingliederung in die Familie, dem sozialen Umfeld und dem Beruf, ev. die Fixierung der Dauerabstinenz (siehe Harmreduktion). Unmittelbar nach der stationären Therapie besteht für Alkoholkranke jedoch deutlich erhöhte Gefahr, rückfällig zu werden.
Die ersten drei bis sechs Monate gelten als sehr kritische Zeit, in der 2/3 aller Rückfälle stattfinden (Anton/Schulz, 1990, Küfner et al. 1988) [9].
Durch die Nachsorge können Rückfälle früh aufgegriffen bzw. minimiert und bearbeitet werden, der Patient hat einen Ansprechpartner, mit welchem er sein Leben wieder in die Reihe kriegen kann. Der Arzt hat die Aufgabe einer eventuell unterstützenden medikamentösen Einstellung.
Daher ist die Nachsorge entscheidend.
Die Etablierung von sog. Nachsorgemaßnahmen könnte hier ihre Begründung finden. Es handelt sich hierbei gleichzeitig um Vorsorge- bzw. Sekundärprävention (Schwoon, 1988).[9]
4.1. Arten der Nachsorge
4.1.1. Nachsorgegruppen
Für viele Alkoholabhängige bedeutet der Eintritt der Abstinenz einen merklichen Gewinn. Sie erleben in der Familie und am Arbeitsplatz Unterstützung statt Anfeindung, genießen neue und wiedergewonnenen Freizeitaktivitäten, sie sind stolz die finanzielle Situation wieder in den Griff bekommen zu haben u.ä.
Für die Aufrechterhaltung der Abstinenz über längere Zeiträume ist die Teilnahme an Selbsthilfegruppen als fördernd und wahrscheinlich ausschlaggebend zu bezeichnen (Becker et al., 1986)[9]. Besonders wichtig erscheint, daß die Teilnahme an organisierter Nachbetreuung bereits während des stationären Aufenthaltes vorbereitet und organisiert wird. Zum einen will Selbsterfahrung in Gruppen geübt sein und zum anderen tun sich nicht alle betroffenen Patienten zunächst leicht damit. Die typischen "Therapieprofis", d.h. Patienten mit jahrelanger Sucht-/Therapieerfahrung sind in der Gruppe unschwer zu erkennen.
Die Gruppe ist ein dynamisches Gebilde, ein Interaktionssystem, das dann gegeben ist, wenn mehrere Personen in Wechselbeziehung miteinander stehen. Die ersten Gruppenexperimente sind in einer deutlichen pädagogischen Absicht unternommen worden, um für eine befriedigende "Kommunikation", für kontrollierte und überlegte Entscheidungen, für wirksame Arbeitsabläufe zu sorgen.
Dann verschob sich der Akzent auf die Gruppenprozesse und die Notwendigkeit, eine offene Gruppenerfahrung zu schaffen, damit diese Prozesse Gegenstand einer Bewusstwerdung sein, ja sich überhaupt abspielen könnten.
In einer Prozeßgruppe stehen Verhaltensweisen, Äußerungen und Bedürfnisse, Interessen und Gefühle in einer ständigen Wechselbeziehung zwischen den Gruppenmitgliedern, die entsprechend ihrer Persönlichkeit Rollen übernehmen; auch die Situationen wechseln ständig. Es entstehen Gruppenstrukturen und Gruppenprozesse, welche eine wichtige Erfahrung vermitteln.
Das eigene Verhalten kann gelagert am Verhalten anderer erkannt, überprüft und korrigiert werden; eigene Anschauungen, Erfahrungen, Wertungen, Entscheidungen und Gefühle werden durch die Mitglieder der Gruppe in wechselnder Weise beeinflußt.
Dabei ist der Realitätspegel in der Gruppe in der Regel höher als in der Paarbeziehung. Die Gruppe bildet sich aus einer Kombination aller Verhaltensweisen, Bedürfnisse, Begabungen, Fähigkeiten und Schicksale ihrer Mitglieder.
Das hohe erzieherische Potential wird durch Auseinandersetzungen mit sich selbst und den anderen und auch durch die Wechselbeziehung gegeben. Da sich der Alkoholkranke mit zunehmend chronischem Verlauf in die Isolation begibt, führt die Gruppe aus der Isolation zurück und somit auch in die Gesellschaft. Der Abhängige erfährt dabei Annahme, Ich- Entlastung, Ich-Stärkung und ein konkretes Übungsfeld für neue Verhaltensweisen und coping-Strategien.
Patienten, die nicht nachbetreut werden, verschwinden im Nichts und sind nicht evaluierbar. Wieser und Kunad legten eine Alkoholstudie vor, aus der hervorgeht, daß die rein körperliche Entgiftung ohne weiterführende spezifische Behandlung nahezu erfolglos ist.
Nach unseren Erfahrungen nehmen mehr als 50% der zuvor aus der stationären Behandlung entlassenen Alkoholpatienten an Nachsorgegruppen teil, hiervon 2/3 an professionellen Nachsorgegruppen und 1/3 an Gruppen der Anonymen Alkoholiker (AA) bzw. anderen Einrichtungen.
4.1.1.1. Nichtprofessionelle Selbsthilfegruppen
4.1.1.1.1. Anonyme Alkoholiker (AA)
Nach der stationären Therapie sind die Anonymen Alkoholiker Gruppen, die am häufigsten aufgesuchten Gruppen in diese Richtung.
Voraussetzung für die Teilnahme an der AA- Gruppensitzung, ist der Wunsch, mit dem Trinken aufzuhören.
Studie von Hoffmann et al. 1983 [23]: Es wurden 900 Abhängige, welche sich zuerst in einer 4 wöchigen stationären Therapie befanden, untersucht. Etwa 3/4 dieser Patienten, die wöchentlich (73%) oder zumindest mehrmals im Monat (69%) an den Treffen der AA teilnahmen, lebten über alle 6 Monate der Nacherhebung hinweg rauschmittelfrei. Diese Rate sank auf 45% bei nur einmaliger AA- Teilnahme pro Monat bzw. auf 33%, wenn keine AA- Kontakte vorhanden waren.
Fazit: Jene Patienten, welche die AA- Gruppe häufig kontaktierten, lebten doppelt so oft suchtmittelfrei als diejenigen, welche die AA- Gruppe nicht in Anspruch nahmen. Es scheint festzustehen, daß eine Teilnahme besonders im ersten Jahr nach der stationären Therapie für ein abstinenzfreies Leben von großer Bedeutung ist.
Auch andere Erhebungen kommen zu einem ähnlich positiven Ergebnis bezüglich der Abstinenzrate.
Nach Rollnick und Heather 1982 [23] werden die Rückfälle bei Alkoholikern durch das Abstinenzprogramm gefördert, speziell bei jenen, die nach der Behandlung, wenn auch nicht exzessiv, erneut trinken wollen.
In einer theoretischen Analyse leiten Rollnick und Heather von Bandura, (1977), ab:[23]
Der Alkoholiker muß zum Zweck der Abstinenz zwei Erwartungen teilen. Einerseits jene, daß er über wirksame eigene Kompetenzen verfügt, um abstinent zu bleiben (Handlungserwartung, Selbstwirksamkeitserwartung), andererseits, daß eine lebenslange Abstinenz das Alkoholproblem lösen wird.
Nach den Autoren zufolge, teilen diese Auffassungen eine ganz beträchtliche Anzahl von Alkoholkranken nicht, nämlich daß die Totalabstinenz Voraussetzung für die Beseitigung des Alkoholproblems sei - sie teilen diese Ansicht auch nicht nach mehreren Rückfällen. Vielmehr ist eine nicht unerhebliche Anzahl der Abhängigen überzeugt, durch kontrolliertes Trinken schädliche Ausmaße des Trinkens nicht aufkommen zu lassen. Deshalb meinen die Autoren Rollnick und Heather [23], daß kontrolliertes Trinken ein mögliches alternatives Behandlungsziel sei. Weiters betonen beide, daß in den abstinenzorientierten Programmen neben den oben genannten positiven Erwartungen auch negative Erwartungen aufgebaut werden, wie z.b.: "Wenn ich den ersten Schluck trinke, werde ich wieder rückfällig (negative Ergebnisfolgeerwartung)
oder
"Es gibt Dinge, die mich wieder rückfällig werden lassen" (negative Selbstwirksamkeitserwartungen).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Zweistufenmodell des Rückfalls: darin werden zwei Erklärungen nach völlig verschiedenen Stufen des Rückfallsprozesses für notwendig gehalten. Bei Stufe 1 dass einige Klienten nach einer Abstinenzphase trinken, andere nicht. Bei Stufe 2 steigert ein Teil der Patienten, welche neuerlich zum Alkohol greifen, das Trinkverhalten bis zum Exzeß, während der andere Teil die Alkoholmenge auf mäßige Mengen beschränkt.
Fazit: In allen Theorien wird hervorgehoben, daß ein Rückfall nicht die Folge eines zwanghaften körperlichen Verhaltens nach Alkohol ist; entscheidend dafür, ob einer drohenden Rückfallgefahr standgehalten wird bzw. ob ein Rückfall in Grenzen gehalten wird, werden vielmehr Einstellungs- und Verhaltensvariablen, nämlich die Überzeugung, mit schwierigen Umständen zurechtzukommen (Selbstwirksamkeits-erwartungen), die tatsächliche Verfügbarkeit von Bewältigungsreaktionen in schwierigen Situationen, die Überzeugung, daß der erste Schluck nicht zum Kontrollverlust führen muß etc.
4.1.1.2. Professionelle Nachsorgegruppen
Wie schon der Begriff sagt, werden diese Gruppen von Professionellen organisiert und geleitet, welche aus den verschiedensten Berufsfachsparten, wie Psychiatrie, Psychologie und Psychiatrie-Pflege, kommen.
In der Regel werden die Klienten nach stationärer, oder ambulanter Therapie und einer gewissenhaften Vorbereitung der Organisation zugewiesen, wo mittels einem Vorgespräch, die Überprüfung auf das Vorhandensein einer freiwilligen Bereitschaft zur Veränderung und der erwünschten Gruppenfähigkeit erfolgt. (Patienten mit einem geringen Veränderungspotential bzw. mit einem organischen Psychosyndrom oder einer akuten Psychose sind für dieses Modell weniger gut geeignet).
Auch bedarf es nochmals einer Motivationsarbeit, damit die Notwendigkeit und Dringlichkeit der Nachsorgegruppe einsichtig erkannt wird. Um den Betroffenen die Entscheidung für die Therapie zu erleichtern, werden eventuell vorhandene so genannte Motivationshindernisse, wie sekundärer Krankheitsgewinn, Angst vor Veränderungen etc. diskutiert und entsprechende Lösungswege aufgezeigt.
In der geschützten Atmosphäre einer stationären Behandlung beurteilen viele Patienten sowohl die auf sie zukommenden Probleme als auch ihre eigene Belastungsfähigkeit oft zu optimistisch. Die durch den Alkoholmißbrauch bedingten Ausfallerscheinungen im körperlichen, seelischen, familiären, beruflichen und gesellschaftlichen Bereich können während einer stationären Behandlung meist nicht vollständig beseitigt werden.
Wie schon gesagt, zeigen sich viele Probleme oft erst im Alltagsleben, das die Betroffenen dann ohne den früher gewohnten "Problemlöser" bewältigen müssen. Erst im direkten Wechselspiel zwischen dem Leben in der Realität und einer professionellen Selbsthilfegruppe mit dem Übungsfeld für soziales Verhalten, Spiegeleffekt, Interaktion, Selbstentwicklung, Selbstverwirklichung und Korrektur, können viele Probleme erfaßt und bewältigt werden.
Es sei nochmals unterstrichen, daß das Miteinbeziehen der Angehörigen eine sehr wichtige Maßnahme darstellt. Ein weiteres Kriterium ist die Gemeindenähe, denn die Krankheit sollte dort behandelt werden, wo sie entstanden ist, und zwar im Mittelpunkt des Geschehens. Es soll damit auch eine Steigerung der Therapieeffizienz und eine erhöhte Akzeptanz in der Bevölkerung erreicht werden.
Die Dauer der Therapie, welche wöchentlich erfolgt, beträgt 1- 2 Jahre, wobei Verlängerungen nicht ausgeschlossen sind.
Wie schon mehrmals erwähnt, verbessert die Nachsorge die Abstinenzbereitschaft signifikant, wobei nach eigenen Feststellungen der Faktor "Kontinuität" eine wesentliche Rolle zu haben scheint. Allerdings belegen neuere Studien, daß es einen beträchtlichen Prozentsatz von Alkoholikern gibt, die nach stationärer oder ambulanter Entwöhnungsbehandlung abstinent geblieben sind, obwohl sie an keiner Nachsorgeaktivität teilgenommen haben (Küfner u. Feuerlein)[9].
Speziell bei professionellen Selbsthilfegruppen stellt sich die Frage nach der Bedeutung offener und halboffener Gruppen. Während offene Gruppen jederzeit von Interessierten, die Hilfe suchen, besucht werden können (hohe Fluktuationsrate), ist die Aufnahme in eine bestehende halboffene Gruppe in aller Regel nur zu bestimmten Zeiten möglich.
Der Nachteil bzw. Vorteil an offenen Gruppen ist, daß man immer wieder von vorne beginnt, was auch Zeitverlust bedeutet. Das Positive daran ist, daß neue Anregungen und Impulse vermittelt werden. Vorteil der Halboffenen ist der Aufbau einer Vertrauensbasis, Verhaltensdefizite und Konflikte können langfristig und intensiver behandelt werden. Die äußeren Struktur wird bei Gruppenbeginn von den Gruppenleitern vorgegeben, wie Zeit, Kontrollmodus und Gruppenregeln.
Die Verbindlichkeit in der Gruppe ist Voraussetzung für die eigene (persönliche) Entwicklung und für die Entwicklung der Gruppe als Ganzes. Wegbleiben von der Gruppe ist nicht nur ein Versäumnis des Einzelnen, sondern als Verlust für die gesamte Gruppe aufzufassen.
Für eine intensive personenorientierte Gruppenarbeit bewährt sich eine Größe von 5 bis maximal 12 Teilnehmern. Aus eigener Erfahrungen und wissenschaftlichen Untersuchungen wissen wir, daß sich Gruppen, die sich gemischtgeschlechtlich zusammensetzen den anderen vorzuziehen sind. Alter, Sozialstatus und Intelligenz können noch so unterschiedlich sein, es wird eine Bereicherung und neue Erfahrung mit vermehrter Lernfähigkeit geboten. Für die Dauer hat sich eine durchschnittliche Zeit von 90 Minuten bewährt.
Günstig wirkt sich eine gute Atmosphäre aus, eine warme ansprechende Raumgestaltung, bequeme Stühle und eine angenehme Beleuchtung.
Sitzen die Teilnehmer an Tischen, sind sie zwar in der Lage sich einiges zu notieren, können jedoch auch einen großen Anteil ihres Körpers verstecken.
Die Sitzordnung im Kreis symbolisiert eine geschlossene Ganzheit und hat dadurch einen therapeutischen Charakter. Wenn die Gruppenteilnehmer ihre Sitzordnung frei wählen können, so ist dies bereits ein Soziogramm für einen fachkundigen, erfahrenen Gruppenleiter.
Die Rollenstrukturierung wird bereits in der ersten Sitzung vorgenommen, dabei fungieren die Gruppenleiter als professionelle Helfer im Sinne von Stützung und Begleitung während des Gruppenprozesses. Der Prozeß wird zunächst von sogenannten praeödipalen Problemen bestimmt. Charakteristisch für das Verhalten einer Gruppe im praeödipalen Niveau ist, daß die einzelnen Teilnehmer Schwierigkeiten haben, sich als eigenständiges Individuum voneinander abzugrenzen _28_.
Dies drückt sich auch in einer überstarken oralen Bedürftigkeit aus. Von den Gruppenleitern wird die Elternrolle gewünscht, in jeder Hinsicht für die Gruppe sorgend. Werden diese Versorgungen nicht erfüllt, kann dies zu einer aggressiven Atmosphäre in der Gruppe führen. Dies drückt sich auch in Äußerlichkeiten, wie Kritik an der Gruppengröße, Häßlichkeit des Raumes etc. aus.
Im ödipalen Niveau, welcher der nächste Schritt in der Gruppentwicklung ist, wird die frühere ödipale Konstellation hergestellt. Die Teilnehmer erleben die Gruppe als Familie mit Eltern (Gruppenleiter) und Geschwister (Gruppenmitglieder) und bemühen sich in ihr um einen möglichst günstigen Platz nahe am begehrten Elternteil. Diese Dynamik wird vor allem bestimmt durch eine Rivalität der Gruppenmitglieder untereinander um den jeweils gegengeschlechtlichen Elternteil.
Oft stellt sich die Frage, sind Gruppensitzungen artifiziell. In der Tat wird man eine gewisse Künstlichkeit nicht leugnen können _28_.
Im Gegensatz zur realen Gesellschaft, die ihre eigene realistische Struktur und Dynamik besitzt und die in Wirklichkeit auch nur aus einem Geflecht von Kleingruppen besteht, sitzt man hier in einem Kreis und diskutiert ohne vorgegebener Tagesordnung mit den Gruppenleitern, die sich auf einer metakommunikativen Ebene bewegen. In der Gruppe selbst erhebt sich der Einwand, daß diese zu wenig mit dem alltäglichen Leben, realen Leben zu tun haben. Von den Gruppenmitgliedern kommen oft Äußerungen wie "Ihr seid zwar alle nett, aber ich kenne euch nicht, bemühen wir uns also, die Zeit angenehm zu verbringen und Gesprächsthemen zu finden, die uns alle interessieren."
Der Einwand der Künstlichkeit ist jedoch weit weniger entscheidend, als das, was in einer Gruppe vorgeht. Die Teilnehmer brauchen im allgemeinen nicht lange, um zu bemerken, daß eine gewisse Realität gegenwärtig ist und wie beängstigend sie sein kann:
Es werden Emotionen erlebt, persönliche Schwierigkeiten empfunden, Leidenschaften offenbaren sich, oft gerade bei solchen, die sich zu Beginn am skeptischsten oder am unbekümmertsten gezeigt haben.
Die Gruppe kennt die Schwankungen zwischen Momenten der Euphorie und der Entmutigung, man lacht, man nimmt sich auseinander, man greift an und man verteidigt sich, man versucht angenommen, geschätzt zu werden, man bemüht sich zu beweisen, daß man ein guter Organisator ist, daß man die Gruppe verstanden und Gespür für sie gezeigt hat. Wie könnte man all dieser lebendigen Bewegung eine eigene Realität absprechen.
4.1.2. Ambulant aufsuchender Dienst
Im Mittelpunkt dieses Dienstes stehen extramurale Einrichtungen, welche in der Regel sozialpsychiatrisch orientiert sind. Die Mitarbeiter des Dienstes kommen gewöhnlich aus verschiedenen Berufsfachsparten, die im Rahmen der Nachsorge und Krisenintervention, vor Ort, tätig werden.
In der Regel handelt es sich um ein Klientel, welches aufgrund von alkoholbedingten Sekundärschäden oder primär psychiatrischen Erkrankungen in ihren Aktivitäten so eingeschränkt sind, daß sie nach den Kriterien anderer Nachsorgeeinrichtungen nicht eingebunden werden können.
Um überhaupt angemessen auf den Patienten eingehen zu können, muß sich der Mitarbeiter ausführlich mit der Sucht auseinandersetzen. Die laienhafte Meinung, daß der Betreuer "heilen" kann, kann in dieser Form nicht akzeptiert werden: Wer glaubt, bei Suchterkrankten funktioniere eine "Heilung" wie bei einem operativ entfernten Gallenstein, der irrt und wird auch über kurz oder lang in seiner Rolle überfordert und letztendlich auch frustriert sein.
Therapieansatz ist in erster Linie nicht die Abstinenz, sondern Unabhängigkeit in allen Lebensaktivitäten zu erreichen bzw. zu bewahren, mit möglichst großem, individuellem Spielraum. Entstehung und Verlauf von Abhängigkeitserkrankungen haben wesentlich mit der Art und Weise zu tun, wie sich die Kranken mit ihrer Umwelt auseinandersetzen, wie sie mit Anforderungen des Alltags umzugehen vermögen, und mit der Art und Weise, wie ihre Umwelt in sozialer Hinsicht beschaffen ist und auf die Krankheit reagiert.
Ein weiterer therapeutischer Ansatz ist die Transaktion, die darauf ausgerichtet sein sollte, das Erwachsenen-ICH der Patienten soweit wie irgend möglich zu stärken, d.h. sie in die Lage zu versetzen, die Realität wieder mehr zu beachten, sich situationsgerecht zu verhalten, die Interessen anderer zu berücksichtigen, sich an die allgemeinen Spielregeln zu halten, um somit eine Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu ermöglichen. Eine wichtige Aufgabe besteht in der Strukturierung und Gestaltung von realitätsnahen Aktivitäten und in einer sinnvollen Freizeitgestaltung.
Die psychagogische Tätigkeit hat das Ziel, den Klienten zum Fachmann für sich und seine Symptome zu entwickeln, der sich zu hinterfragen beginnt und neugierig seine ihn im Alltagsleben hindernden Fehlverhaltensweise aufspürt. Helfen meint dabei nicht, daß der Betreuer für den Kranken etwas Probleme löst, sondern gemeinsam mit ihm versucht, den Sinn seines Symptoms, seines Verhaltens, seiner Konflikte oder Körpersymptome zu entdecken und in einem ganzheitlichen Sinne verstehen zu lernen. Hilfe soll also zur Selbsthilfe werden. Der Klient muß lernen, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen; nur so kann er zu Erfolgserlebnissen kommen und somit selbständig und unabhängig werden.
Im Rahmen der Betreuertätigkeit neigen die Klienten zu einer stärkeren Regression. Dabei kann es zu einer Wiederbelebung regressiver Wünsche kommen, wo der Patient in uns die fürsorgende Mutter sieht, welche viel Zeit für ihn hat. Appellativ demonstrieren die Klienten auf agierender Weise ihre Hilfsbedürftigkeit und Abhängigkeit. Um dieser schwierigen Situation nicht hilflos ausgesetzt zu sein, muß darauf geachtet werden, dem Patienten nur so viel Unterstützung wie notwendig und so wenig wie möglich gegeben wird. Die Gesellschaft und auch das unmittelbare Umfeld reagieren auf die Suchterkrankten häufig mit Ablehnung.
Angefangen bei der Wohnungssuche bis hin zu Rehaanträgen erleben sowohl Betreuer als auch Patienten oft eine "Abfertigung", Vorurteile oder Scheuklappenhaltung.
Der Patient ist speziell in der ersten Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt in einer sehr vulnerablen Phase und spürt äußerst gut, wer ihm wohlgesinnt ist und wer nicht. Für den Patienten von Bedeutung ist eine "klare Linie", d.h. Spielregeln aufstellen und klare Grenzen setzen. Dadurch kann sich einerseits der Patient besser orientieren, andererseits läßt es sich auch für den Betreuer einfacher arbeiten: Thema Coabhängigkeit (siehe 5.4.).
Durch ein Vertrauensverhältnis kann auch ein entspannterer Umgang entstehen, da der Patient nicht ständig mit Ausreden und Abwehrmechanismen arbeiten muß. Kontraindiziert sind Aggressionen von seiten des Betreuers. Auch wenn die Patienten - meist zu Beginn - wohlüberlegt auf scheinbar Wesentlicheres als ihre Alkoholproblematik lenken, ihre Abwehrmechanismen ins Spiel kommen, sollte sich der Betreuer nicht irreführen lassen.
Aufgabe ist es, mit dem Patienten diszipliniert umzugehen und dabei im Sinne der "therapeutischen Abstinenz" keine Inanspruchnahme der Macht geltend zu machen. Ist dies der Fall, fühlt sich der Patient nicht angenommen und auch nicht respektiert. Einziges Ergebnis wäre ein Machtkampf, wobei sich wahrscheinlich das Trotzverhalten, eventuell auf beiden Seiten, breit machen würde.
4.1.2.1. Aufsuchende Einzelbetreuung nach dem Modell vom Psychosozialen Pflegedienst
Dieses Klientel wird der komplementären Einrichtung mittels fachärztlicher Zuweisung zugeordnet, mit dem Ziel, die Betroffenen in ihrer gewohnten Umgebung professionell zu betreuen. Wie schon eingangs erwähnt handelt es sich hier in erster Linie um ein Klientel, welches aufgrund seiner seelischen oder körperlichen Beeinträchtigung, seiner Unabhängigkeit in der Bewältigung der alltäglichen Aktivitäten, verloren haben.
Dieser speziellen Behandlungsform geht voraus, daß das Bemühen um den Aufbau eines tragfähigen Arbeitsbündnisses mit dem Patienten als einem möglichst gut informierten, für seine eigene Behandlung mitverantwortlichen Partner, der an möglichst vielen Entscheidungen mitbeteiligt wird. Diese treffende Beschreibung der Zusammenarbeit mit Patienten enthält wichtige Voraussetzungen einer konstruktiven Beziehung zwischen dem Patienten und Helfer.
Obschon eine aktive Beteiligung des Patienten an seiner Behandlung als eine wichtige Voraussetzung für die Behandlung gilt, ist diese in der Suchtarbeit nicht immer vorhanden. Ein Teil der Erklärung für diese fehlende Mitarbeit oder Aktiven Beteiligung der Süchtigen liegt in der Natur der psychischen Störung.
Im Jahre 1994 hat diese Form der Betreuung ihren Ursprung, wobei aufgrund mangelnder Personalkapazität vorerst noch eine regionale Einschränkung besteht.
Das multiprofessionelle Team umfaßt ca. 10 Mitarbeiter, welches in Form einer Bezugspflege 15-20 Klienten vor Ort betreut, wobei es bezüglich der Betreuungsdauer keine zeitlichen Festlegungen gibt.
Die Anzahl der Kontakte richten sich ausschließlich nach dem individuellen Bedarf und reichen von mehrmals wöchentlich, bis zu ein- oder zweimal pro Monat.
Am Anfang besteht eher eine unspezifische Betreuungsarbeit, einerseits zur Herstellung einer Vertrauensbasis, anderseits zur Erfassung von Problemen und Interessen des Klienten. Erst nach und nach werden nach dem Baukastensystem die einzelnen Probleme, je nach Wichtigkeit, angegangen und so gut als möglich aufgearbeitet. Oberstes Ziel unserer Tätigkeit, ist eine bestmögliche, psychische, somatische, sowie soziale Rehabilitation.
Die Behandlungsziele müssen erreichbar, realistisch und nach Möglichkeit überprüfbar sein. Sie sind einerseits auf der Grundlage der einzelfallbezogenen Pflegediagnostik zu erstellen, anderseits aber auch Ergebnis eines Prozesses im Verlauf des Aufenthaltes. Sie können also nur gemeinsam und schrittweise von und mit Klient(in) Arzt und Bezugsbetreuer entwickelt und überprüft werden.
Im Ergebnis sollen sie beschreiben, was von und mit dem Klienten erreicht wurde, wenn die Behandlung beendet ist. Dazu gehören, medizinische, pflegerische und psychosoziale Stabilisierung, Verbesserung der Beziehungsfähigkeit und konkrete suchttherapeutische Fortschritte.
Abgerundet wird diese Form der Betreuung, durch regelmäßig verordnete Visiten beim zuweisenden Facharzt, sowie, wenn möglich, Beteiligung an Nachsorgegruppen. Als suchtspezifischer Ansatz gilt bei dieser Nachsorgeaktivität, sowohl die Abstinenz, als auch die Harmreduktion, wobei als Fernziel eine gewisse Abstinenzorientierung, im Vordergrund stehen sollte.
Um einen geordneten Betreuungsablauf zu gewährleisten, sind schriftlich verbindliche Vereinbarungen, sowie Alkomatkontrollen unerläßlich.
Einmal im Monat findet eine Teambesprechung statt mit den Schwerpunkten Information, Klientenfallbesprechung, Intervision und gegenseitige Evaluation.
Seit Beginn der Einzelbetreuungen wurden bis zum heutigen Datum Klienten unterschiedlichen Geschlechtes betreut.
4.1.2.2. Betreute Wohngemeinschaften nach dem Modell vom Psychosozialen Pflegedienst
Wir haben in den letzten vier Jahren dreiundzwanzig Alkoholpatienten in einer therapeutischen Wohngemeinschaft nachbetreut. Diese Wohngemeinschaft ist für jeweils vier männliche bzw. weibliche Suchtpatienten ausgelegt.
Es ist vorgesehen, daß die Betroffenen entweder einer Arbeit nachgehen oder aber ein geschütztes Arbeitsprojekt (Tagesstruktur) in Anspruch nehmen. Vor Eintritt in die Wohngemeinschaft hat der Patient einen Therapievertrag zu unterschreiben. Dieser beinhaltet die Hausordnung etc.
All diese Patienten haben sich vor der Aufnahme einem Nachsorgeprogramm einer stationären Behandlung unterzogen (Alkoholkurzzeitbehandlung). Des weiteren sollten die Patienten strukturierte Nachsorgegruppen einmal wöchentlich besuchen.
Diese Wohngemeinschaft wird von drei diplomierten Pflegern, einer klinischen Psychologin und einem Facharzt für Psychiatrie und Neurologie betreut.
Die Betreuungsfrequenz durch das Team erfolgt mehrmals wöchentlich. Es findet eine Bezugsbetreuung statt, d.h. jeder Betreuer hat einen Bezugspatienten. Die hier stattfindenden Nachsorge ist vor allem psychosozial ausgerichtet.
Ein wichtiger Punkt dabei ist zuerst einmal die Erstellung einer Anamnese auf jeder Ebene; ein Einzelgespräch, um das Wichtigste zu erfassen; ebenso muß mit der Zeit eine Vertrauensbasis zum Patienten aufgebaut werden, um so Zugang zu ihm zu haben. Entscheidend dabei ist die Art der Begegnung zwischen Betreuer und Patient: die "Chemie" zwischen den beiden muß stimmen, die Atmosphäre auch etc. Die ersten Begegnungen gestalten sich häufig so, daß erst Finanzielles geregelt werden muß (woher kommt das Geld für die Miete? Liegen Schulden an? Gibt es eine Beschäftigung für den jeweiligen Patienten, der er gewachsen ist und die sich am Arbeitsmarkt anbietet, bzw. gibt es eine Strukturierung durch die Tagesklinik an der Fachabteilung für Alkohol- und Medikamentenentzug oder an einer Tagesklinik?). Weiters liegen oft andere sozialarbeiterische Tätigkeiten an, wie Steuerregelung beim Finanzamt, Stellen der Rehaanträge zur Kostendeckung des Lebensunterhaltes, Ansuchen um Pensionierung; ev. stehen auch Gerichtsverfahren an, wobei der Patient in jedem Fall mit dem Papierkrieg, der Bürokratie, Hilfestellung erwarten kann. Es ist aber auf keinen Fall Ziel, dem Patienten die Arbeit abzunehmen, sondern ihm eine Hilfe zur Selbsthilfe angedeihen zu lassen.
Besonders zu Beginn stellen wir häufig fest, daß die eigene Abhängigkeit nicht akzeptiert wird, und besonders "Psychiatrie- Profis", d.h. solche Patienten, die schon diverse Einrichtungen durchlaufen haben, bemühen sich aufs äußerste, nichts von sich preiszugeben, ja sogar im Gegenteil, sie versuchen den Betreuer zu therapieren, um von sich selbst abzulenken.
Die bereits vorher erwähnten Abwehrmechanismen stehen im Vordergrund, und es gestaltet sich schwierig, das Verständnis für die eigene Verantwortlichkeit zu reaktivieren.
In diversen Supervisionen beim WG- Team erinnern wir uns, nicht zu moralisieren, den Patienten so zu akzeptieren wie er ist und dort abzuholen, wo er gerade steht. Das heißt in unserem Fall: Komplett weg von der Sucht, Schulden abbauen, Schulden in den Griff kriegen, Arbeitsplatz finden oder ihn behalten, eine Stadtwohnung zu finden, zu bekommen und dort zu "überleben".
Der Schlüssel zur Seele dieser Patienten - und damit ev. zum Erfolgs- führt über das "Miteinander", das Vertrauen, die Anerkennung von Leistungen und die Wertschätzung der eigenen Person und jener des anderen.
Erstes Nahziel ist es u.a. die Verletzungen, welche diese Menschen offensichtlich erfahren haben und mit Großspurigkeit kaschieren, zu mindern; die Vergangenheit, in der "Mist gebaut" wurde, und die eigene Sprachlosigkeit, welche durch scheinbare Coolness zu überspielen versucht wird, zu bewältigen. Erfolg wird hier ganz anders gewertet: Es ist schon eine große Leistung, wenn ein Patient zwei Monate trocken ist.
Die Arbeitsuche gestaltet sich für Patient und Betreuer meistens recht diffizil:
Einige unserer Klienten haben keinen Abschluß, können auch nichts mehr zusätzlich lernen an einer Abendschule oder in einem Kurs, da sie sich finanziell übernommen haben, andere sind zu "alt", und der Arbeitsmarkt sieht ja generell für solche Leute nicht sehr rosig aus. Die Arbeitsstelle findet sich dann oft am Bau oder im Gastgewerbe, wobei hier viel versprochen wird, was oft nicht zutrifft (der Patient wagt es aber nicht, sein Recht zu verlangen) dazu kommt, daß das hier arbeitende Volk oft selbst dem Alkoholteufel nicht abgeneigt ist, d.h. der Patient müßte bereits äußerst stabil sein.
4.1.3. Niederschwellige Nachsorge
Nach Grabbe [10] stellt sich die Frage, WER den Therapieerfolg zu definieren hätte und WAS unter einem Erfolg zu verstehen sei: Ist lediglich das Erreichen der Symptomfreiheit, also die Abstinenz, als Erfolg zu werten, oder wäre bereits ein besserer Umgang mit den Symptomen schon ein Therapieerfolg? - Immerhin gibt Trüg [41] an, daß bei ca. einem Drittel der Patienten dauerhafte Alkoholabstinenz nicht zu erreichen ist.
Gerade bei dieser Patientengruppe scheint die im Zuge einer niederschwelligen Nachsorge erreichbare Harm-Reduktion indiziert zu sein.
4.1.3.1. HARM-REDUKTION
Harm-Reduktion ist ein Begriff, der erst in den 80er Jahren populär geworden ist und soviel bedeutet wie Schadensbegrenzung bzw. Schadensminderung[33], d.h. die Klienten werden dort abgeholt, wo sie im Moment stehen und das ohne Abstinenzverpflichtung.
Man geht davon aus, daß nicht alle Suchtkranken für das Abstinenzprinzip zu begeistern bzw. die Klienten einfach nicht in der Lage sind, ohne ihr Suchtmittel zu leben[42]. Nicht jeder Suchtkranke kann allein durch den täglichen Sieg über die Sucht ein positives Selbstwertgefühl entwickeln. Bei manchen bedeutet "Trockenheit", ständig die Tage zu zählen, die sie bereits abstinent verbracht haben. Wenn man von einem dieser Patienten hört, daß er etwa 256 Tage bereits nichts Alkoholisches getrunken hat, kann man sich sein hartes Los vorstellen, zählen im Leben doch meistens nur die unangenehmen Tage.
Auch können die ständigen Versuchungen, dem Gift zu widerstehen, oft nicht fruchten, weil viele Alkoholabhängige Sinnesgenüssen (aller Art) ohne Alkohol überhaupt nicht aufgeschlossen sind. Es kommt dazu, daß diese Personengruppe von jeglicher sozialer Kommunikation abgeschnitten ist, sich abkapselt, um gegen jegliche Versuchung, Alkohol zu konsumieren, geschützt zu sein.
Oftmals kommt es bei der Nüchternheit auch dazu, daß sich Unmut, Unzufriedenheit oder gar Dysphorie breit machen, und die Patienten erfahren von Kollegen, Angehörigen und ihrer Umwelt, daß sie mit dem Nüchtern- sein einfach unausstehlich geworden sind. Eine realistischen Betreuung - eben der niederschwelligen Nachsorge - muß es daher auch schon genügen, dieser Personengruppe primär ein menschenwürdiges Überleben zu ermöglichen und zu sichern.
Dazu können grundlegende existenzsichernde Entgiftungen gehören, wobei kein Anspruch auf Langzeittherapie gestellt wird. Viele dieser chronischen Alkoholkranken können sich - falls sie ehrlich sind - ein "trockenes" Leben gar nicht mehr vorstellen. Meist betrifft dies jene Patientengruppe, welche bereits erhebliche hirnorganische Schädigungen haben (bis zum Korsakow Syndrom), ebenso Personen mit geringem Veränderungspotential.
Ziel der Harm-Reduction ist die Aufklärung über die Auswirkungen der schädigenden Substanz und auch die Erreichung eines großen Klientels.
Die Grundannahme der Harm-Reduction beinhaltet, dass Suchtfreiheit nicht für alle erreichbar ist, dass eine kontrollierte, sozial verträgliche Sucht unter geeigneten Umständen möglich ist und dass negative Suchtfolgen nicht nur substanzbedingt sind. Fazit: Das Hauptziel ist eine Minimalisierung der durch Sucht erzeugten Probleme betreffend Soziales, Psyche und Gesundheit.
Extramural existieren Wohnheime, Wohngemeinschaften und Einzelbetreuungen, die konzeptuell darauf eingestellt sind, daß die Betroffenen zeitweilig rückfällig werden, ohne daß es dabei zu disziplinarischen Folgen für den Betreffenden kommt.
Das soll natürlich nicht heißen, daß dieser Personenkreis auf keinen Fall dazu motiviert wird, einen Rückfall ordentlich "auswachsen" zu lassen, sondern der Alkoholiker muß immer wieder auf diverse Hilfsangebote hingewiesen werden, und daß er diese ruhig annehmen kann.
Ein niedrigschwelliges Angebot beinhaltet sozusagen eine zeitlich befristete Auszeit, damit sich der zu betreuende Klient gesundheitlich stabilisieren und sozial orientieren kann. Versucht wird, die "trockene Zeit" des Patienten positiv zu verstärken, ihn in seiner Handlungskompetenz zu unterstützen und zu ihm im Laufe der Zeit ein Vertrauensverhältnis zu schaffen.
In der Praxis heißt das, dem Klienten helfen, seine Dokumente in Ordnung zu bringen/halten, ihn zu Verhandlungen bei Gericht zu begleiten, Regelung von finanziellen Dingen, Tips für Einstellungsgespräche, kognitives und soziales Kompetenztraining etc. Gemeinsam wird gekocht, geputzt, der Abend gestaltet. Auch gemeinsame Unternehmungen sind durchaus in der Betreuertätigkeit enthalten. Dabei wird darauf hingearbeitet, das Selbstvertrauen des Patienten auf Vordermann zu bringen. So kann sich beispielsweise eine Betreuerin von ihrem männlichen Patienten ruhig die Geheimnisse des Tischfußballs beibringen lassen. Wenn die Betreuer bereit sind zu lernen, fällt es auch den Patienten leichter, Tips von ihnen anzunehmen.
Viele von ihnen haben erlebt, daß sie von keiner großen Bedeutung sind, nichts leisten und eigentlich zum "menschlichen Müll" gehören.
Von Bedeutung in der niederschwelligen Tätigkeit ist natürlich auch die Ordnung, die Disziplin sowie die Zielhierarchie für die Behandlung von Alkoholmißbrauch und Alkoholabhängigkeit [22]:
Lebensgestaltung,
-bewältigung
in Zufriedenheit
Verlängerung der alkoholfreien
Perioden
Dauerhafte Abstinenz
Reduzierung d. Trinkmenge
u.d.Trinkexzesse
Sicherung des möglichst
gesunden Überlebens
Sicherung des Überlebens
bedenken, daß dauerhafte Abstinenz und zufriedene Lebensführung zu den Zielen gehören, die für eine nicht unerhebliche Reiche mehrfach geschädigter, chronischer Alkoholabhängiger äußerst unrealistisch sind.
4.2. KOSTEN- NUTZEN-ANALYSE DER NACHSORGE
Nach Holder et al.[16] lassen sich folgende Ergebnisse einer frühen Intervention zusammenfassen:
1.Unbehandelte Alkoholiker verursachen doppelt so hohe Kosten im Gesundheitssystem wie Vergleichsgruppen gleichen Alters und Geschlechts.
2. Jahre nach einer Behandlung kommt es zu einer Kostenreduzierung unterhalb des Ausgangsniveaus der Ausgangskosten des Patienten.
3. Männliche und weibliche Alkoholiker unterscheiden sich dabei nicht.
4. Der Nutzeffekt ist um so günstiger, je jünger der Patient ist und unterstreicht die Wichtigkeit der Ergebnisse.
5. AUFTRETENDE PROBLEMATIK WÄHREND UND NACH DER STATIONÄREN THERAPIE
5.1. ABWEHRMECHANISMEN
Ein Alkoholiker muß speziell bei einer langjährigen Trinkerkarriere bestimmte Abwehrmechanismen aufzeigen, wobei Verleugnung, Projektion und Rationalisierung im Vordergrund stehen[3].
Eine Strategie der Täuschung, ist das Lügen. Es hilft dem Abhängigen sich oberflächlich von seinen Schuldgefühlen, die gegenüber sich selbst und seinem Umfeld hat, zu befreien, d.h. der Alkoholabhängige schafft sich so die Grundlage zum Weitertrinken. Zu Beginn äußert sich das Verhalten im Verstecken von Alkoholika an den unmöglichsten Plätzen, weiters auch das Verstecken von leeren Flaschen.
Da mit dem Fortschreiten der Suchterkrankung auch die Konzentration bzw. Einengung auf das Suchtmittel breitmacht, ist der Betroffene gezwungen, immer neue Ausreden/Lügen zu erfinden, was zur Folge hat, daß er sich in einem Lügenlabyrinth befindet und selbst nicht mehr unterscheiden kann, was erfunden und was Realität ist.
Die Verleugnung ist eine wichtige Abwehrmethode, eigentlich die Abwehrmethode schlechthin beim Trinker, nicht nur während der Trinkphasen, sondern auch in der abstinenten Zeit. Das ICH des Alkoholikers verteidigt sich dabei gegen die reale Außenwelt, womit Realangst und Realunlust besser vermieden werden können. Verleugnung erleichtert es dem Patienten, mit seinen Lebensproblemen besser fertig werden zu können, seine Ängste besser zu kaschieren und am Beginn der Rehabilitation überhaupt mit dem Trinken aufzuhören.
Bei der Therapie gestaltet sich schwierig, daß dem Patienten ein In-Frage-Stellen dieses Mechanismus Angst hervorrufen wird. Eine langsame Reduktion der Verleugnung und eine Selbsterkenntnis nebst Eigenverantwortung ist wohl eine der schwierigsten Aufgaben des Therapeuten. Unterstützend wirkt sich hierbei die Gruppentherapie aus (siehe Punkt 4.7.). Beispiel: "Mein tatsächliches Problem ist die Schlaflosigkeit"
"Ich habe keine Probleme mit dem Alkohol"
"Ich kann jederzeit mit dem Trinken aufhören."
Bei der Projektion handelt es sich um Vorgänge, durch die Qualitäten, Gefühle, Wünsche und Objekte, die abgelehnt werden, in eine andere Person oder Sache lokalisiert werden, d.h. Verhaltensweisen, Eigenschaften, Gefühle etc. welche der Alkoholiker für sich nicht akzeptieren kann, wird von ihm in einzelne Personen, in kollektive Institutionen, Gesellschaft, Staat oder Kirche projiziert. Das erlaubt dem Alkoholkranken, ein negatives Verhalten, Fühlen und Erleben schuldfreier zu ertragen, keine Verantwortung dafür zu übernehmen, sondern anderen die Verantwortung aufs Auge zu drücken. Dadurch entsteht die illusionäre Verkennung der Realität einerseits, zum anderen entwickelt sich oft eine Vorwurfshaltung mit Kontaktverlust und auch zunehmender Isolation.
Beispiel "Ich trinke nicht viel, das tun die anderen" "Nicht ich bin kaputt, sondern die Gesellschaft."
WALLACE bezeichnet diese Abwehrhaltung beim Alkoholiker als "assimilierende Projektion", d.h. er ist sehr wohl in der Lage, Ähnlichkeiten zwischen seiner Person und anderen Alkoholkranken zu erkennen. Dieses Geschehen ist beim Gruppenprozeß (therapeutische Gemeinschaft) bedeutsam, denn damit sind soziale Fähigkeiten verknüpft, welche eine spätere Integration im gesellschaftlichen Bereich ermöglicht.
Bei der Rationalisierung konstruiert der Abhängige Begründungen, um sein Trinkverhalten als richtig und vernünftig akzeptieren zu können und nicht nur, um sein Umfeld zu täuschen. Diverse Pseudobegründungen werden vom Alkoholiker oft erst im Rahmen des therapeutischen Prozesses als solche erkannt.
Beispiel "Ich kann jederzeit mit dem Trinken aufhören, aber wegen der seelischen Belastung wollte ich nicht".
"Der Arzt hat gesagt, daß Bier gut ist für die Nieren".
Bei der Regression handelt es sich um einen Teilrückzug, um einen Rückfall in eine frühere, bereits überwundene psychische Entwicklungsstufe. An Stelle des Denkens findet sich oft Anschauung, an Stelle des Handelns finden sich Phantasien und Wunschträume. Bereits im Rauschzustand erfolgt eine Regression. Das logisch rationale Denken tritt auf Kosten eines mehr emotional gesteuerten zurück. Triebenergien werden sofort entladen, was oft auch nur in der Phantasie stattfindet.
Mit dem Fortschreiten der Krankheit erfolgt eine zunehmende Traumatisierung des Selbstwerts. Durch Kompensation und Abwehrmechanismen muß die Energie des Süchtigen sozusagen verlagert werden. Er hat keinen Kräfteaufwand mehr für Realitätsprüfung und realitätsbezogenes handeln, da seine Substanz nur für das Abwehrsystem verbraucht wird.
Das Splitting (Spalten) tritt bei diesem Klientel häufig auf, während es in anderen Bereichen der Medizin ein eher ungewöhnliches Verhalten ist. Ein vermeidliches Konkurrenzgefühl und ein bestimmtes Bedürfnis, seine eigene Kompetenz zu unterstreichen oder seinem eigenen Helfersyndrom zu frönen, führt oft zur Abwertung anderer in diesem Bereich tätigen Kollegen. Von Seiten des Patienten wird dieses Verhalten schnell erkannt und in Anlehnung an seine ihm bereits bekannten Mechanismen zum eigenen Vorteil genutzt.
Das "Alles oder Nichts"-Prinzip ist eine spezielle Form der Abwehr beim Süchtigen. Der Süchtige ist nicht in der Lage, reale Unlust und Angst langfristig auszuhalten - er ist in der Regel damit beschäftigt gegen Triebansprüche und Über- ICH Forderungen anzukämpfen. Trotzdem hat gerade der Alkoholiker auch noch nach längerdauernder Abstinenz seine Vorliebe für ein strukturiertes und durchorganisiertes Milieu beibehalten, was nicht heißen soll, daß diese Form der Abwehr gefördert werden darf.
Durch Ablehnung und Moralisierung beim therapeutischen Personal wird die Abwehr vom Patienten noch verstärkt und aktiviert. Damit kann es weder zu einer Vertrauensbasis, einem therapeutischen Bezug, geschweige denn zu einer erfolgreichen Behandlung kommen.
Krisen treten nicht nur am Beginn der Entwöhnung auf, sondern holen den Patienten auch noch lange danach ein. Spätkrisen treten je nach Autor durchschnittlich in der sechsten bis neunten Abstinenzwoche (Scholz 1986), im siebten bis neunten Monat auf, verstärkt offensichtlich nach einem Jahr, also am Beginn des zweiten Abstinenzjahres.
Gekennzeichnet durch Dysphorie, vermehrte Unruhe, Reizbarkeit, Craving, Schlafstörungen und auch eventuell auftretenden neurologischen Störungen, wobei die Dauer zwischen einigen Stunden und wenigen Tagen beschrieben wird. Diese Krisen sind insofern auch mit erhöhtem Augenmerk zu erfassen, da das Rückfallrisiko in dieser Zeit besonders hoch ist.
Durch das überfallsartige und unerwartete Auftreten der Krisen ist der Patient damit überfordert, er hat auch eigentlich nicht mehr damit gerechnet, weil er sich subjektiv bereits stabilisiert fühlte. Weiters kann die Krise auch dazu führen, daß der Patient resigniert und gerade zur neuerlichen Stabilisierung wiederum zum Alkohol greift.
Neben den Verlusten der Partnerschaft und Arbeit entsteht auch häufig eine soziale Isolation.
Diese wird einerseits erheblich durch die finanzielle Verschuldung des Betroffenen beeinflußt, andererseits aber auch durch das Vermeidungsverhalten: Gasthäuser zur Kontaktaufrechterhaltung bzw. Kontaktknüpfung, diverse Einladungen werden aufgrund von eventuellen Alkoholangeboten abgelehnt, ebenso wie Konzerte etc. Der Klient wird auch "draußen" ständig an seine Sucht erinnert, sei es durch die Supermarktregale, welche dem Betroffenen mit Spirituosen, Wein und Bier zwangsläufig beim Einkaufen quasi im Weg stehen, durch die Werbung, die Alkoholika anpreist ("Heute ein König...) oder auch durch frühere Kontakte zu "Saufkumpanen", die sich bei einem - und sei es noch so ein zufälliges - Treffen stets bemühen werden, dem Gegenüber zu vermitteln, daß ein Bier ja nicht schaden könne.
Hier erscheint es wichtig, daß der Patient nicht mit Panik, Angst und Aggression reagiert, sondern schon im Vorfeld mit dem Betreuer übt, wie er am besten mit solchen Verführungsstrategien umgehen kann.
Weiters besteht meistens auch ein Defizit beim Selbstwertgefühl - "Loch im ICH". Goertz (1972) _36_ hat eine Reihe von Untersuchungen zur Persönlichkeit des Alkoholikers ausgewertet, in denen immer wieder die ICH-Schwäche und mangelnde Frustrationstoleranz der Süchtigen hervorgehoben wird. Der Selbstheilungscharakter der Droge für ein in seiner Struktur geschwächtes ICH ist somit die zentrale Aussage der Ich-psychologischen Theorie über die Bedeutung der Sucht. Die Droge wird eingesetzt, um Funktionen, die das ICH des Süchtigen aus sich heraus nicht wahrnehmen kann, zu ersetzten bzw. um die in der Struktur vorhandenen Lücken zu überdecken _36_.
Jede Form von ICH-stärkenden Maßnahmen wirken rückfallprotektiv, alles was verletzt und wehtut und das ICH schwächt, ist gefährlich. Das Suchtmittel soll kein Vakuum mehr ausfüllen, keinen Defekt überbrücken, welcher als Mangel empfunden wird. Die Aufgabe des Therapeuten liegt nun unter anderem darin, eine andere Form der Lösungsstrategien von Problemen des Lebens unter Aufarbeitung der geschwächten ICH- Funktionen zu ersetzen.
Der Therapeut steht sozusagen als Hilfs- ICH zur Verfügung. Als Therapiethema soll der Patient lernen einzubringen und zu verbalisieren, was ihn vorherrschend bewegt, belastet, behindert und ängstigt.
Dadurch wird nach Heigl- Evers (1977) folgendes erreicht:[36]
* Der Therapeut regt den Patienten dazu an, mit seiner Hilfe die ihm mißliebigen, sonst verleugneten oder externalisierten Aspekte seines Erlebens anzunehmen und ernst zu nehmen.
* Der Therapeut macht dadurch deutlich, im Gegensatz zur üblichen Umwelt, daß die betreffenden Affekte nicht so gefährlich sind.
* Der Therapeut bietet ein Modell des Umgangs mit unlustvollen Affekten an.
* Er biete sich als benignes Objekt an, das unlustvolle Affekte mit interessierter, freundlicher Zugewandtheit beantwortet.
Bei allen Süchtigen besteht die Gefahr des Umstieges auf andere Substanzen. Alkoholiker steigen häufig aus Leichtsinn oder Unkenntnis auf Beruhigungs- bzw. Schlafmittel um. Es gibt allerdings auch eine "Suchtverschiebung" im positiven Sinne z.b. Sport...
5.2. DER RÜCKFALL
Ein Rückfall ist ein erneutes Trinken von Alkohol nach einer absichtlich eingehaltenen Phase der Abstinenz. Er wird als häufigstes Kriterium
(in Fachabteilungen und in der Fachliteratur) für das Gelingen oder Scheitern einer Therapie angesehen.
Disziplinarische Entlassungen von der Station bei Rückfall sieht Rost [36] in Anlehnung an Heigl-Evers als Schutz für das Betreuerteam, um sich vor eigenen Gefühlen, Kränkungen und Enttäuschungen und von der Beraubung ihrer therapeutischen Potenz zu schützen. Ereignisse wie Rückfälle führen jedem Betreuer die Grenzen vor Augen, da wir eben nicht omnipotent und omnipräsent sind.
Der Rückfall beginnt im Kopf. Es ist ein "Zurückfallen" in das alte Suchtmuster. Nach neuesten Erkenntnissen hat mehr als die Hälfte der Alkoholiker in den ersten vier Jahren nach einer Entzugstherapie die Erfahrung mit einem Rückfall gemacht. Interessant dabei scheint, daß stationär therapierte Frauen leichter rückfällig zu werden scheinen als Männer[22].
5.2.1. Zur Unterscheidung gibt es
Schwere Rückfälle, d.h. es bleibt nicht bei einem Glas. Der Rückfällige trinkt mehr, als vor seiner Therapie; es scheint als müsse er einiges aufholen. Es kommt zu morgendlichem Trinken etc., aber auch zum Zittern, zu Schweißausbrüchen, zu Schlafstörungen. Zu einem schweren Rückfall kommt es meist dann, wenn der Betroffene mit einer schwierigen Lebenssituation konfrontiert wird, mit einer Trennung und ähnlichem[22].
Zusätzlich treten meist auch familiäre Schwierigkeiten auf, bzw. solche im Freundeskreis und am Arbeitsplatz, sofern einer vorhanden ist.
Der kurzzeitige Rückfall, d.h. ein Ausrutscher, liegt dann vor, wenn es bei einem Anfangsstadium bleibt. Er ist kurzzeitig, einmalig und begrenzt. Dem ersten Glas folgt kein unbändiges Verlangen, keine maßlose Gier nach mehr Alkohol; es kommt zu keinem Rausch und zu keinen Entzugserscheinungen.
Weiters gibt es fließende Übergänge zwischen mäßigem oder episodischem Trinken ohne Kontrollverlust und schwerer Rückfälligkeit. Einige Alkoholabhängige beginnen bereits kurze Zeit nach der Entgiftung bzw. der Therapie erneut zu trinken, diesmal jedoch mit größeren zeitlichen Abständen und in geringerer Dosis. Dieses Trinkverhalten kann zum Teil über Monate hinweg ohne gravierende Folgen bleiben.
Der systemische Rückfall macht darauf aufmerksam, daß das Trinkverhalten nicht zuletzt durch das Fehlen der sozialen Beziehungen beeinflußt wird, daß es meistens nicht ausreicht, den Alkohol einfach wegzulassen. Ohne ein Minimum an sozialem Netz empfinden diese Personen das Leben als "leer und ausgetrocknet".
Sie klagen und sagen dann auch: "Was soll ich den ganzen Tag tun, saufen ist das einzige, was mir Spaß macht".
Das kontrollierte Trinken liegt dann vor, wenn jemand mäßig und nach einem festen Trinkplan Alkohol zu sich nimmt, d.h. z.b. jeden Samstag zwei Gläser Rotwein beim Stammtisch. Gefährlich ist dabei die Selbstüberschätzung. Der Alkoholiker zweifelt daran, überhaupt süchtig zu sein, glaubt sein Trinkverhalten wie ein "Normaler" steuern zu können.
In die Rückfallkategorie gehört auch der sogenannte "trockene Rückfall". Dabei verhält sich der Abhängige wie zu seiner Saufzeit: er ist unruhig, großspurig, ungeduldig, rechthaberisch. Die Gefahr, eines echten Rückfalles ist groß.
Hierher gehört auch die Suchtverschiebung, d.h. der Wechsel zu einer anderen Sucht. Ein Alkoholiker greift beispielsweise statt zu Alkohol zu Medikamenten, eventuell auch zu einer nicht- substanzgebundenen Sucht (z.b. Arbeit).
5.2.2. BEGÜNSTIGENDE FAKTOREN BEIM RÜCKFALL
Unangenehme Gefühle, wie depressive Verstimmungen, Ängste, Gereiztheit, niedrige Frustrationstoleranz, Stimmungsschwankungen, Gefühle der Leere und Sinnlosigkeit ("ich spüre mich nicht"), Schuldgefühle (besonders vor und nach dem "ersten Schluck": sie gelten als Gefahrenquelle Nr. 1).
Soziale Bedingungen, wie dauerhafte Spannungszustände in der Familie bzw. in Beziehungen; weiters eine durch Co-Abhängigkeit geprägte Familienstruktur oder eine sozial- isolierte Lebensweise. Situative Faktoren, wie Trinkaufforderungen ("sei doch kein Frosch"), diverse Feiern und Feste mit hohem Alkoholangebot und - konsum innerhalb der Familie. Ein Lebensstil, der mit Überforderung (zuviel Arbeit mit gleichzeitig wenig Ausgleich und wenig Entspannung) einhergeht. Entspannung durch Alkohol bei innerer Spannung. Einschneidende Lebensereignisse - sogenannte life-events, wie Tod, Trennung, Geburt, Hochzeit etc., beruflicher Aufstieg (mehr Verantwortung), Umzug etc. Ständige Über-, aber auch Unterforderung (STRESS) z.b. bei der Arbeit, Arbeitslosigkeit. Wohnungslosigkeit, finanzielle Problematik etc. können für den Verlust der Abstinenz verantwortlich gemacht werden.
Sekundärer Krankheitsgewinn oder ein Zurückwollen in die Therapieeinrichtung ("Dort waren alle so nett zu mir").
Fehlende oder unzureichende Bewältigungsstrategien, was dann zum Verhängnis werden kann, wenn man sich in Situationen befindet, in denen Alkohol angeboten wird oder wenn man mit einem kritischen Lebensereignis konfrontiert wird.
Unzureichende soziale Kompetenzen oder Bewältigungsfertigkeiten (coping- Strategien) zeigen sich beispielsweise daran, daß jemand zu anderen Menschen keine befriedigenden Kontakte aufnehmen und aufrechterhalten kann, belastende Stimmungszustände nicht aushält oder es ihm nicht möglich ist, sich gegenüber anderen abzugrenzen (nicht "nein" sagen können).
Die Überzeugung, daß man kontrolliert trinken kann, daß man in Versuchungssituationen nicht widerstehen kann, die Erwartung, durch den Alkohol den eigenen Gemütszustand positiv verbessern bzw. beeinflussen zu können, alle diese "eingefleischten" Gedanken bezüglich des Alkohols können zu sog. "Rückfallbahnern" werden. Rückfall in "alte" Trinkgewohnheiten, speziell bei jahrelangem Alkoholkonsum, durch Unachtsamkeit oder auch durch "Vergessen" der Sucht.
Anhaltende unangenehme körperliche Zustände, etwa Schmerzen, die dazu führen können, daß erneut Alkohol getrunken wird, um sich Linderung zu verschaffen.
Unzureichende Alkoholentzugsbehandlung, die "falsche" Entzugsstation, vorzeitige Entlassung. Eine Krisensituation während (und nach der Therapie können im Einzelfall ebenfalls den Rückfall Hintergrund darstellen ("Ich werde es euch zeigen"=> Therapeut, Bezugsperson).
Craving, also die Gier der Suchthunger oder Suchttrieb, wird häufig als Rückfallursache angeführt. Der Rückfall ist krankheitsimmanent und bedeutet keineswegs die große Katastrophe. Unter Umständen bedeutet er Veränderung, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Er ist eine Aktion, welche eine Re-Aktion erfordert und muß auf jeden Fall ernstgenommen werden.
Es ist wichtig, den Rückfall zu thematisieren, die Ursache zu eruieren, ihn zu behandeln.
Ein Rückfall bedeutet Chance!
5.2.3. EINFLUSSFAKTOREN BEIM Rückfall von seiten des Betreuers
Vale (1981)[22] ermittelte zur Beantwortung der Fragestellung "Gibt es Therapeutenmerkmale, die sich positiv oder negativ auf die Vorbeugung von Rückfällen auswirken?" die Ausprägung der Therapeutenmerkmale
Empathie, Echtheit, positive Wertschätzung des Patienten und Konkretheit im Gesprächsverhalten bei acht abhängigen und seit mindestens 4 Jahren "trockenen" Suchttherapeuten.
Die Therapeutenmerkmale wurden mit der Rückfälligkeit der Expatienten über einen Zeitraum von zwei Jahren nach deren Entlassung aus der stationären Behandlung (durchschnittliche Dauer: 12 Tage) in Beziehung gesetzt. Die Ergebnisse waren alle einheitlich: je stärker der Therapeut diese in der klientenzentrierten Gesprächspsychotherapie als hilfreich nachgewiesenen Beziehungsvariablen realisierte, desto geringer war die Rückfallrate über alle ehemaligen Patienten, die Anzahl von Rückfällen pro Expatient und der Alkoholkonsum in den zwei Jahren nach der Behandlung.
Da jedoch diese Ergebnisse bis zum heutigen Tag nicht durch andere Studien verglichen und abgesichert werden konnten, können diese Auswertungen nicht verallgemeinert werden. Außerdem darf man nicht außer acht lassen, daß nicht abhängige Betreuer von Alkoholkranken als ebenso empathisch wahrgenommen werden wie beratende abstinente Alkoholiker (Kirk et al. 1986)[23].
Auch Beziehungsmuster zwischen Patient und Therapeut werden diskutiert neben den einzelne Therapeuteneigenschaften. Rost (1987)[23] geht im psychoanalytischen Ansatz davon aus, daß bei einem Rückfall eine Störung der Patent- Therapeutenbeziehung zugrunde liegt, d.h. eine Dynamik von Übertragung und Gegenübertragung.
Ohne Zweifel stellen Rückfälle auch oft Streß für den Betreuer dar, wie z.b. bei der coalkoholischen Reaktion, wo der Rückfällige einsichtige Ursachen für sein Fehlverhalten vorbringt.
Die Mitpatienten können sich damit identifizieren, wodurch es zur coabhängigen Reaktion kommt. ("Was hätte er denn sonst tun sollen außer saufen ?"). Falls der Therapeut die Verharmlosungen und Verleugnungen der Gruppe transparent macht, stellen sich häufig Splittingmechanismen ein, d.h. der Therapeut wird zum Feindbild, bekommt eine Abwertung und Vorwürfe von der Gruppe, der Rückfällige wird zum Guten.
Falls der Rückfällige keinen "besonderen Grund" für sein neuerliches Trinken angeben kann, kommt es häufig zu bissigen, latent oder offen aggressiven Reaktionen von seiten der anderen Gruppenmitglieder. Andererseits kann es auch zur bedrückten Reaktionen kommen. Sie entstehen meist dann, wenn der Patient ein Alpha-Typ ist bzw. hohes Ansehen genießt. In der Gruppe wird dann nicht aktiv mitgearbeitet, sondern beharrlich geschwiegen, wahrscheinlich werden eigene Ängste aktiviert, und Hilflosigkeit wird sehr eindringlich erlebt.
Aufgabe des Therapeuten ist es, den Rückfall zu rekonstruieren, transparent zu machen: mit der Gruppe zu erarbeiten, daß der Rückfall Ausdruck eines für den Rückfälligen typischen Verhaltensmusters/Konfliktes/Bewältigungsunmöglichkeit ist. Eventuell kann auch noch die Rückfallprophylaxe in der noch verbleibenden Zeit besprochen werden, falls nicht, sollte es auf jeden Fall in den nächsten Gruppensitzungen erfolgen.
Es kann in der Zwischenzeit als gesichert gelten, daß weniger Rückfälle nach einer stationären Therapie zu verzeichnen sind, wenn die Auseinandersetzung mit der eigenen Problematik nicht abrupt mit Beendigung des stationären Aufenthaltes einhergeht. Nachsorge hat sich als lebensbegleitende Unterstützung erwiesen, insbesondere in Kombination mit einer Selbsthilfegruppe.
5.3. ÜBERTRAGUNG
Alkoholabhängige neigen in ausgeprägter Weise dazu, innere Haltungen und Vorstellungen auf andere Menschen zu übertragen, die jedoch nicht diesen, sondern anderen Personen gelten. Es handelt sich dabei meist um solche Vorstellungen, die in früher Kindheitsentwicklung auf wichtige Bezugspersonen gerichtet wurden. Aus der Übertragung können sich spezifische Konflikte ergeben, da sich die ursprünglichen, kindlichen Verhaltensmuster mit den Forderungen der Erwachsenenwelt nicht mehr vereinbaren lassen.
Bereits im Erstkontakt zeigt sich oft ein wichtiges Übertragungsangebot und in der Reaktion des Betreuers die entsprechende Gegenübertragungsbereitschaft. Nach Blane (1977)[22] "werden Übertragungs- und Gegenübertragungsprozesse nirgends deutlicher als in der Behandlung alkoholischer Klienten; klinisch Tätige müssen sich über Training, Supervision und Sammeln von Erfahrung dessen bewußt werden, wie ihre emotionalen Reaktionen - wenn unkontrolliert - in fataler Weise mit der Dynamik des Alkoholikers interagieren können"
In Anlehnung an Antons _36_ gibt es charakteristische Muster von Übertragungsangeboten des Patienten: der Patient bagatellisiert, verleugnet sein Symptom, verbirgt sich und weicht aus, er projiziert die "Schuld" auf seine Umwelt, daß er sich verkannt, verfolgt und mißverstanden fühlt, er verhält sich ohnmächtig, Selbstmitleid erregend, oder er stellt sein Größenselbst dar, oder mitunter scheinangepasst und als "erfolgreicher" Patient.
Viele Patienten erleben die Tatsache, daß sie therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, mit Scham. Das kann dazu führen, daß sie Barrieren gegen die Helfer aufbauen, die die Arbeit behindern. Alles, was sich dem Fortschritt in der Behandlung entgegenstellt, wird in der Therapie als Widerstand bezeichnet. Das kann auch einmal die Übertragung sein, wie z.b. dann, wenn der Patient sich in einen Helfer verliebt und deshalb nicht mehr engagiert mitarbeitet.
Therapeutisch sollte die Übertragung angesprochen werden, da es gilt, die unter Umständen unbewußten Widerstände zu klären, die sich dem erfolgreichen Vorankommen der Therapie in den Weg stellen.
Die Patienten halten zunächst auch deshalb an ihrer Sucht fest, weil sie keine Alternative haben und ihnen die Ursache ihres Leidens nicht bekannt ist.
Der Wiederbelebung, der oft schmerzlichen Erinnerungen, die mit der Entstehungsgeschichte des süchtigen Verhaltens verbunden sind, setzen die Patienten verständlicherweise einen verstärkten Widerstand entgegen. Um sich nicht erinnern und das Geschehene noch einmal in der Therapie durcharbeiten zu müssen, neigen Süchtige zum Agieren, das heißt sie handeln aus unbewußter Motivation, anstatt intrapsychische Vorgänge zu reflektieren.
Die Übertragung hat ihre Entsprechung auf seiten des Therapeuten als Gegenübertragung, womit die Gesamtheit der bewußten und unbewußten Reaktionen des Behandlers auf den Patienten gemeint sind.
Typische unkontrollierte Gegenübertragungsformen sind seitens des Betreuers folgende:
- der Betreuer läßt sich täuschen, er solidarisiert sich und identifiziert sich mit dem Patienten
- der Betreuer reagiert im Sinne eines Helfersyndroms
- er mobilisiert nicht die Verantwortung des Klienten, sondern beläßt ihn unmündig und unverantwortlich
- der Betreuer quittiert die Angepasstheit des Patienten belobigend und gerät so in eine Übersolidarisierung
Die Abwehr des Patienten wird durch Ablehnung und Moralisierung der Betreuer noch verstärkt und aktiviert. Die Folge davon ist, daß kein Bezug aufgebaut werden kann, wodurch eine erfolgreiche Behandlung auch nicht gewährleistet ist.
Fazit: therapeutischer Nihilismus, Moralisierung und strafende Einstellung sind beim Personal absolut Kontraindiziert.
5.4. Coabhängigkeit
Beinahe jeder Suchtkranke hat mindestens einen Menschen in seiner unmittelbaren Umgebung, der coabhängig ist. Als coabhängig bezeichnet man Menschen, die in enger Beziehung zum Suchtkranken stehen, die durch ihr Helfersyndrom und ihr daraus entstehendes Verhalten keine Lösung aus dem Suchtmechanismus bewirken, sondern eine Verfestigung suchterzeugenden Verhaltens.
Das zentrale Kennzeichen der Coabhängigkeit ist die Abhängigkeit von der Abhängigkeit eines nahen Menschen[31]. Der Süchtige gibt dem Cosüchtigen einige Sicherheit: der Süchtige ist nicht selbständig und wird aus diesem Grund immer auf die verläßliche Hilfe des Coabhängigen zurückgreifen.
Dadurch, daß es dem Suchtkranken um so vieles schlechter geht, er eindeutig Probleme hat, er sich verläßlich so benimmt, daß er sozial wenig geschätzt wird, gibt er paradoxerweise auch Sicherheit.
Das eigene Ego wird durch das schwache Ego des anderen gestärkt. Es ist höchst unwahrscheinlich, daß sich ein Suchtkranker aus der Beziehung zum Coabhängigen lösen wird (und umgekehrt). So entsteht ein sich selbsterhaltender Prozeß, der nur dann zu durchbrechen ist, wenn eine Person aus dem System ausscheidet[31].
5.4.1. KENNZEICHEN DER COABHÄNGIGKEIT
Schwierigkeiten, die eigene Realität und die Realität der Suchtsituation angemessen zu erfahren und zu erkennen => die Sucht wird verschleiert, verdeckt und vor allem entschuldigt.
In Beziehungen werden meistens keine oder nur unscharfe Grenzen gezogen. Nicht selten sind auch Mitglieder eines suchttherapeutischen Teams coabhängig und das ohne es zu merken. Häufiger sind jedoch Familienangehörige und Partner betroffen.
Coabhängige Menschen sind meistens in ihrer Persönlichkeitsstruktur unreif und haben ein mangelndes Selbstwertgefühl. Sie sind unscharf begrenzt mit mangelnder Reflexionsfähigkeit, d.h. man könnte sie auch als sogenannte abhängige Persönlichkeiten bezeichnen. Sie befinden sich häufig in einer Beziehung, in der das Gegenüber eindeutig schwächer und noch abhängiger ist; mit dem Süchtigen jedoch können solche Gefühle am ehesten vermieden werden.
5.4.2. Einteilung der Coabhängigkeit nach Jackson
Jackson [18] teilte die Entwicklung in Alkoholikerfamilien in sieben Phasen ein, wobei diese Phasen fließend ineinander übergehen:
1. Verleugnungsphase
Der Partner fürchtet dabei die Diskriminierung und entwickelt eine Abwehr, wobei das Trinken der Umwelt gegenüber, im Speziellen Angehörigen und den Kindern gegenüber verleugnet wird. Durch die unweigerlich entstehenden Spannungen innerhalb der Familie wird nach außen nicht selten durch ein scheinbar engeres Zusammenrücken der Schein einer intakten Familie gewahrt.
2. Interventionsphase
Wenn das Problem des Trinkens überhand nimmt, wird die Familie versuchen, den Betroffenen vom übermäßigen Alkoholkonsum abzuhalten, u.a. werden ihm diverse Versprechungen abgeluchst. Natürlich kann der Kranke diese nicht einhalten, es kommt zu Vorwürfen, welche er mit vermehrtem Trinken und somit mit einer stärkeren Krankheitsentwicklung beantwortet.
3. Resignationsphase
Wenn das Problem offensichtlich wird und sich nicht mehr von der Umwelt verbergen läßt, besteht die Gefahr, daß die Familie in die soziale Isolierung kommt. Sie schottet sich ab, damit dieses Problem nicht nach außen gelangen kann. Sie erkennt, daß es ihr nicht möglich ist, den Alkoholkonsum des Kranken kontrollieren zu können und begnügt sich so mit meist kurzfristigen Zielen:" Trink wenigstens nicht, wenn meine Eltern kommen."
4. Erste Rollenwechselphase
Der Betroffene wird mit der Zeit immer unfähiger, seine Aufgaben innerhalb der Familie zu erfüllen, so daß ein anderes Familienmitglied seine Rolle übernehmen muß.
5. Fluchtphase
Bei weiterer Krankheitsentwicklung wird der Partner versuchen, durch Trennung/Scheidung dem Problem zu entkommen. Es wird des öfteren mit Scheidung/Trennung gedroht, wobei es jedoch bei der Drohung bleibt.
6. Trennungsphase
Es kommt definitiv zur Trennung/Scheidung, und die Familie reorganisiert sich ohne den Kranken.
7. Zweite Rollenwechselphase nach Abstinenz des kranken Partners
Wenn der Kranke abstinent wird, entstehen neue Konflikte, da er wieder seine "alte" Rolle beansprucht. Es wird ein neuer Rollenwechsel nötig, wobei das entstandene Mißtrauen, die Ängste und auch alte Erinnerungen erst einmal zu überwinden sind, um eine familiäre Homöostase wieder herzustellen
5.5. Suizidalität
Alkoholiker sind, ebenso wie Rauschdrogen- und Medikamentenabhängige, besonders suizidgefährdet. Der Suizid ist je nach Literaturangabe bis zu 25 mal häufiger[12] als bei der "Normalbevölkerung". Sucht scheint dabei ein protrahierter Selbstmord zu sein, bzw. ist Sucht auch ein Wegbereiter zum Suizid. Beim Alkoholiker sind drei Wege abzugrenzen[8]:
- Suizidhandlungen aus unvorhergesehenen aggressiven Impulsen, d.h. meist bei ansteigendem Blutalkoholspiegel
- Suizidhandlungen am Gefolge der alkoholentzugsbedingten Depression, dem sogenannten "Katzenjammer", d.h. meist bei sinkendem Alkoholspiegel
- Reaktionsbildungen beim Erleben des Zusammenbruchs der gesundheitlichen, sozialen und finanziellen Situation ("Bilanzselbstmord), d.h. meist im Zustand der Alkoholnüchternheit
Ebenfalls häufig bei alkoholischen Hauptdiagnosen kommt es zu Parasuiziden[42], und zwar typischerweise bei Patienten unter 45 Jahren aus der sozialen Unterschicht, häufig bei Geschiedenen.
Parasuizidale Handlungen, wie z.b. das Vergiften mit Pharmaka, sind deshalb nicht zu vernachlässigen, da sie eine hohe Rückfallsquote (20- 30% innerhalb der nächsten 12 Monate) aufweisen. Rückfallprädikatoren sind dabei eine psychiatrische Krankheitsvorgeschichte, frühe Parasuizide, Soziopathien, Probleme mit Alkohol und Drogen, soziale Unterschicht, Arbeitslosigkeit, Kriminalität. Weiters muß dazu bemerkt werden, daß das Ausmaß der vom Patienten erlittenen körperlichen Schäden nach dem Parasuizid nichts über die Wahrscheinlichkeit der weiteren Versuche aussagt.
5.6. Burn out (Ausgebrannt sein)
Idealismus und hohe Anforderungen an sich sowie die Bereitschaft, für andere Menschen da zu sein, können vom Engagement zum Überengagement (z.b. Arbeit auch in der Freizeit) führen, von der Leistungsbereitschaft zum Leistungszwang, d.h. Selbstdefinition nur über Leistung. Auf Dauer werden Anforderungen nur unter verstärktem Einsatz aller verfügbaren Kräfte erfüllt. Mehr und mehr wird von der Substanz gelebt[31].
Mit Kaffee, Nikotin, Aufputsch- und Schlafmitteln wird versucht, sich einsatzfähig zu halten. Wenn endlich geschlafen werden darf, kann das im Burnout-Teufelskreis nur noch mit Schlafpillen erreicht werden.
Gelungene Beziehungen werden selten. Diese Veränderungen werden schließlich auch von Außenstehenden wahrgenommen.
Burn-out-Klientel ist in vielfältiger Weise auffällig:
Es kommt zum Verlust von Wertschätzung und Sympathie für sich und andere. Kritisches Denken und Anteilnahme fallen Überdruß, Hoffnungslosigkeit und rein mechanischem Funktionieren zum Opfer. An der Spitze des Eisberges wird das "ICH" sozusagen aufgelöst, der Notfall macht sich breit. Die Auswirkungen können sich auf der körperlichen, der psychischen und auch der Beziehungsebene zeigen. Psychosomatische Erkrankungen im engeren Sinn, Herz-Kreislauf-Krankheiten, Sucht beim Betreuer selbst und Depressionen - sogar Suizide - kommen vor.
Ein großes Problem für den Betreuer stellt die psychische und emotionale Überforderung dar. Das psychotherapeutische Feld, in dem man tätig ist, ist stark konfliktgeladen. Suchtpatienten neigen dazu, ihre eigenen Konflikte zu projizieren und im therapeutischen Setting zu reinszenieren. Das Personal neigt dazu, sich mit den Konflikten ihrer Patienten zu identifizieren, wodurch eigene Konflikte aktiviert und aktualisiert werden.
Um in diesem traumatisierten Arbeitsfeld bestehen zu können ohne Schaden zu nehmen, hat das Personal gelernt sich mit speziellen Methoden zu schützen, wie z.b. Supervision oder Balintgruppen.
Als Therapie sollte wohl eine kritische Analyse der inneren Struktur und der äußeren Situation durchgeführt werden (was wird verlangt? Bin ich gesprächsbereit? Was erwarte ich von den anderen? Was erwarte ich von mir selbst?).
Der Rhythmus im Leben muß zwischen Arbeit und Freizeit ausgewogen sein, damit ein übermäßiger Verbrauch an Ressourcen verhindert werden kann. Stressoren, Über-, aber auch Unterforderung müssen bekämpft werden: Zeitdruck muß vermindert werden, Teamarbeit ist in den Vordergrund stellen, die Ziele sollten klar gesteckt und definiert werden.
Im Zusammenhang mit dem Burn out werden folgende Symptome beschrieben[21]:
- Minderung des Wohlbefindens
- Großer Widerstand, täglich zur Arbeit zu gehen
- Permanente Müdigkeitsgefühle
- Verstärkter Gebrauch von Suchtmitteln
- Rückzug aus berufsbedingten Kontakten
- Wachsender Zynismus
- Psychosomatische Erkrankungen
- Erhöhte Fehlzeiten
- Ehe- und Familienprobleme
LITERATURVERZEICHNIS
(1) Azrin N. H., R. W. Sisson, R. Meyers, M. Godley: Alcoholism treatment by disulfiram and community reinforcement therapy. Journal of Behavioral Research and Therapy 13, 1982, S. 105-112.
(2) Buck D.: Psychiatrischer Gr öß enwahn in Deutschland - Aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen. In: Th. Bock et al. (Hrsg.): Abschied von Babylon. Verständigungüber die Grenzen in der Psychiatrie. Bonn: Psychiatrie-Verlag 1995, S. 45-52.
(3) Burian W.: Psychotherapie des chronischen Alkoholismus. In: Schied H. W., H. Heimann, K. Mayer: Der chronische Alkoholismus. Grundlagen, Diagnostik, Therapie. Stuttgart, New York: Fischer 1989, S. 59-72.
(4) Chapman P. L. H., I. Huygens: An evaluation of three treatment programmes for alcoholism - An experimental study with 6- and 18-months follow-ups. Br J Addict 83, 1988, S. 67-81.
(5) Costello R. M.: "A lcoholism treatment effectiveness" Slicing the outcome variance pie. In: Edwards G., Grant M. (Hrsg.): Alcoholism treatment in transition. Croom Helm, London.
(6) Erikson L.: The effect of waiting for inpatient treatment after detoxification - An experimental comparison between inpatient treatment and advice only. Addict Behav 10, 1986, S. 235-248.
(7) Feuerlein W.: Aktuelle Beiträge zur Definition und Therapie der Alkoholkrankheit. In: Hackenberg K., B. Hackenberg, H. Hinterhuber (Hrsg.): Sucht und Suchttherapie. Eine klinische Standortbestimmung. München, Deisenhofen: Dustri-Verlag: 1992, S. 29-39.
(8) Feuerlein W.: Alkoholkrankheit. In: Faust V. (Hrsg.): Psychiatrie. Ein Lehrbuch für Klinik, Praxis und Beratung. Stuttgart, Jena, New York: Fischer-Verlag 1995, S. 269-283.
(9) Feuerlein W., H. Küfner, M. Soyka: "Alkoholismus-Mißbrauch und Abhängigkeit" Entstehung-Folgen-Therapie. Stuttgart: Thieme Verlag, 5. Auflage, 1998
(10) Grabbe M.: Der Zwang zum Erfolg - der Sinn des Scheiterns. Zur Therapeutenrolle in der systemischen Familientherapie. In: Heigl-Evers A., I. Helas, H. C. Vollmer (Hrsg.): Die Person des Therapeuten in der Behandlung Suchtkranker. Persönlichkeit und Prozeßqualität. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1997, S. 154- 167.
(11) Haller R., K. Kemmerling: Zur Komorbidität von psychischen Störungen und Suchterkrankungen. Universitäts-Forschungsinstitut der Leopold Franzens Universität Innsbruck für die Prophylaxe der Suchtkrankheiten mit Sitz am Krankenhaus Stiftung Maria Ebene.
(12) Haring C.: Alkoholismus - eine Krankheit wird verleugnet. In: Fleisch E., R. Haller, W. Heckmann: Suchtkrankenhilfe. Ein Lehrbuch zur Vorbeugung, Beratung und Therapie. Weinheim, Basel: Beltz-Verlag 1997, S. 43-58.
(13) Haring C., C. De Col, U. Meise: Die Versorgung Alkoholkranker in Ö sterreich. In: Meise U. (Hrsg.): Alkohol. Die Sucht Nr. 1. Innsbruck, Wien: Verlag Integrative Psychiatrie 1993, S. 197-199.
(14) Hinterhuber H.: Ermordet und Vergessen. Nationalsozialistische Verbrechen an psychisch Kranken und Behinderten. Innsbruck, Wien: Verlag Integrative Psychiatrie 1995.
(15) Hinterhuber H.: Kulturgeschichte und Rauschdrogen. Referat vom 14.11.1997 im Hochschullehrgang "Professionelles Handeln in der Beratung und Betreuung von Abhängigkeitserkrankten".
(16) Holder H., R. Lonabaugh, W. R. Miller, A.v. Rubonis: The cos effectiveness of treatment for alcoholism: a first approximation. Stud. Alcohol 52 (1991) 517- 540
(17) Institute of medicine: Broadening the Base of Treatment for Alcohol Problems. Mational Academy Press, Washington /D.C. 1990
(18) Jackson J.: The adjustment of the family to the crisis of alcoholism. In: Quart J Stud Alc 15, 1954, S. 562.
(19) Keup W.: Jahresstatistik 1983 der Fachkrankenhäuser für Suchtkranke (DOSY ´ 83) - Katamnesen. In: Ziegler H. (Hrsg.): Jahrbuch ´ 85 zur Frage der Suchtgefahren. Hamburg: Neuland-Verlagsgesellschaft 1985.
(20) Klee E. (Hrsg.): Dokumente zur "Euthanasie". Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1985.
(21) Kleiber D.: Psychosoziale Situation der Helfenden. In: Fleisch E., R. Haller, W. Heckmann (Hrsg.): Suchtkrankenhilfe. Lehrbuch zur Vorbeugung, Beratung und Therapie. Weinheim, Basel: Beltz-Verlag 1997, S.368-380.
(22) Körkel J., G. Kruse: Mit dem Rückfall leben. Abstinenz als Heilmittel? Bonn: PsychiatrieVerlag, akt. 2. Aufl. 1994.
(23) Körkel J. (Hrsg.): "Der Rückfall des Suchtkranken" Flucht in die Sucht? Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo: Springer Verlag, 1992. S. 20-47,S. 83-97
(24) Kraepelin E.: Psychiatrie. Ein Lehrbuch. 8. Aufl., Leipzig: Barth 1909.
(25) Küfner H., W. Feuerlein: In Patient Treatment for Alcoholism. A multi-centre Evaluation Study. Berlin: Springer 1989.
(26) Lazarus A.: Behaviour Therapy and Beyond. New York 1971.
(27) Mann K., G. Mundle: Die gemeindenahe Behandlung Alkoholabhängiger. Konzepte und Ergebnisse. In: Meise U. (Hrsg.): Alkohol. Die Sucht Nr. 1. Innsbruck, Wien: Verlag Integrative Psychiatrie 1993, S. 148-158.
(28) Mentzos S.: Einführung in die psychoanalytische Neurosenlehre unter Berücksichtigung neuer Perspektiven. In: Neurotische Konfliktverarbeitung. Frankfurt: Fischer Verlag, 1984
(29) Miller W. R., R. K. Hester: Inpatient alcoholism treatment - Who benefits? American Psychologist 41(7), 1986, S. 794-805.
(30) Miller W. R., R. G. Sovereign: A comparison of two styles of therapeutic confrontation. Unveröffentlichtes Manuskript. University of New Mexico 1988.
(31) Müller M. et al: "Konzept der B4 - Entwöhnungsstation für Alkohol-und Medikamentenabhängige" Aus dem Handbuch des Psychiatrischen Krankenhauses des Landes Tirol (1998/99)
(32) Müller M.:"Sucht, Abhängigkeit, Mißbrauch" Referat vom 3.4.98 auf dem Arbeitsseminar ARGE der Interessensgemeinschaft psych. Pflege Österreich.
(33) Olgiati M.: Harm Reduction. In: Fleisch E., R. Haller, W. Heckmann: Suchtkrankenhilfe. Lehrbuch zur Vorbeugung, Beratung und Therapie. Weinheim, Basel: Beltz-Verlag 1997, S. 310-326.
(34) Peiffer J.: Neuropathologische Aspekte des chronischen Alkoholismus. In: Schied H. W., H. Heimann, K. Mayer: Der chronische Alkoholismus. Grundlagen, Diagnostik, Therapie. Stuttgart, New York: Gustav Fischer Verlag 1989, S. 103-120.
(35) Rosenberg S. D.: Relaxation training and a differential assessment of alcoholism. Unveröffentlichte Dissertation (University Microfilms No. 8004362), California School of Professional Psychology, San Diego, 1979.
(36) Rost W.-D.: Psychoanalyse des Alkoholismus. Theorie, Diagnostik, Behandlung. Stuttgart: Klett-Cotta, 2. Aufl. d. Ausg. von 1992, 1994.
(37) Schied H. W., H .Heimann, K. Mayer: Der chronische Alkoholismus. GrundlagenDiagnostik-Therapie. Stuttgart, New York: Gustav Fischer Verlag, 1989
(38) Schlüter-Dupont L.: Alkoholismus-Therapie. Pathogenetische, psychodynamische, klinische und therapeutische Grundlagen. Stuttgart, New York: Schattauer 1990.
(39) Schrappe O.: Ü ber die Depravation bei Süchtigen. In: Randzonen menschlichen Verhaltens. Festschrift für Bürger-Prinz. Stuttgart: Enke-Verlag 1963.
(40) Trotter T.: An Essay, Medical, Phliosophical and Chemical, on Drunkenness and ist Effects on the Human Body. London 1804.
(410) Trüg E.: Qualitätsstandards in der stationären Drogenarbeit. Referat vom 13.06.1998 im Hochschullehrgang "Professionelles Handeln in der Beratung und Betreuung von Abhängigkeitserkrankten".
(42) Uchtenhagen A:: Prävention am Beispiel der Schweiz. Referat vom 13./14. 03.1998 im Hochschullehrgang "Professionelles Handeln in der Beratung und Betreuung von Abhängigkeitserkrankten".
(43) Widmoser H.-J.: Suizid, Parasuizid. Epidemiologie, Erkennung und Beurteilung, Prävention und Therapie. Referat vom 2.4.1998 auf dem Arbeitsseminar ARGE der Interssensgemeinschaft Psychiatrische Pflege Österreich, S. 2.
SACHREGISTER
Abhängigkeit
- erkrankung
- entwicklung
- manifeste
- mechanismus
- prozeß
- von der Abhängigkeit
Abstinenz
- erscheinungen
- orientierung
- raten
- symptome
- verpflichtung
- woche
Abwehr
- haltung
- mechanismen
- methode
- system
Aggressionen Alkohol
- Abhängigkeit
- Abstinenz
- Entzugsbehandlung
- Entzugssyndrom
- Folgeerkrankungen
- Freie Perioden
- krank
- kranke
- konsum
- konsumreduzierender Effekt
- kurzzeitbehandlung
- menge
- mißbrauch
- nüchternheit
- problematik
- pro-Kopf-Verbrauch
- schäden
- spiegel, ansteigender,sinkender
- teufel
Alles-oder-Nichts Prinzip
Alternative Verhaltensweisen Ambulante Therapie
Angehörige
Angst
Anonyme Alkoholiker Antabus
Arbeits
- platz
- stelle
- suche
Ausgebrannt sein Aversionsmethode
Azetaldehyddehydrogenase Behandlung
- ziel
Berufsgruppen Betreuer
- Aggression
- Tätigkeit
- team
Betreuungsdauer Bewältigung
Bewältigungsstrategie
Breitbandverhaltenstherapie Burn-out
- Klientel
- Symptome
Coabhängigkeit
- Kennzeichen
- nach Jackson
- Symptome
Comorbidität Compliance Coping
Craving
Daten, epidemiologische Depravation
Depressionen Disulfiram
Einflußgrößen
Entlassung Entzug
Entwöhnung
- behandlung
- phase
- station
Erlebnisfolgeerwartung Gegenübertragung
- Prozesse
Gespräche
- Einzel
- Einstellungs
- Nachsorge
- Paar
Gruppe
- dynamik
- leiter
- nicht professionelle
- professionelle
- prozeß
- sitzung
- strukturen
- therapie
Harmreduktion, harmreduction Hilfe
Hilfs-Ich
Historisches
Helfersyndrom Ich
- Entlastung
- Funktion
- Stärkung
- stärkende Maßnahmen
Kompetenztraining, soziales Kognitive Methode
Kontaktphase
Kontrollverlust
Krankheitsgewinn
- sekundärer
Krise
- situation
Life-events Lügen
Motivation
- arbeit
- hinderniss
Nachsorge
- aktivität
- angebote
- einrichtungen
- gruppe
- niederschwellige
- phase
- programm
- gruppe
Rationalisierung Reaktion
Regression
Risikofaktoren Rückfall
- bahner
- begünstigende Faktoren
- kurzzeitiger
- Risiko
- schwerer
- systemischer
- trockener
- vorbeugung
Parasuizid Phase
- Interventions
- Flucht
- Resignagtions
- Rollenwechsel
- Trennungs-
- Verleugnungs -
Projektion
Psychiatrie- Profi
Psychodrama
Reinforcing
Schadensbegrenzung
Selbst
- hilfe
- hilfegruppen
- mitleid
- mord
- wirksamkeitserwartung
Sozialarbeiterische Tätigkeiten
Soziales Kompetenztraining
Spätkrisen
Splitting
Sucht
- freiheit
- hunger
- mittel
- persönlichkeit
- trieb
- verschiebung
Suizidalität Suizid
- gefährdet
- handlungen
- para-
Supervision Symptom
Systemische Therapie
Therapeut
- merkmale Therapie
- ambulante
- Aversions
- Breitbandverhaltens-
- konzept
- profis
- stationäre
- systemische
- techniken
Trinken
- episodisches
- exzessives
- rituelles
- kontrolliertes
- konviviales
- mäßiges
- utilitarisches
Trink
- aufforderung
- verhalten
Übersolidarisierung Übertragung
- Prozesse
Veränderung
Verantwortung
Verdrängung
Verhaltenstherapie
Verleugnung
Vermeidungslernen
Verstärkungslernen
Widerstand
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema dieses Dokuments?
Dieses Dokument ist ein umfassender Überblick über Alkoholabhängigkeit, ihre Entwicklung, Behandlungskonzepte und Nachsorge. Es behandelt historische Aspekte, epidemiologische Daten, Risikofaktoren, Therapieansätze (ambulant und stationär), Rückfallprävention und auftretende Problematiken während und nach der Therapie.
Welche historischen Aspekte der Alkoholabhängigkeit werden behandelt?
Das Dokument beleuchtet die historische Wahrnehmung von Trunksucht, von einem moralischen Versagen hin zur Anerkennung als Krankheit. Es werden frühe ärztliche Erkenntnisse, moralisierende Haltungen in der Psychiatrie des 19. Jahrhunderts und die Rolle der Nationalsozialistischen Regierung Deutschlands (Zwangssterilisation, Euthanasie) thematisiert.
Welche epidemiologischen Daten zur Alkoholabhängigkeit werden genannt?
Es werden spezifische Daten für Österreich genannt, darunter der jährliche Pro-Kopf-Alkoholkonsum, der Anteil der Alkoholabhängigen und Gefährdeten in der Bevölkerung, das Lebenszeitrisiko und tägliche Trinkgewohnheiten.
Welche Einflussgrößen und Risikofaktoren für die Entwicklung von Alkoholabhängigkeit werden identifiziert?
Das Dokument listet großgesellschaftliche Faktoren (Anonymität, Arbeitslosigkeit), Grundeinstellungen zum Alkoholkonsum (rituel, konvivial, utilitaristisch), traditionelle Trinksitten, Geschwisterreihe, Elternbeziehung, Beruf und die Bedeutung des Ehepartners auf.
Was versteht man unter einer "Suchtpersönlichkeit"?
Das Dokument stellt fest, dass es keine klassische Suchtpersönlichkeit gibt, sondern lediglich eine Häufung von Risikofaktoren, die zu emotionalen und sozialen Fehlentwicklungen führen können. Die Pubertät und Adoleszenz spielen eine entscheidende Rolle bei der Identitätsentwicklung und Verantwortungsübernahme.
Was bedeutet Comorbidität im Zusammenhang mit Alkoholabhängigkeit?
Comorbidität beschreibt das gleichzeitige Auftreten von (verschiedenen) Krankheiten und pathologischen Zuständen bei derselben Person. Das Dokument betont, dass depressive oder psychotische Symptome oft im Laufe der Entwöhnung verschwinden und dass psychiatrische Symptome oft die unmittelbare Folge des Suchtmittelmissbrauchs sind.
Wie entwickelt sich eine manifeste Alkoholabhängigkeit?
Der Süchtige hat zunächst den Eindruck, mit dem Suchtmittel den richtigen Weg gefunden zu haben. Mit dem Fortschreiten der Abhängigkeit kommt es zu einer Reduktion von Aktivität und Spontaneität, Unzuverlässigkeit, Kritikschwäche, Konzentrationsstörungen und einem "Verfall der historischen Persönlichkeit" (Depravation).
Welche Deutungen süchtigen Verhaltens werden im Dokument genannt?
Das Dokument listet verschiedene Motive für Suchtmittelkonsum auf, darunter die Abwehr einer als unzulänglich erlebten Realität, narzisstische Aufwertung, die Schaffung einer Scheinrealität des Besonderen und Außergewöhnlichen, der Wunsch nach Gruppenzugehörigkeit und das Erhalten der Fiktion, Kontrolle zu haben.
Welche Therapiekonzepte werden bei Abhängigkeitserkrankten angewendet?
Das Dokument beschreibt allgemeine Therapieprinzipien, die Verhaltenstherapie (Aversionsmethode, systemische Therapie, Psychodrama, Breitbandverhaltenstherapie, kognitive Methode, alternatives Verhalten, soziales Kompetenztraining), sowie ambulante und stationäre Therapieansätze.
Was sind die Grundzüge der ambulanten Therapie?
Die ambulante Therapie umfasst alle medizinischen, psychotherapeutischen und sozialtherapeutischen Maßnahmen, die erforderlich sind. Zu den Aufgaben gehören Information, Diagnosestellung, Motivationsarbeit und nachgehende Behandlung nach stationärer Therapie.
Welche Phasen umfasst die stationäre Therapie?
Die stationäre Therapie wird in vier Phasen eingeteilt: Kontaktphase, Entgiftungsphase, Entwöhnungsphase und Nachsorge-Rehabilitationsphase.
Was ist die Bedeutung der Nachsorge?
Die Nachsorge ist entscheidend für die Stabilisierung neuer Wert- und Verhaltensmuster, die Wiedereingliederung in die Familie, das soziale Umfeld und den Beruf. Sie dient auch der Rückfallprävention und dem frühzeitigen Eingreifen bei Rückfällen.
Welche Arten der Nachsorge werden unterschieden?
Das Dokument unterscheidet zwischen Nachsorgegruppen (nicht-professionelle Selbsthilfegruppen, Anonyme Alkoholiker, professionelle Nachsorgegruppen), ambulant aufsuchendem Dienst (aufsuchende Einzelbetreuung, betreute Wohngemeinschaften) und niederschwelliger Nachsorge (Harm-Reduction).
Was bedeutet "Harm-Reduction"?
Harm-Reduction bedeutet Schadensbegrenzung bzw. Schadensminderung, d.h. die Klienten werden dort abgeholt, wo sie im Moment stehen, ohne Abstinenzverpflichtung. Es wird davon ausgegangen, dass nicht alle Suchtkranken für das Abstinenzprinzip zu begeistern sind oder in der Lage sind, ohne ihr Suchtmittel zu leben.
Welche Abwehrmechanismen zeigen Alkoholiker auf?
Alkoholiker zeigen häufig Abwehrmechanismen wie Verleugnung, Projektion, Rationalisierung, Regression und Splitting.
Was ist ein Rückfall und welche Faktoren begünstigen ihn?
Ein Rückfall ist ein erneutes Trinken von Alkohol nach einer absichtlich eingehaltenen Phase der Abstinenz. Begünstigende Faktoren sind unangenehme Gefühle, soziale Bedingungen, situative Faktoren, fehlende Bewältigungsstrategien und die Überzeugung, kontrolliert trinken zu können.
Welche Rolle spielt die Übertragung in der Therapie?
Alkoholabhängige neigen dazu, innere Haltungen und Vorstellungen auf andere Menschen zu übertragen. Aus der Übertragung können sich spezifische Konflikte ergeben, da sich die ursprünglichen, kindlichen Verhaltensmuster mit den Forderungen der Erwachsenenwelt nicht mehr vereinbaren lassen.
Was versteht man unter Coabhängigkeit?
Coabhängigkeit bezeichnet die Abhängigkeit von der Abhängigkeit eines nahen Menschen. Coabhängige Menschen stehen in enger Beziehung zum Suchtkranken und verstärken durch ihr Helfersyndrom das suchterzeugende Verhalten.
Wie äußert sich Suizidalität bei Alkoholikern?
Alkoholiker sind besonders suizidgefährdet. Suizidhandlungen können aus unvorhergesehenen aggressiven Impulsen, im Gefolge der alkoholentzugsbedingten Depression oder beim Erleben des Zusammenbruchs der gesundheitlichen, sozialen und finanziellen Situation erfolgen.
Was ist "Burn out" und wie äußert es sich bei Betreuern von Suchtkranken?
Burn out beschreibt einen Zustand emotionaler, körperlicher und geistiger Erschöpfung, der durch chronischen Stress entsteht. Betreuer von Suchtkranken sind besonders gefährdet, da sie einem stark konfliktgeladenen Arbeitsfeld ausgesetzt sind und sich häufig mit den Konflikten ihrer Patienten identifizieren.
- Quote paper
- Gisela Walter (Author), Arthur Pohl (Author), Josef Zanon (Author), 1999, Integratives Therapiekonzeot von Alkoholerkrankten mit besonderem Schwerpunkt Nachsorge, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99843