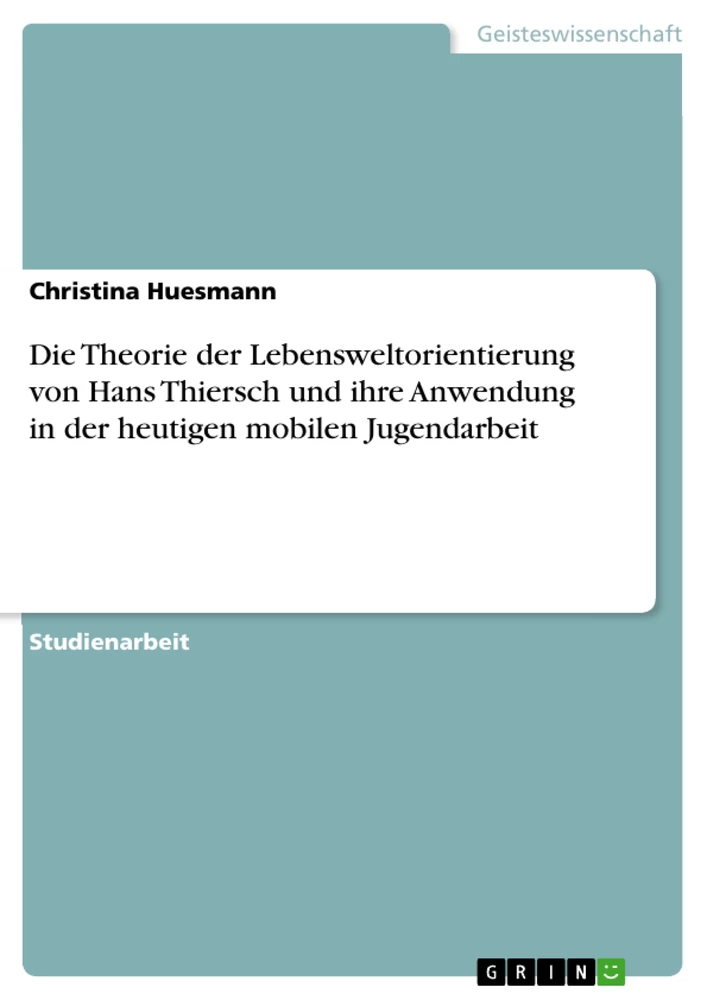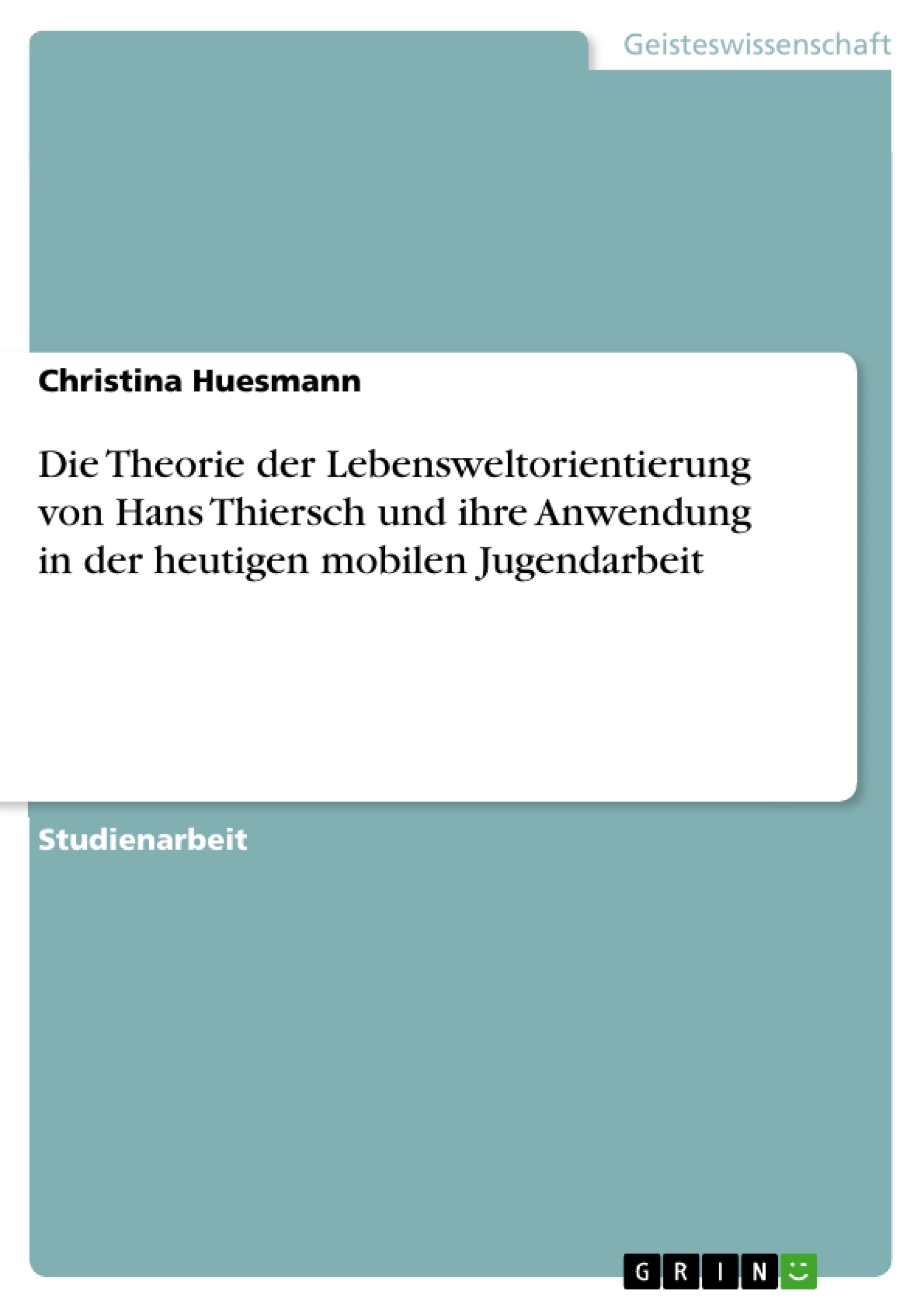Die Arbeit befasst sich mit der Theorie der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit und ihrem Handlungskonzept für die Jugendhilfe. Die Lebensweltorientierung von Hans Thiersch ist ein Weg von vielen, das professionelle Handeln in der Sozialen Arbeit, auf Grundlage einer Theorie, zu begründen.
Besonders in der Jugend befindet sich der Mensch in einer vulnerablen Phase der Orientierung, in der sich seine eigenen Optionen und Erwartungen ausbilden. Es gibt unzählige Richtungen, in die er sich entwickeln kann. Doch gerade im heutigen Zeitalter, in dem unter anderem Globalisierung und Ökonomisierung die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer werden lassen, wird es für Jugendliche schwerer, sich zu behaupten. Vor allem Jugendliche, die durch Bildungsdefizite, einen Migrationshintergrund oder ihren sozioökonomischen Status benachteiligt sind, geraten leichter an den Rand der Gesellschaft. Ihnen bleiben Lebensmöglichkeiten verwehrt. Diese Situation kann als ungerecht empfunden werden und bei den betroffenen Jugendlichen zu Protest, Hass oder Rückzug führen.
Die Lebensweltorientierte Soziale Arbeit, von Hans Thiersch, ist ein wissenschaftliches Theoriekonzept der Sozialen Arbeit. Es dient, neben anderen, als Handlungsbasis für Sozialarbeitende, die in der Jugendhilfe tätig sind. In den neunziger Jahren wurde es zum Inbegriff der allgemeinen Neuorientierung in der Sozialen Arbeit und gilt bis heute als zentrales Paradigma in der Jugendhilfe. Aber ist Thierschs Theoriekonzept wirklich die revolutionäre Antwort auf Probleme in der Sozialarbeit mit Jugendlichen? Oder gibt es nicht doch Probleme bei der praktischen Umsetzung Lebensweltorientierter Jugendhilfe?
Die wissenschaftliche Arbeit, auf hermeneutisch-interpretativer Basis, soll diese Fragestellung beantworten. Nach einem einführenden grundlegenden Überblick über die Theorieentwicklung in der Sozialen Arbeit wird im Hauptteil dieser Arbeit die Lebensweltorientierung von der Entstehung bis heute mit ihren Handlungsmaximen für die Jugendhilfe beschrieben und ihre praktische Anwendung am Beispiel mobiler Jugendarbeit aufgezeigt. Dann geht diese Arbeit auf Kritik des Theoriekonzeptes ein, um ab-schließend ein Fazit zu geben und die oben genannten Fragen zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Die Grundlagen zum Verständnis der Lebensweltorientierung
- 2.1 Theorien in der Sozialen Arbeit und ihre Funktion
- 2.2 Biographische Eckdaten von Hans Thiersch und die Entstehung der Lebensweltorientierung
- 2.3 Die Aufgaben der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
- 3 Die Lebensweltorientierung in der Jugendhilfe
- 3.1 Jugendliche als Adressaten der Lebensweltorientierung
- 3.2 Die Struktur- und Handlungsmaximen
- 3.3 Lebensweltorientierung in der mobilen Jugendarbeit
- 4 Kritik und Grenzen der Lebensweltorientierung
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Theorie der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit von Hans Thiersch und ihre Anwendung in der heutigen mobilen Jugendarbeit. Der Fokus liegt auf der Erörterung der Theorieentwicklung, der praktischen Umsetzung des Konzeptes und der Kritik an seinen Grenzen. Die Arbeit untersucht die Relevanz der Lebensweltorientierung für die Jugendhilfe, insbesondere im Kontext der Herausforderungen, denen Jugendliche im heutigen Zeitalter gegenüberstehen.
- Die Entwicklung der Theorie der Lebensweltorientierung und ihre historischen Wurzeln
- Die Handlungsmaximen der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit
- Die Bedeutung und Anwendung der Lebensweltorientierung in der mobilen Jugendarbeit
- Kritik und Grenzen der Lebensweltorientierung in der Praxis
- Die Relevanz der Lebensweltorientierung im Kontext der heutigen Herausforderungen für Jugendliche
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Lebensweltorientierung für die Soziale Arbeit, insbesondere die Jugendhilfe, dar. Sie beleuchtet die Herausforderungen, denen Jugendliche im heutigen Zeitalter gegenüberstehen, und die Notwendigkeit eines theoretisch fundierten Handlungskonzeptes.
Kapitel 2 liefert die Grundlagen zum Verständnis der Lebensweltorientierung. Es beginnt mit einem Überblick über die verschiedenen Theorien der Sozialen Arbeit und deren Funktionen. Anschließend werden die biographischen Eckdaten von Hans Thiersch und die Entstehung der Lebensweltorientierung beleuchtet. Abschließend werden die Aufgaben der Lebensweltorientierten Sozialen Arbeit erläutert.
Kapitel 3 fokussiert auf die Lebensweltorientierung in der Jugendhilfe. Es werden die Jugendlichen als Adressaten der Lebensweltorientierung vorgestellt und die Struktur- und Handlungsmaximen des Konzeptes erörtert. Abschließend wird die Anwendung der Lebensweltorientierung in der mobilen Jugendarbeit beleuchtet.
Kapitel 4 widmet sich der Kritik und den Grenzen der Lebensweltorientierung. Es werden die Schwächen des Konzeptes und die Herausforderungen bei seiner praktischen Umsetzung beleuchtet.
Schlüsselwörter
Lebensweltorientierung, Hans Thiersch, Soziale Arbeit, Jugendhilfe, mobile Jugendarbeit, Theorieentwicklung, Handlungskonzept, Kritik, Praxis, Jugendliche, Herausforderungen, Globalisierung, Ökonomisierung, Bildungsdefizite, Migrationshintergrund, sozioökonomischer Status.
- Quote paper
- Christina Huesmann (Author), 2020, Die Theorie der Lebensweltorientierung von Hans Thiersch und ihre Anwendung in der heutigen mobilen Jugendarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/998452