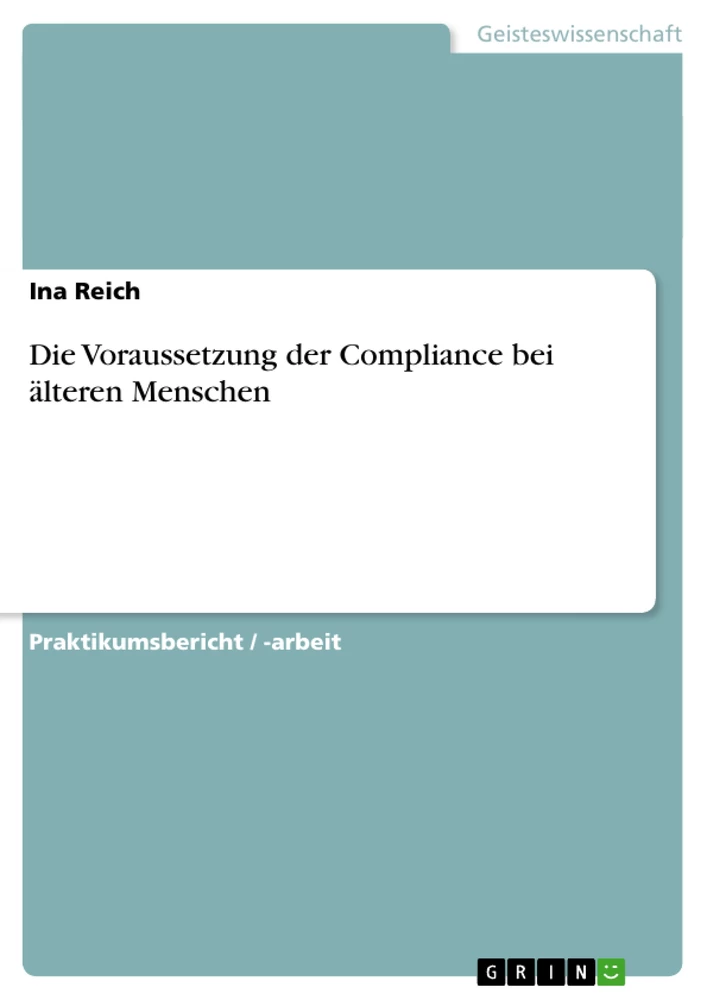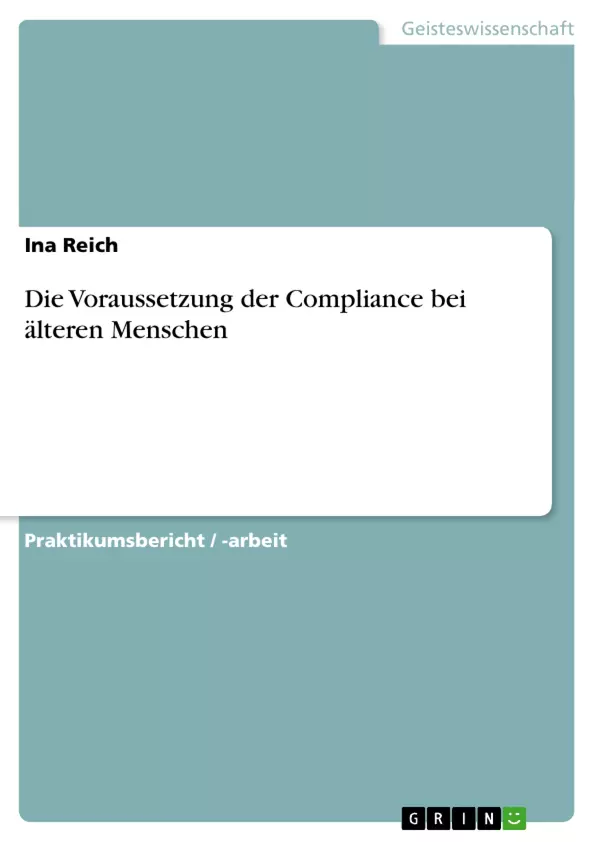Die Voraussetzung der Compliance bei älteren Menschen
I. Einleitung
Im Rahmen des Psychologie-Studiums haben Studierende der Freien Universität Berlin unter Leitung von Frau Dr. Zank ein empirisches Praktikum zu einem entwicklungspsychologischen Thema aus dem Bereich der Gerontologie über 2 Semester durchgeführt. Das Thema war nach einer ausführlichen Literaturrecherche ,,Die Voraussetzung der Compliance bei älteren Patienten". Nach Fragebogenaufstellung, Datenerhebung, Datenauswertung und Dokumentation soll dieser Bericht den Abschluß des Praktikums darstellen.
Der Bericht soll Aussagen treffen, welche Voraussetzungen vorlagen, wie und was geforscht wurde und auch die Ergebnisse der Fragebogenuntersuchungen sollen hier dargestellt und ausgewertet werden.
II. Theoretische Vorüberlegung
Bevor sich die Studierenden mit der Wahl des Themas beschäftigen, machen sie sich mit der Geron tologie näher vertraut. Schließlich ist für viele der Studierenden diese Wissenschaft ein sehr neues Gebiet.
1. Literaturrecherche zum Thema
1.1 Die Gerontologie und ihre Notwendigkeit
Die Alternsforschung ist weitgehend Neuland, denn die Lebensspanne der Zivilisation in den westlichen Industrienationen reicht erst seit dem letzten Jahrhundert zu einem Alter weit über 70 Jahren hinaus. Die Gerontologie besitzt also keine Tradition, sie steht sozusagen am Anfang eines Lernprozesses, sich mit der Optimierung des Alternprozesses zu befassen. (P. Baltes, 1992)
Die Bevölkerungsstruktur wird sich bis zum Jahre 2030 grundlegend verändern, denn die Lebenserwartung der Bevölkerung steigt, die Sterblichkeit sinkt, die Zahl der Geburten geht in den letzten Jahrzehnten zunehmend zurück und die geburtenstarken Jahrgänge aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg werden älter. Laut statistischem Bundesamt wird die Bevölkerung zunächst von derzeit 80 Millionen auf ca. 78 Millionen im Jahr 2030 zurückgehen. Die Struktur der Zusammensetzung ändert sich ebenfalls.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1. Anteil verschiedener Altersgruppen an der Bevölkerung in den Jahren 1990 bzw. 2030 bezogen auf Gesamtdeutschland (Scheidt & Eikelbeck, 1995).
Es ist daher verständlich, wenn die Wissenschaft vom Altern in den letzten Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Es ist daher wichtig , neben der Beschreibung des Alters ganz besonders den Schwerpunkt in der Optimierung des Alterns zu legen.
Die beeindruckende Verlängerung der Lebenserwartung insgesamt ist den Erfolgen der Medizin, vor allem in der Bekämpfung infektiöser Erkrankungen, dem Rückgang der Säuglingssterblichkeit, der Verbesserung der Hygiene und der Erhöhung des Lebensstandards zu verdanken (Häfner, 1994, zitiert nach Zank, Wilms, H.U. & Baltes,1997). Auch die Allgemeinbildung ist gestiegen, die Menschen befähigt hat, die verbesserten Chancen zu erkennen und davon Gebrauch zu machen (vgl. Henschel, 1999).
Die Gerontologie kann von vielen Seiten betrachtet werden. Sie ist eine Wissenschaft, die aus Psychologie, Ökonomie, Soziologie, Biologie oder anderen Geisteswissenschaften besteht (P. Baltes, 1992). Sie besteht also aus vielen Facetten, die den Rahmen des Berichtes sprengen würden, würde man auf alle einzeln eingehen. Ich gehe daher nur auf einzelne Sichtweisen ein.
1.2 Altern aus biologischer Sicht
Für den Biologen besteht das Altern darin, daß sich das Leben kontinuierlich auf sein Ende hin zubewegt und mit jedem Tag die einem Organismus zugedachte Lebenszeit abnimmt. Der Altersprozeß wird hier als ein dem Organismus inhärentes Geschehen denn als Resultat externer Einflußfaktoren gesehen, und viele Veränderungen gelten als irreversibel, unidirektional, universell, weitgehend vorhersehbar und unbeeinflußbar. Dennoch wird immer wieder auch auf die Plastizität biologischer Alternsprozesse und ihre Modifizierbarkeit etwa durch individuelles Handeln und/oder Umweltveränderungen verwiesen, z.B. höhere Lebenserwartung bei körperlich aktiven Menschen und die Rolle der gesunden Ernährung. Die Grundannahme einer genetischen Basis des Alterns scheint bei den biologischen Alternstheorien unumstritten, durch die die maximale Lebenserwartung jeder Spezies festgelegt ist. Dabei wird auf eine Vielzahl der am Alterungsprozeß beteiligten Gene ausgegangen, wobei z.B. die den Alterungsprozeß verlangsamenden ,,Langlebigkeits-Gene" von ,,Alterns-Genen" als solche, die ihn beschleunigen sollen, unterschieden werden. Altern bedeutet eine Vielfalt von Veränderungen in Zellen und Geweben, und demgemäß werden unterschiedliche biologische Alternsphänomene betont und Erklärungsansätze favorisiert, z.B. die Theorie der ,,freien Radikale",, die ,,Reparatur-Mechanismus-Theorie". Auch immunologische Theorien heben hervor, daß mit dem Altern ein kontinuierlicher Verlust der Überwachungsfunktion des Immunsystems einhergehe und sich eine Reihe neuroendokriner Veränderungen vollziehe, durch die Störungen im ,,Kontrollsystem" begünstigt und die Wahrscheinlichkeit letaler Erkrankungen (v.a. Krebserkrankungen) erhöht werden.
Aus psychologischer Sicht ist die somatische Veränderung, die den Altersprozeß ausmachen, von großem Interesse angesichts ihrer vielfältigen Rückwirkungen auf das Verhalten und Erleben des alternden Individuums (Filipp, Schmidt, 1998).
1.3 Altern aus psychologischer Sicht
Beim Altern aus psychologischer Perspektive kann man sich mindestens vier Fragerichtungen nähern:
1. Systematische Erfassung und Beschreibung der mit dem Alter einhergehenden Veränderungen menschlichen Verhaltens und Erlebens;
2. Eruierung der Bedingungen des Alterns - jenseits der biologischen Steuerungsprozesse;
3. Verarbeitung und Bewältigung des alternden Individuums selbst mit dem Altern einhergehenden negativen Veränderungen;
4. Implementation aufbauender Maßnahmen zur Vermeidung unerwünschter
Alternserscheinungen oder zur Förderung eines erfolgreichen Alterns (Filipp u. Schmidt, 1998).
1.4 Modelle des Alterns
Innerhalb der psychologischen Perspektiven wurden Modelle des Alterns vorgelegt und dabei Formen des Alterns differenziert. Hier soll auf einige Modelle kurz eingegangen werden.
Es dominierten in der gerontologischen Forschung lange Zeit Versuche, Beschreibungen des Alterns vorzunehmen und ,,normales Altern" zu charakterisieren. In den frühen 60er Jahren standen sich zwei Theorien gegenüber. Die ,,Disengagement-Theorie" (Cumming & Henry, 1961 zitiert nach Filipp u. Schmidt, 1998) vs. ,,Aktivitätstheorie" (Tartler, 1961 zitiert nach Filipp u. Schmidt, 1998). Bei der Disengagement-Theorie wurde betont, daß das höhere Erwachsenenalter nicht nur durch den von außen erzwungenen Verlust sozialer Rollen gekennzeichnet sei, sondern daß das alternde Individuum selbst ein Bedürfnis nach Rückzug aus seinen sozialen Bezügen habe und insgesamt eine stärker ,,innengeleitete" Orientierung beobachtbar werde. Bei dem Aktivitätsansatz wird betont, daß auch das alternde Individuum sozial ,,aktiv" sein wolle und soziale Teilhabe anstrebe (z.B. Lehr & Minnemann, 1987, zitiert nach Filipp u. Schmidt, 1998). Mit der ,,Kontinuitätshypothese des Alterns" (Atchley, 1982, zitiert nach Filipp u. Schmidt, 1998) wurde eine Alternative in die Diskussion gebracht. Sie besagt, daß das höhere Alter durch eine Fortführung der ein Leben lang erworbenen Handlungs- und Orientierungsmuster gekennzeichnet sei. Kontinuität und das Postulat hoher interindividueller Variabilität bei gleichzeitig vergleichsweise hoher intraindividueller Stabilität des Verhaltens und Erlebens unterscheidet diesen Ansatz deutlich von den beiden vorgenannten. (Fillipp u. Schmidt, 1998) Die Selektivitätstheorie von Carstensen (1987) argumentiert hingegen, daß alte Menschen ihre sozialen Beziehungen nach emotionalen Kriterien auswählen, d. h. nicht die Quantität, sondern die Qualität der sozialen Kontakte ist ausschlaggebend. Sozialkontakte alter Menschen dienen demzufolge stärker der Emotionsregulierung und der Aufrechterhaltung des Selbstwertgefühls, während in jüngeren Jahren weitere Motive, wie z.B. neue Kontakte zu bekommen oder viele Informationen zu erhalten, eine Rolle spielen (Zank, Wilms, M. Baltes, 1997). Das Modell der ,,Selektiven Optimierung durch Kompensation" von Baltes und Baltes (1990) läßt sich als Metamodell menschlicher Entwicklung verstehen, indem es auf eine Vielzahl von Einzelphänomenen Anwendung finden kann. Altern sei zwar in einer Abnahme der Anpassungskapazität des Organismus zu sehen, könne dies jedoch durch ,,selektive Optimierung" in ausgewählten Verhaltensbereichen kompensieren (Filipp/Schmidt, 1998).
1.5 Formen des Alterns
Das Altern jedoch besitzt keine universale standardisierte Form. Es besteht eine Vielfalt in den Altersverläufen. In der Gerontologie spricht man daher auch vom differentiellen Altern. Mit der Frage nach den Bedingungen, die es Menschen möglich macht, bei weitestgehend erhaltener psychischer und physischer Gesundheit ein möglichst langes Leben zu führen stößt man auf den Begriff des erfolgreichen Alterns.
Gegenwärtige Bemühungen um eine Klärung des Konstrukts ,,erfolgreiches Altern" sind vor allem durch die Suche nach objektiven Erfolgskriterien bestimmt, so, wenn Nowlin (1985) das Überleben in einer Längsschnittstudie bei guter Gesundheit als das sicherste Zeichen für eine erfolgreiche Anpassung an die biologischen und sozialen Herausforderungen des Alters bezeichnet. Palmore (1986) schlug vor, diese beiden objektiven Kriterien mit dem subjektiven der Zufriedenheit zu kombinieren. In einer Analyse von Daten der Duke-Längsschnittstudien erwies sich jedoch neben außerfamiliärer Aktivität das subjektive Wohlbefinden als bester Prädiktor von Langlebigkeit bei guter Gesundheit. Eine andere Bewertung einer subjektiven Sicht des Alterns findet sich wie schon erwähnt dagegen bei Baltes et al. (1989). Sie halten subjektive Indikatoren für trügerisch und erklären das Austesten der Grenzen der mentalen Reserven älterer Menschen als die unbedingt notwendige Basis für eine Aussage über das Maß eines individuellen Erfolgs im Alternsprozeß (Thomae, 1992).
1.6 Kompetenzen
Kompetenzen spielen bei der subjektiven Sicht eine wichtige Rolle und sind Bestandteil der Selbstwirksamkeit. Es haben sich fünf Kompetenzbereiche herauskristallisiert, in die sich verschiedene Fähigkeiten einordnen lassen:
a) Lebenspraktische Kompetenz: Hierbei geht es um die Bewältigung des Alltags, die sich durch Fertigkeiten wie z.B. Umgang mit Behörden Benutzung von Verkehrsmitteln, Körperpflege, Einkaufen, Kochen und Waschen ausweisen.
b) Leistungsrelevante Kompetenzen: Damit ist gemeint, das Anspruchsniveau in Bezug zum eigenen Können zu setzen und hinsichtlich der Ausführung mit Ausdauer und Regelmäßigkeit arbeiten zu können.
c) Kreative Kompetenzen: Hier geht es um Fertigkeiten wie Einfallsreichtum, Spontanität, Flexibilität, Neugier und Risikobereitschaft.
d) Krisenbewältigungs- oder Problemlösekompetenzen: Wenn über diese Kompetenzen verfügt wird, gelingt es, nach Mißerfolgen, Schicksalsschlägen wie Krankheit oder Tod naher Angehöriger und Streßsituationen usw. das psychische Wohlbefinden wieder herzustellen. Diese Wiederherstellung wird erreicht durch ein Zusammennehmen verbleibender Kräfte, um diese veränderungswirksam einzusetzen und somit ein zufriedenes Weiterleben zu ermöglichen.
e) Soziale Kompetenzen: Es handelt sich dabei im besonderen um die Fähigkeit, Kontakte zu Mitmenschen herzustellen und aufrechtzuerhalten, Wünsche, Erwartungen und Gefühle anderer Menschen zu erkennen bzw. die eigenen Gefühle, Erwartungen und Wünsche zu äußern. Um aber über gute soziale Kompetenzen zu verfügen, ist es notwendig, Kompetenzen aus zahlreichen verschiedenen Bereichen zu besitzen. Es ist nicht möglich, eine Bereich isoliert zu sehen. Es kommt hinsichtlich der Höhe der sozialen Kompetenz auf das gelungene Zusammenspiel der einzelnen Fähigkeiten und Kompetenzen an (vgl. Haske, 1988).
1.7 Selbständigkeit & Alter
In der gesellschaftlichen Beurteilung wird alten Menschen die Fähigkeit zu unabhängigem und selbstverantwortlichem Leben weitgehend abgesprochen (Thomae, 1983). Diese Begriffe stehen nämlich im Widerspruch zu Krankheit und Pflegebedürftigkeit, die immer noch mit Alter gleichgesetzt werden (Lehr, 1972). Neuere Ergebnisse zeigen, daß statistisch gesehen nur 3% der alten Bevölkerung in Altersheimen leben. Eine Untersuchung von Wieltsching (1982) belegt, daß die überwiegende Zahl der heute über 70jährigen noch über eine hohe Kompetenz verfügt (Haske, 1988). Gerontologen weisen immer wieder darauf hin, daß die Selbständigkeit auch im hohen Alter von großer Bedeutung ist. Hans-Werner Wahl z.B., Professor und Mitarbeiter des Zentrums für Geriatrie und Gerontologie Heidelberg, und seine Mitarbeiter haben mit ihren Studien über die Bedürfnisse alter Menschen ein Arsenal von nützlichen Hilfen im Alltag angeregt, die die längere Unabhängigkeit erleichtern: Etwa große Telefon- und Fernbedienungstasten für arthritische Gelenke und gut augeleuchtete Räume ohne Türschwellen und Verbesserung des Wohnumfeldes durch Parkbänke, Läden, längere Ampelphasen. Susanne Zank, Mitarbeiterin der Gerontopsychiatrischen Tages- und Poliklinik der FU Berlin hat durch Erprobung von ,,Interventions-Techniken" betont, daß auch in der Altenpflege viel zur Selbstvertrauensstärke beigetragen werden kann. Etwa nach dem Motto: ,,Mit den Händen in der Tasche pflegen." (Henschel, 1999, S. 122). Zwei Mediziner Thorsten Nikolaus und Clemens Becker konnten auch mit Hilfe eines Forschungsprojektes an einem Ulmer Altenpflegeheim beweisen, daß Sport zur Gesundung und zur Stärkung der Körperkräfte, vor allem aber der Autonomie ganz aktiv wirken kann (Henschel, 1999).
1.8 Erfolgreiche Anpassung
Von der Analyse von Alltagserleben und -handeln aus gesehen ist erfolgreiches Altern mit erfolreicher Anpassung an Lebenslagen gleichzusetzen. Anpassung durch das Ausmaß subjektiven Wohlbefindens, das mehr oder weniger mit dem objektiven verbunden ist. Eine psychologische Theorie der Anpassung an das Alter wird durch die Grundannahme kognitiver Theorien gefördert, daß die erlebte Situation eine Antwort auf diese entscheidender sei als deren objektive Qualität. Obwohl objektive und subjektive Qualität von Situationen oder Lebenslagen viele Übereinstimmungen zeigen, gibt es doch Abweichungen und insbesondere viele interindividuelle Unterschiede im Erleben der gleichen Situation (Thomae, 1992).
1.9 Sujektives Erleben
Die interindividuellen Unterschiede im subjektiven Erleben hängen mit zahlreichen Einflußfaktoren zusammen:
a) die biographische Entwicklung, in der es darum geht, welche Erfahrungen die Person in früheren Lebensabschnitten gemacht, wie sie sich mit diesen auseinandergesetzt und diese verarbeitet hat;
b) die Persönlichkeitsstruktur, in der es darum geht, welche Ausprägungsgrade die allgemeinen, stabilen Eigenschaften, wie z.B. Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, aufweisen;
c) das Ausmaß und die Art objektiver und subjektiv erlebter Belastungen in der gegenwärtigen Lebenssituation;
d) der Grad objektiver und subjektiv erlebter sozialer Integration und Unterstützung;
e) der Grad psychischer und sozialer Aktivität;
f) sowie persönliche Einstellungen, also die Überzeugung, die Situation verändern zu können (Kruse, 1992).
1.10 Gesundheitseinschätzung
Bei der Gesundheitseinschätzung zum Beispiel fand man heraus, daß es sowohl subjektive Über- wie Unterschätzung der Gesundheit gibt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Optimismus vs. Pessimismus älterer Menschen bei der Einschätzung ihrer Gesundheit (Zank et al. 1997)
Es besteht eine auffällige Diskrepanz zwischen subjektiver und objektiver Gesundheitseinschätzung. Die mangelnde Übereinstimmung zwischen subjektivem (Selbstbeurteilung) und objektivem Gesundheitszustand (Arzturteil) scheint auf unterschiedliche Kriterien hinzuweisen, die für die Gesundheitsbeurteilung verwendet werden. Das ärztliche Urteil beruht auf der Diagnose manifester Erkrankungen und die individuelle Einschätzung berücksichtigt vorrangig Beeinträchtigungen der Funktionstüchtigkeit (z.B. Geh-, Seh- und Hörvermögen) und das allgemeine Wohlbefinden.
1.11 Arzt-Patient-Verhältnis
Die subjektive Einschätzung der Gesundheit des Patienten kann sich auch in der Compliance auswirken. Hier wird deutlich, welche besondere Bedeutung die Arzt-Patient-Beziehung hat. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis einer ärztlichen Behandlung hängt schließlich auch davon ab, in welchem Ausmaß die Person sich von einer Krankheit bedroht sieht. Die Funktion des Arztes besteht daher über die Wissensvermittlung hinaus auch darin, beim Patienten eine positive Einstellung gegenüber einer notwendigen und medizinisch begründbaren medikamentösen Behandlung herzustellen. Wesentlich ist hier etwa das Eingehen auf Bedenken des Patienten oder die Kontrolle von unerwarteten Nebenwirkungen. Das Ausmaß an Vertrauen, das der Arzt als Autoritätsperson erhält, stellt einen kritischen Faktor für die Zuverlässigkeit der Einnahme von Medikamenten dar, da durch Vertrauen auch beim Patienten eine positive Einstellung gegenüber der Behandlung entsteht. Allerdings gilt dies nur dann, wenn der Arzt selbst vom Sinn seiner Therapie überzeugt ist. Hier kann auch das Konzept der subjektiven Kontrollüberzeugung herangezogen werden. So ist dann eher eine korrekte Einnahme von Medikamenten zu erwarten, wenn die Person der Überzeugung ist, persönlich Einfluß auf Gesundheit bzw. Krankheitsverlauf nehmen zu können. Wird Krankheit dagegen als von außen kommendes ,,Schicksal" erlebt, so ist darauf bezogenes Gesundheitsverhalten weniger zu erwarten. Das Wissen über vernünftiges Umgehen mit einer Erkrankung muß bei subjektiver Kontrollüberzeugung ebenfalls vorhanden sein. Kunze und Schoberberger (1984, zitiert nach Gunzelmann, 1992) fanden in ihrer Befragung von Hypertonikern einen Einflußfaktor in Bezug auf die Einnahme von Medikamenten, den sie als ,,hypochonsrische Ärzteglaubigkeit" bezeichneten. Das Gesundheitsverhalten im Umgang mit der Krankheit beschränkte sich lediglich nur auf die konsequente Einnahme der Medikamente, die Änderung der Lebensweise wurde nicht in Betracht gezogen. Es kann dabei zu einer ,,Über-Compliance" kommen, d.h. daß der Patient in seinem Interesse zur Ausübung von Kontrolle zu viele oder immer mehr verschiedene Medikamente einnimmt. Die an sich positive Einstellung gegenüber eigenen Einflußmöglichkeiten hat also nur dann auch positive Effekte, wenn sie mit ausreichendem Wissen über sinnvollen Umgang mit Arzneimitteln einhergeht und neben der Einnahme von Medikamenten Alternativen akzeptiert (etwa eine Änderung des Lebensstils) (Gunzelmann, 1992).
1.12 Problem: Medikamente
Betont werden muß jedoch auch die Problematik der Verabreichung von Medikamenten. An der Nützlichkeit von Medikamenten besteht kein Zweifel. Da im Alter häufig verschiedene Gesundheitsstörungen gleichzeitig bestehen (Mulitmorbidität und Polypathie) werden oft mehrere Medikamente verordnet (Polypragmasie). Dabei treten jedoch gehäuft Arzneimittelinteraktionen im Sinne einer gegenseitigen Wirkungsverstärkung oder auch Wirkungsabschwächung auf sowie auch unerwünschte Arzneimittelnebenwirkungen. Daher gilt in der Geratrie das Prinzip, möglichst wenig Medikamente einzusetzen. Auch muß bedacht werden, daß der ältere Organismus nicht nur hoch sensibel auf Medikamente reagiert, sondern auch sehr variabel. Eine Standarddosierung kann daher niemals angegeben werden (Hofmann, 1991).
Im Rahmen der Berliner Altersstudie konnte dabei folgendes zusammentragen: Bei einer Stichprobe zwischen 70- bis 100jährigen blieben 24% aller Erkrankungen un- oder unterbehandelt, 28% der Probanden erhielten Medikamente, die für alte Menschen grundsätzlich oder für deren Symptome ungeeignet waren. Weitere 26% wurden mit Mitteln behandelt, die unerwünschte Nebenwirkungen haben und z.B. zu Verwirrtheit und Sehstörungen führen (vgl. Henschel, 1999)
1.13 Thematikbezogene empirische Studien
In die Diskussion zur Erstellung des Themas und der darauffolgenden Hypothesen werden auch folgende Studien etwas näher betrachtet.
Zum einen die Studie von Greene, Adelman und Charon (1994). Hier wurden 81 Erstgespräche zwischen Arzt und Patient (über 65 Jahre) studiert. Dabei kam heraus, daß weniger über psychische Probleme gesprochen wird als im Vergleich zu Jüngeren, daß, ist ein dritte Person mit dabei, die Bereitschaft über psychosoziale Probleme zu sprechen geringer ist, daß ältere Patienten eher psychische Probleme ansprechen als der Arzt und der Arzt eher darauf eingeht, wenn er einen psychischen Aspekt eingebracht hat, als wenn dieser vom Patienten selbst kommt.
Die Mannheimer Studie forschte zum Thema Arztbesuch (Cooper & Sosna, 1983 zitiert nach Zank et al, 1997). Dabei fand man heraus, daß die meisten älteren Menschen einen Arzt konsultieren, 90% der über 65jährigen einen Hausarzt und 76% diesen in den letzten drei Monaten aufgesucht haben.
Zum Vergleich mit der Mannheimer Studie kann man die Ergebnisse der Berliner Altersstudie (Linden, Gilbert, Horgas u. Steinhagen-Thiessen, 1996 zitiert nach Zank et al, 1997) mit einbeziehen. Dort haben 93% der über 70jährigen regelmäßige Arztkontakte, davon sind 85% Kontakte mit dem Hausarzt und durchschnittlich 6 Arztkontakte pro Quartal. In der Berliner Altersstudie (Baltes, 1997, zitiert nach Zank et al, 1997):waren bei einer repräsentativen Stichprobe von 516 hochaltrigen West-Berlinern (70 bis 103 Jahre) die 10 häufigsten Krankheiten: Zerebralarteriosklerose (65%), Herzinsuffizienz (64%), Osteoarthrose (61%), Hypertonie (59%) und koronare Herzkrankheit (45%). Auch zum Thema Abhängigkeit/Sucht konnte nach DSM-IIIR Kriterien bei 1,2% der Probanden Alkoholabhängigkeit/-mißbrauch und bei 0,7% der Befragten Medikamentenabhängigkeit/-mißbrauch festgestellt werden.
2. Themabestimmung
Auf der Basis des theoretischem Hintergrundwissens wurde über dessen Eingrenzung und die Formulierung des Ziels der empirischen Untersuchung diskutiert. Wie auch der obige Exkurs in die Wissenschaft der Altersforschung belegt, ist dieses Gebiet sehr kompakt und vielschichtig. Es war für die Studierenden also nicht leicht, sich auf eine Thematik zu beschränken. Die Literaturrecherche zeigt allen, daß viel zu wenig Forschungsmaterial in Sachen Compliance, Selbstwirksamkeit und Krankheitsbelastung vorliegt. Ziel war es ja schließlich auch, Untersuchungen anzustellen, die noch nicht zahlreich vorlagen. Letztlich kann Einigkeit erzielt werden, und das Thema: ,,Die Voraussetzung der Compliance bei älteren Patienten" wurde formuliert.
Bevor auf die Methodik der empirischen Untersuchung konkret eingegangen wird, sollen noch einmal die wichtigsten Terminis definiert aufgeführt werden.
3. Erklärung der Begrifflichkeiten
3.1 Compliance (engl. Einwilligung, Bereitschaft):
Bereitschaft eines Patienten zur Mitarbeit bei diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen, z.B. Zuverlässigkeit, mit der therap. Anweisungen befolgt werden (sog. Verordnungstreue). Die Compliance ist u.a. abhängig von Persönlichkeit, Krankheitsverständnis und Leidensdruck des Patienten, Arzt-Patient-Verhältnis, Anzahl und Schwierigkeit der Anweisungen, Art der Therapie und evtl. erforderlichen Verhaltensänderungen (Pschyrembel Klinisches Wörterbuch, 1990, Seite 304)
Neben ,,Compliance" beinhaltet die empirische Untersuchung auch den Schwerpunkt Selbstwirksamkeit.
3.2 Selbstwirksamkeit:
Wenn Menschen eine internale Kontrollüberzeugung erwerben, die sie dazu führt, sich Ziele zu setzen und im allgemeinen erfolgreiche Mittel zu deren Erreichung zu entwickeln, so erwerben sie auch ein Gefühl der Selbstwirksamkeit (self-efficacy). Dies ist das Gefühl, was einem geschieht, kontrollieren zu können. Wahrgenommene Selbstwirksamkeit wiederum beeinflußt die Denkmuster einer Person, ihre Leistung und ihren emotionalen Erregungszustand: Durch höhere wahrgenommene Selbstwirksamkeit wird die Leistung besser, und die emotionale Erregung sinkt. Die Wahrnehmung der Selbstwirksamkeit beeinflußt sowohl die Auswahl der Bewältigungsmuster in Reaktion auf Streß als auch das Niveau der physiologischen Erregung. Im Gegensatz dazu kann ein Gefühl der self-inefficacy zu Apathie, Mutlosigkeit, einem Gefühl der Vergeblichkeit und der Ansicht, man sei ein Opfer äußerer Umstände, führen (Bandura, 1977b; 1982 b zitiert nach Zimbardo, 1992)
Es gilt nun herauszufinden, wie genau man mit den oben genannten Schwerpunkten Selbstwirksamkeit, Krankheitsbelastung und Compliance auf der Basis der gestellten Thematik forschen kann. Hypothesen sind dabei notwendig und werden aufgestellt.
III. Methoden
1. Fragestellung/Hypothesen
Auf der Basis dreier Fragestellungen wurden die dazugehörigen, für uns interessanten Hypothesen gebildet:
Frage 1: Hat das Bildungsniveau Auswirkungen auf die Compliance?
Hypothese:
1) Niedrige Bildung geht einher mit niedriger Compliance.
2) Hohe Bildung geht einher mit niedriger Compliance.
Frage 2: Gibt es einen gegenläufigen Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Compliance?
Hypothese:
1) Hohe Selbstwirksamkeit geht einher mit niedriger Compliance.
2) Geringe Selbstwirksamkeit geht einher mit hoher Compliance.
Frage 3:Gibt es einen Zusammenhang zwischen Krankheitsbelastung, Selbstwirksamkeit und Compliance?
Hypothese:
Hohe Krankheitsbelastung führt zu einer Reduktion der Selbstwirksamkeit und das wiederum führt zu hoher Compliance.
2. Untersuchungsmaterial/Fragebogenbeschreibung
Die Datenerhebung erfolgt mit Hilfe eines Fragebogens.
Dabei wird betont, daß der Fragebogen hier nur exemplarisch dargestellt wird, auf den kompletten Fragebogen sei in der Anlage verwiesen.
Der Fragebogen setzt sich zusammen aus den Basisdaten (BS), Fragen zur Selbstwirksamkeit (AS), zum Arztbesuch (AB), zur Arztkontrollüberzeugung (AK), Gesundheit (GS), Compliance (C ), zum Gesundheitsverhalten (GESV) und zur Gesundheitskontrollüberzeugung (GK).
Die Basisdaten untergliedern sich in Geschlecht (BS01), Alter (BS02), Familienstand (BS03), Wohnsituation (BS04, BS05), finanzielle Situation (BS06), Herkunft (BS07), Schulabschluß (BS08), Beruf (BS09), Religion (BS10), Größe (BS11) und Gewicht (BS12).
Es wurden 10 Fragen zur Selbstwirksamkeit (AS01 - AS10) gestellt. Eine Frage der Selbstwirksamkeit ist z.B. - beziffert mit AS01- : ,,Wenn sich Widerstände auftun, finde ich Mittel und Wege, mich durchzusetzen." Dabei wurde eine Skala von ,,stimmt genau" (1), ,,stimmt eher" (2), ,,stimmt kaum" (3) und ,,stimmt nicht" (4) gewählt.
Um Informationen über den Arztbesuch als Oberbegriff zu bekommen, wird nach dem Vorhandensein eines Hausarztes (AB01) und dessen Geschlecht (AB01), der Regelmäßigkeit (AB02) und der Häufigkeit (AB03) des Arztbesuches gefragt. Beispielsweise bei der Regelmäßigkeit des Arztbesuches konnten die Befragten ,,ja" (1) oder ,,nein"(2) ankreuzen.
Daten zu Aussagen über die Arztkontrollüberzeugung können mit 6 Fragen (AK 01 - AK06) gewonnen werden. Die erste Frage lautet: ,,Mir ist es lieber, wenn Ärzte und Ärztinnen entscheiden, was für mich am besten ist, als wenn ich mich mit vielen Möglichkeiten konfrontiert sehe.
Die Gesundheit (GS01 - GS22) wird mit 22 Items erfragt Wobei vom Item GS03 bis Item GS20 ganz spezifisch nach den möglichen Krankheiten, die in den letzten fünf Jahren aufkamen, so daß eine ärztliche Behandlung von Nöten war, gefragt. Krankheiten wie Gicht/Rheuma (GS03), Asthma (GS04), Bluthochdruck (GS05), Herzkrankheit/Herzinfarkt (GS06), Kreislaufbeschwerden (GS07), Zuckerkrankheit/Diabetes (GS08), Geschwüre des Verdauungssystems (GS09), sonstige Magenkrankheiten (GS10), Leberkrankheit (GS11), Nierenkrankheit (GS12), Krebserkrankung (GS13), Anfallsleiden/Epilepsie (GS14), Schilddrüsenkrankheit (GS15), Hautkrankheit (GS16), Allergien (GS17), regelmäßige starke Kopfschmerzen (GS18), Demenz (GS19) und Depression (GS20) werden mit einer Ordinalskala von 0 (nein), 1 (leicht), 2 (mittel) und 3 (schwer) unterteilt.
Daten über die Compliance werden nach der gleichen Methode erhoben wie AS. Bei den 10 Items, z.B.: ,,Wenn mir meine Ärztin/mein Arzt aus gesundheitlichen Gründen eine Diät verordnet, dann halte ich sie ein." ist eine Skala von ,,stimmt völlig" (1), über ,,stimmt ziemlich" (2) und ,,stimmt wenig" (3) bis ,,stimmt gar nicht" (4) vorhanden.
Mit den fünf Items Raucher/Nichtraucher (GESV01), täglicher Verzehr von Obst und/oder Gemüse (GESV02), regelmäßiger Alkoholgenuß (GESV03), Bewegung (GESV04) und fettreduzierte Ernährung (GESV05) wird das Gesundheitsverhalten der Stichprobe erfragt. Hier kann zwischen ,,ja" (1) und ,,nein" (2) gewählt werden.
Daten über die Gesunheitskontrollüberzeugung werden mit Hilfe von 10 Items erlangt. Die Skala reicht hier wieder von ,,stimmt völlig" (1) bis ,,stimmt gar nicht (4). Eine Aussage lautet z.B. ,,Schlechte Gesundheit ist oft auf Sorglosigkeit zurückzuführen." (GK01).
3. Erhebungssituation
Über einen Zeitraum von ca. 10 Wochen (Semesterferien) wird die Befragung durchgeführt. Die Erhebungssituationen sind: Zu Hause, Freizeitstätte, Straße/Park, Praxis und Heim.
Nach den Semesterferien treffen sich die Studierenden zum zweiten Teil des empirischen Praktikums wieder. Es wird über persönliche Erfahrungen und Erlebnisse mit der Datenerhebung gesprochen und sich mit dem Auswerten der Daten vertraut gemacht. Damit die Arbeit aufgeteilt werden kann, bilden sich 3 Gruppen. Die Daten werden nun gruppenweise in den Computer eingegeben und ausgewertet.
4. Datenerfassung und -auswertung
Die Daten werden mit dem Statistik Software Programm SPSS/PC+: ,,Statistical Package For Social Sciences" ausgewertet. Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung computergestützter Datenauswertungen sind Kenntnisse in der Bedienung und Steuerung des jeweiligen Programms sowie im Lesen und Interpretieren des Programm-Outputs. Frau Dr. Zank steht den Studierenden dabei hilfreich zur Seite.
Aus ökonomischen Grund wird darauf verzichtet, auf alle Untersuchungsergebnisse einzugehen. Es werden hier nur die Items aufgeführt, die für die aufgestellten Hypothesen interessant sind. Bevor auf die konkreten Untersuchungsergebnisse eingegangen wird, folgt vorerst die Stichprobenbeschreibung.
4.1 Stichprobenbeschreibung/Basisdaten (BS01-BS09)
Es konnten 138 Personen, davon 108 Frauen und 30 Männer befragt werden. Das allgemeine Durchschnittsalter beträgt 74,5 Jahre, bei den Frauen 75,4 und bei den Männern 71,3 Jahre. Die jüngste befragte Person ist 61 und die älteste 95 Jahre alt. 37,7 % der Befragen waren verheiratet, 44,9 % verwitwet, 8,7 % geschieden, 8 % ledig und 0,7 % machten keine Angabe zu ihrem Familienstand. 49,3% leben allein, 37,7% mit dem Partner, 5,1% mit den Kindern und 6,5% allein. 1,4% machen keine Angabe. 82,6 der Stichprobe leben zur Zeit der Datenerhebung in ihrem eigenen Haus/Wohnung, 7,2% im Seniorenheim, 6,5% im Altenheim, 1,4% in der Wohnung eines Kindes. Bei 2,2 % enthalten sich der Angabe. Ihre Finanzsituation beschreiben als sehr gut 10,9 % der befragten Personen, als gut 29 %, befriedigend 35,5 %, ausreichend 19,6 %, mangelhaft 4,3 % und als ungenügend 0,7 %. Somit sehen 75,5 % ihre Situation in finanzieller Hinsicht als befriedigend und besser an. 23 der 138 Personen, lebten vor dem Fall der Mauer im Jahre 1989 in der ehemaligen DDR und 112 in der Bundesrepublik Deutschland. 3 Personen lebten vor 1989 anderswo. Bei der Frage nach dem höchsten Bildungsabschluß geben 50,7 % den Abschluß an der Volksschule, Gemeindeschule, Hauptschule an, 30,4 % haben die Mittlere Reife, den Realschulabschluß, das Einjährige erlangt, 15,2 % besitzen das Abitur oder die Hochschulreife. 1,4 % haben andere Abschlüsse, die im Fragebogen nicht erfaßt wurden. 2,2 % der Stichprobe haben keinen Abschluß. Zur besseren Datenauswertung werden hieraus 3 Gruppen gebildet: Gruppe 1 (kein Abschluß und Volksschule, Gemeindeschule, Hauptschule), Gruppe 2 (Mittlere Reife, Realschule, Einjähriges) und Gruppe 3 (Abitur, Hochschulreife). Personen, die sonstiges angegeben haben, werden hier nicht mit einbezogen. Unter der Rubrik ,,Welchen Beruf haben Sie überwiegend ausgeübt" fallen 13 ungelernte Arbeiter/innen, 23 Facharbeit/innen, 39 einfache Angestellte, Beamtinnen, Beamte. 13 Selbständige, 4 Akademiker/in, 18 Hausfrau/Hausmann und 2 sonstiges. Bei einer Person fehlt diese Angabe. Auch hier erscheint es einfacher, die Datenauswertung mit drei Gruppen vorzunehmen, die hyrarchisch ansteigen. Gruppe 1 umfaßt die ungelernten Arbeiter/innen und die Hausfrauen/Hausmänner, in Gruppe 2 werden die Facharbeiter/innen und die einfachen Angestellten, Beamtinnen, Beamten zusammengefaßt und in Gruppe 3 die höheren Angestellten, Beamtinnen, Beamten, die Selbständigen und die Akademiker/innen. Die Gruppe 1 umfaßt somit 31 Personen, die Gruppe 2 62 Personen und die Gruppe 3 42 Personen. Die Personen, die sonstiges angegeben hatten werden nicht berücksichtigt.
Tabelle 3: Stichprobenbeschreibung
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Basisdaten BS10 - BS12 liegen im einzelnen ausgewertet nicht vor. Diese werden zur Untersuchung der Hypothesen, Abschnitt 6 , verwendet.
4.2 Ergebnisse zum Item Arztbesuch (AB01-AB03)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 4: Ergebnisse AB01-AB03
Die auch in der Tabelle aufgezeigten Prozentzahlen beziehen sich nur auf die Personen, die Angaben zu dieser Frage gemacht haben. Einen Hausarzt haben somit 89 % der Befragten, dieser ist bei 61 % der Versuchspersonen männlich und bei 39 % weiblich. 61 % geben an, regelmäßig einen Arzt zu besuchen. Davon besuchen 18,8 % jährlich, 23,9 % vierteljährlich, 30,4 % monatlich und 13 % wöchentlich einen Arzt. Keiner der Befragten gibt an, mehrmals wöchentlich einen Arzt aufzusuchen.
4.3 Ergebnisse zum Item Gesundheit (GS01 - GS22)
11,6% der Befragten schätzen ihren Gesundheitszustand im Vergleich zu anderen Frauen/Männern gleichen Alters als sehr gut ein, 42% beurteilen ihn mit gut und 37,7% mit mittelmäßig. 7,2% haben das Gefühl, daß deren Gesundheitszustand schlechter sei im Vergleich zu anderen gleichen Alters und nur 1,4% geben an, daß dieser sehr schlecht sei. Bei 3,6% verbesserte sich die Gesundheit in den letzten 5 Jahren, bei 7,2% verbesserte er sich etwas, 39,1% empfinden die Gesundheit als gleich gut und 39,8% etwas schlechter. Die prozentualen Angaben der letzten beiden Fragen beziehen sich ebenfalls nur auf die Personen, die Angaben dazu gemacht haben.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 5: Ergebnis GESV01
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 6: Ergebnis GS02
Es wird ein Krankheitsbelastungs-Index aus den Items GS03 - GS20 (Krankheiten / 18 Items) gebildet. D.h. pro Frage können 0 bis 3 Punkte erreicht werden, der höchste zu erreichende Wert hat 54 Punkte, der höchste erreichte Wert hat 20 Punkte. Fehlt ein Item, wird dies als ein Missing gewertet und nicht berücksichtigt. Es treten 20 Missings auf. Aus den anderen werden wieder drei Gruppen gebildet. In Gruppe 1 werden diejenigen zusammengefaßt, die 0 bis 2 Punkte (34,7 %) erreicht haben, in Gruppe 2, die mit 3 bis 6 Punkten (30,5 %) in Gruppe 3, die mit 7 bis 20 Punkten (34,5 %). Der arithmetische Mittelwert der Erkrankungen der Gesamtstichprobe beträgt 3.4 bei einem range von 0 bis 10, der Median liegt bei 3. Wird die Gesamtstichprobe unterteilt in Jung - bis einschließlich 72 Jahren - und Alt - ab 73 Jahren -, so ergibt sich folgendes: Personen bis einschließlich 72 Jahren (N=59) haben durchschnittlich 2,5 Krankheiten und Personen ab 73 (N=60) leiden durchschnittlich an 4,2 Krankheiten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 7: Ergebnisse GS03-GS20
4.4 Ergebnisse zum Item Gesundheitsverhalten (GSV01-GSV05)
87,1 % der Stichprobe sind Nichtraucher. 91,4 % geben an, täglich Obst und/oder Gemüse zu essen. 87,7% verneinten die Frage: ,,Trinken Sie täglich mehr als ein Glas Wie oder Bier?". Sich regelmäßig zu Bewegung behaupten 81,2 % der Stichprobe und 71,9% der Befragen achten auf fettreduzierte Ernährung. Hierbei wird auch nur wieder von den Personen ausgegangen, die dazu Angaben gemacht haben.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 8: Ergebnisse GESV01-GESV04
Um die Genauigkeit bzw. Zuverlässigkeit der erhobenen Daten festzustellen, werden die Skalen auf Reliabilität untersucht.
5. Überprüfung auf Reliabilität der Skalen Selbstwirksamkeit, Comliance, Gesundheitskontrollüberzeugung und Arztkontrollüberzeugung
Der Alphawert für die Fragen zur Selbstwirksamkeit.(AS01 - AS10/10 Items) beträgt 0,91, für die Items (C01 - C10/Compliance/10 Items) wird ein Wert von 0,64 berechnet und für die Items GK01i - GK10e (Gesundheitskontrollüberzeugung) ein Wert von 0,69, welcher durch die Löschung der Frage GK01i zustande kommt, da hierdurch ein höherer Wert erzielt werden kann. Diese drei Skalen sind reliabel. Die Skala zur Arztkontrollüberzeugung (AK01 - AK06 /6 Items) erzielt nur einen Wert von 0,42 und ist somit nicht reliabel.
6. Hypothesenuntersuchung
Unter der ersten Fragestellung, ob das Bildungsniveau Auswirkungen auf die Compliance hat, werden die folgenden Hypothesen untersucht:
1. Niedrige Bildung geht einher mit niedriger Compliance.
2. Hohe Bildung geht einher mit niedriger Compliance.
Zur Überprüfung dieser beiden Hypothesen wird die einfaktorielle Varianzanalyse benutzt. Compliance ist dabei die abhängige Variable und das Bildungsniveau die unabhängige Variable. Daten aus dem Item BS08: ,,Welchen höchsten Schulabschluß haben Sie?" werden dafür herangezogen. Dabei wird dieses Item in drei Gruppen gegliedert: 1. Volksschule/ohne Abschluß, 2. Mittlere Reife, 3. Abitur/Hochschule. Die Unterteilung ,,Sonstiges, und zwar..." wurde dabei vernachlässigt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 9: Mittelwerte der Compliance, F-Wert und p-Wert
Wie in der obigen Tabelle ersichtlich, unterscheiden sich die Mittelwerte der Compliance geringfügig. Gruppe 1) hat einen Compliance-Mittelwert von 1.57, Gruppe 2) von 1,53 und Gruppe 3) von 1,64. Die Berechnung des F-Wertes ergibt 0.45. Die Hypothese haben sich nicht bestätigt, da mit Hilfe des Signifikantstestes ein völlig unsignifikantes Ergebnis von p = 0.63 (> 0.01) errechnet wurde.
Unter der zweiten Fragestellung, ob es einen gegenläufigen Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Compliance gibt, werden folgende zwei Hypothesen untersucht:
1. Hohe Selbstwirksamtkeit geht einher mit niedriger Compliance.
2. Geringe Selbstwirksamkeit geht einher mit hoher Compliance.
Zur Überprüfung wird eine Korrelation zwischen Selbstwirksamkeit und Compliance berechnet. Diese ergibt: 0.28. Der Signifikanztest ergibt einen Wert von p = 0.002 (<0.01) und somit ein hochsignifikantes Ergebnis.
Die Hypothesen haben sich nicht bestätigt, da es einen positiven Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Compliance gibt.
Mit der dritten Fragestellung soll untersucht werden, ob zwischen der Krankheitsbelastung, Selbstwirksamkeit und Compliance ein Zusammenhang besteht. Es wird die Hypothese untersucht, ob eine hohe Krankheitsbelastung zu einer Reduktion der Selbstwirksamkeit und das wiederum zu einer hohen Compliance führt.
Es handelt sich hierbei um eine Verlaufshypothese. Für die Untersuchung einer Verlaufshypothese werden Langzeitstudien benötigt, um den Verlauf und die Wirkungsmechanismen genauer betrachten zu können. Diese würde am den Rahmen der hiesigen empirischen Untersuchung sprengen. Um dieser Fragestellung bestmöglichst unter den vorliegenden Voraussetzungen näher zu kommen, wird versucht, die Frage aufzuteilen: Es werden einfaktorielle Varianzanalysen über
a) Krankheitsbelastung als unabhängige Variable und Selbstwirksamkeit als abhängige Variable und
b) Krankheitsbelastung als unabhängige Variable und Comliance als abhängige.
Zu Beginn wurde ein Zusammenhang zwischen Krankheitsbelastung und Compliance ermittelt. Aus dem 18 Items umfassenden Krankheitsfragebogen wird wie schon erwähnt ein Krankheitsbelastungsindex gebildet, der die Befragten in Gruppen mit leichter (0 - 2 Punkte), mittlerer (3 - 6 Punkte) und starker (7 - 20 Punkte) Krankheitsbelastung einteilt. 34,7% der Befragten gehören zur wenig belasteten, 30,5% zur mittel und 34,7% zur stark belasteten Krankheitsgruppe an. Eine einfaktoriellen Varianzanalyse ergab einen F-Wert von 0.042 und p= 0.95. Die dazugehörigen Mittelwerte sind für die wenig belastete Gruppe M=1.74, für die mittel belastete Gruppe M=1.70 und für die stark belastete Gruppe M=1.73. Dieses Ergebnis ist nicht signifikant. Die unterschiedlichen Krankheitsbelastungen haben der Untersuchung zufolge keine Auswirkung auf die Compliance, denn diese ist in allen drei Krankheitsgruppen annähernd gleich und insgesamt ziemlich hoch. Ebenso besteht auch zwischen der Krankheitsbelastung und der Selbstwirksamkeit kein signifikanter Zusammenhang. Die einfaktorielle Varianzanalyse ergibt einen F-Wert von 0.45 und ein p=0.64. Die Mittelwerte sind für die erste Gruppe M=1.72, für die zweite M=1.84 und für die dritte M=1.82. Es ist zu erkennen, daß die Selbstwirksamkeitserwartungen in allen drei Gruppen ziemlich hoch sind. Damit ist auch die letzte Hypothese widerlegt.
Mit Hilfe der multiplen Regression werden die Prädiktorvariablen Alter, Krankheit, Beruf und Selbstwirksamkeit einzeln und zusammengenommen auf die höchste Vorhersagekraft für die Kriteriumsvariable Compliance berechnet. Dabei ergibt sich bei einem multiplen F von 2.17 und einem p=0.06 eine multiple Korrelation von 0.31. Das bedeutet, daß alle Prädiktoren zu 31% Compliance voraussagen. Die einzelnen Beta-Gewichte betragen für die gesundheitsbezogene Konrollüberzeugung 0.07, für die Krankheitsbelastung -0.11, für die Selbstwirksamkeit 0.29, für den Beruf 0.12 und für das Alter 0.06. Hervorzuheben ist das Beta-Gewicht der Selbstwirksamkeit von 0.29 und einem Signifikanzniveau p=0.002, was hochsignifikant ist und erkennen läßt, daß die Compliance fast allein durch Selbstwirksamkeit vorhergesagt wird.
7. Weitere Untersuchungen
Es werden hier nur kurz einige Untersuchungen aufgeführt, die nicht unter dem Gesichtspunkt der gestellten Hypothesen fallen, jedoch zur Thematik ,,Die Voraussetzung der Compliance bei älteren Patienten" ganz interessant erscheinen.
Untersucht werden auch folgende Zusammenhänge, die aber aufgrund Nichtsignifikanz verworfen werden:
- Der Beruf wirkt sich auf die Compliance aus (F=0.5913, p=0.7618)
- Die Selbstwirksamtkeit hat Auswirkungen, ob man vor dem Fall der Mauer (1989) in der ehemaligen DDR oder BRD gelebt hat (F=0.2144, p=0.6441)
Es kann ein signifikanter Unterschied zwischen Männern und Frauen bezüglich ihrer Kontrollüberzeugung festgestellt werden. Die Frauen erreichen einen Mittelwert von 2.4 und die Männer einen Mittelwert von 2.12. Der F-Wert ist dabei 7.1446 und der Wert für die Signifikanz von p= 0.0085.
Auch mit Hilfe von Korrelationsberechnungen können Zusammenhänge zwischen zwei Variablen festgestellt werden.
- Arztbezogene Kontrollüberzeugung und der Variablen Krankheit (p = 0,281)
- Arztbezogene Kontrollüberzeugung und der Variablen Bildung (p = -0.307)
- Arztbezogene Kontrollüberzeugung und der Variablen Alter (p = 0,271)
Diese Zusammenhänge jedoch müssen skeptisch gesehen werden, da die Skala der arztbezogenen Kontrollüberzeugung einen Alphawert von 0,42 hat und somit nicht reliabel ist.
Der größte Zusammenhang ist bei den Variablen Krankheit und Alter (r=0.415) erkennbar. Der Unterschied zwischen den jungen und alten Alten ist bei einem F-Wert von 19,5 hochsignifikant.
IV. Zusammenfassung und Diskussion
Wie in der obigen Datenauswertung erkennbar, kann keine der drei Hypothesen bestätigt werden. Die Ergebnisse der Untersuchungen sehen zusammenfassend folgendermaßen aus:
- Die Bildung hat keine Auswirkungen auf die Compliance.
- Der Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Compliance ist positiv.
- 31% der Compliance sind durch Selbstwirksamkeit vorhersagbar.
Über statistische Datenerhebungen und dessen Auswertungen kann sicher gestritten werden. Selbst der Erhalt von signifikanten Ergebnissen sagt noch nicht, daß die untersuchte Hypothese frei von Fehlentscheidungen ist. Es verbleibt stets eine Restwahrscheinlichkeit von 1% (oder 5%), keinen Fehler zu begehen. Es wird davon ausgegangen, daß die Ergebnisse statistisch einwandfrei untersucht wurden und somit die aufgestellten Hypothesen ihre Gültigkeit nicht beweisen.
Im Zusammenhang mit der Thematik: ,,Die Voraussetzung der Compliance bei älteren Patienten" kann eines ganz klar und untermauert von den oben dargestellten Ergebnisses behauptet werden: Selbstwirksamkeit ist u.a. Voraussetzung der Compliance bei älteren Patienten. Wo auch immer sich Menschen mit der Altersforschung beschäftigen, stößt man auf den Begriff Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit als ein Gefühl der Kompetenz, der Kontrolle und der eigenen Macht. Durch verstärktes Wissen über das wirkende Selbst ist es möglich, das Altern nicht als Verfall und Tod in Kauf zu nehmen, sondern das Leben bis zum Tode erfolgreich und bewußt zu meistern. Das Altern weist eine Menge an Spielraum auf, um sich fit zu halten, um Schäden zu vermeiden. Es kommt darauf an, den Körper nicht zu strapazieren, sondern zu entlasten und vor allem, möglichst lange unabhängig im vertrauten Umfeld zu leben. Die Gerontologie bedauert u.a., daß obwohl Kompetenzpotential vorhanden ist, ein selbständiges Leben im Alter längst noch nicht der allgemeinen Auffassung entspricht. In dieser Stichprobe lebt die Mehrzahl der Probanden (82,6%) in ihrer eigenen Wohnung/eigenem Haus. Lediglich 13,7% der Probanden leben in Seniorenwohnheimen oder Altersheimen. Bei einen Durchschnittsalter von 74,5 Jahren ist eine Selbständigkeit/Selbstwirksamkeit schon allein anhand der Wohnsituation zu verzeichnen.
Die Probanden zeigen auch ein positives Gesundheitsverhalten auf. Die Mehrzahl ernährt sich gesund, raucht nicht und bewegt sich regelmäßig. Auch ist die Stichprobe etwas, aber nicht wesentlich gesünder als die Stichprobe der Berliner Altersstudie. Dabei fühlen sich die Probanden im Vergleich zu anderen ihres Alters zu 53,6% gut bis sehr gut. 80,6% der Befragten haben einen Hausarzt, wobei 67,3% wöchentlich, monatlich bis halbjährlich regelmäßig zum Arzt gehen. Die Mehrzahl der Stichprobe ist somit unter regelmäßiger ärztlicher Kontrolle.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema der Studie "Die Voraussetzung der Compliance bei älteren Menschen"?
Die Studie untersucht die Bedingungen und Faktoren, die die Compliance (Mitarbeit bei medizinischen Maßnahmen) älterer Patienten beeinflussen. Sie konzentriert sich besonders auf den Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit, Krankheitsbelastung und Compliance.
Was ist Compliance im Kontext dieser Studie?
Compliance bezieht sich auf die Bereitschaft eines Patienten, aktiv an diagnostischen oder therapeutischen Maßnahmen teilzunehmen, beispielsweise durch die zuverlässige Befolgung ärztlicher Anweisungen und Verordnungen.
Was bedeutet Selbstwirksamkeit in Bezug auf ältere Menschen?
Selbstwirksamkeit beschreibt das Gefühl einer Person, ihre Lebensumstände kontrollieren und beeinflussen zu können. Im Alter kann dies bedeuten, dass man trotz körperlicher oder gesundheitlicher Einschränkungen das Gefühl hat, sein Leben aktiv gestalten zu können.
Welche Hypothesen wurden in der Studie untersucht?
Folgende Hypothesen wurden untersucht:
- Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Compliance (niedrige/hohe Bildung = niedrige Compliance)
- Gegenläufiger Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Compliance (hohe/geringe Selbstwirksamkeit = niedrige/hohe Compliance)
- Zusammenhang zwischen Krankheitsbelastung, Selbstwirksamkeit und Compliance (hohe Krankheitsbelastung -> reduzierte Selbstwirksamkeit -> hohe Compliance)
Welche Methoden wurden in der Studie verwendet?
Die Studie verwendete einen Fragebogen zur Datenerhebung. Der Fragebogen umfasste Fragen zu Basisdaten, Selbstwirksamkeit, Arztbesuch, Arztkontrollüberzeugung, Gesundheit, Compliance, Gesundheitsverhalten und Gesundheitskontrollüberzeugung. Die Daten wurden mit SPSS/PC+ ausgewertet.
Wer waren die Teilnehmer der Studie?
Die Stichprobe bestand aus 138 Personen, überwiegend Frauen, mit einem Durchschnittsalter von 74,5 Jahren. Die Teilnehmer lebten in unterschiedlichen Wohnsituationen und hatten unterschiedliche Bildungs- und Berufsabschlüsse.
Welche Hauptergebnisse wurden in der Studie erzielt?
Keine der aufgestellten Hypothesen konnte bestätigt werden. Es gab keinen Zusammenhang zwischen Bildung und Compliance. Es wurde ein positiver Zusammenhang zwischen Selbstwirksamkeit und Compliance gefunden. Die Studie ergab, dass Selbstwirksamkeit die Compliance zu 31% vorhersagen kann.
Welche Bedeutung hat Selbstwirksamkeit für die Compliance älterer Patienten?
Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass Selbstwirksamkeit eine wichtige Voraussetzung für die Compliance älterer Patienten ist. Ein starkes Gefühl der Kompetenz, Kontrolle und eigenen Macht kann dazu beitragen, dass ältere Menschen aktiv an ihrer medizinischen Behandlung teilnehmen.
Welche Empfehlungen werden auf der Grundlage der Ergebnisse gegeben?
Ärzte sollten sich der Selbstwirksamkeit ihrer Patienten bewusst sein und diese bei der Behandlungsplanung berücksichtigen. Eine Stärkung der Selbstwirksamkeit kann dazu beitragen, die Compliance zu verbessern und Fehlmedikationen zu vermeiden. Es wird auch die Bedeutung der gerontologischen Ausbildung von Ärzten hervorgehoben.
- Citation du texte
- Ina Reich (Auteur), 1998, Die Voraussetzung der Compliance bei älteren Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/99845